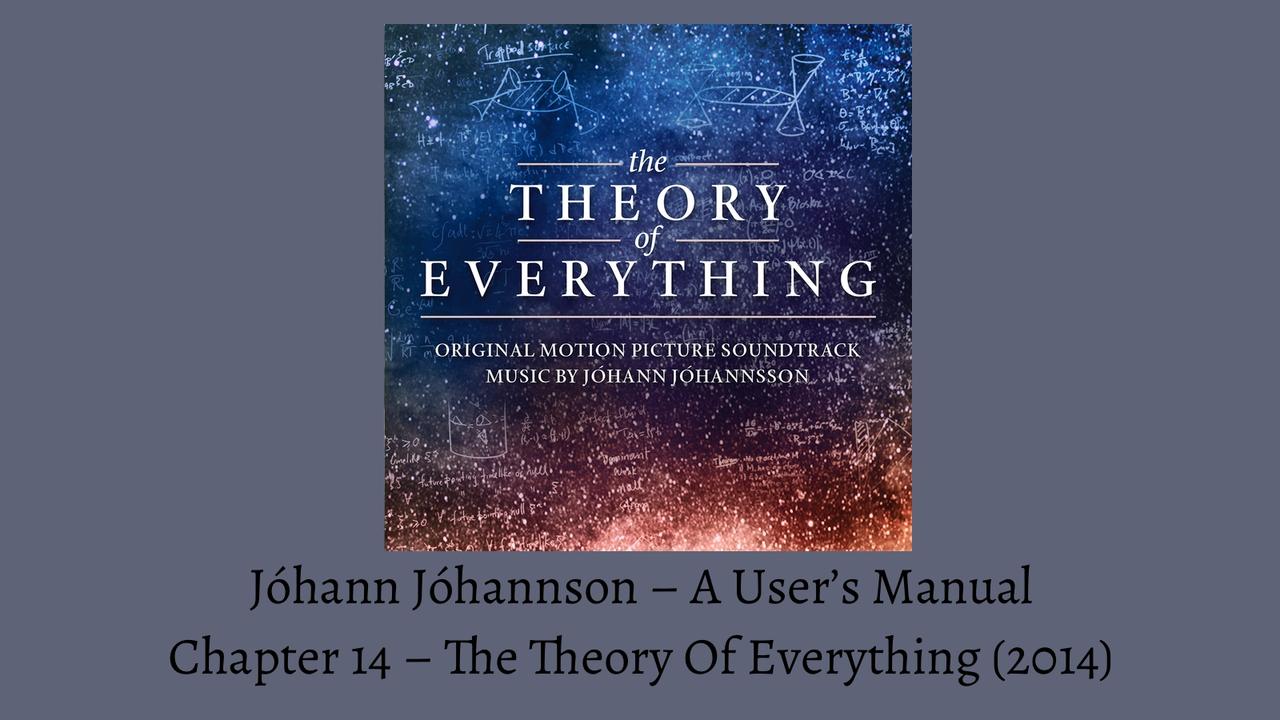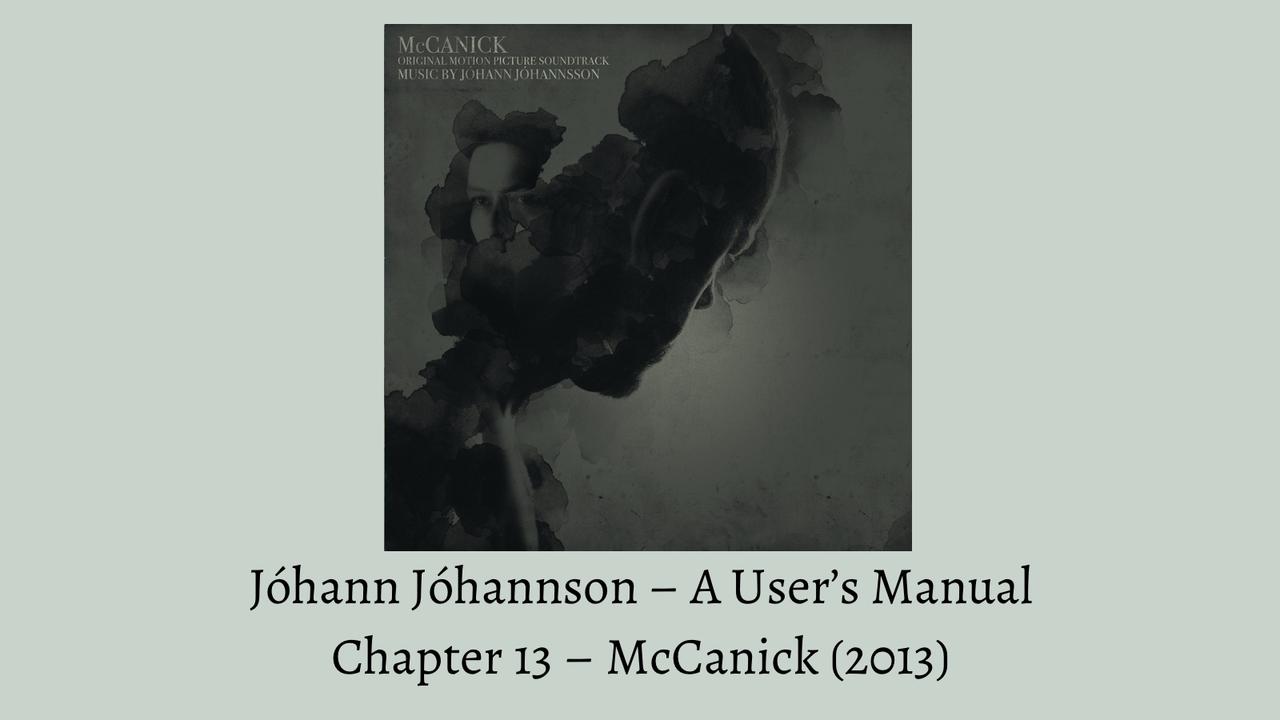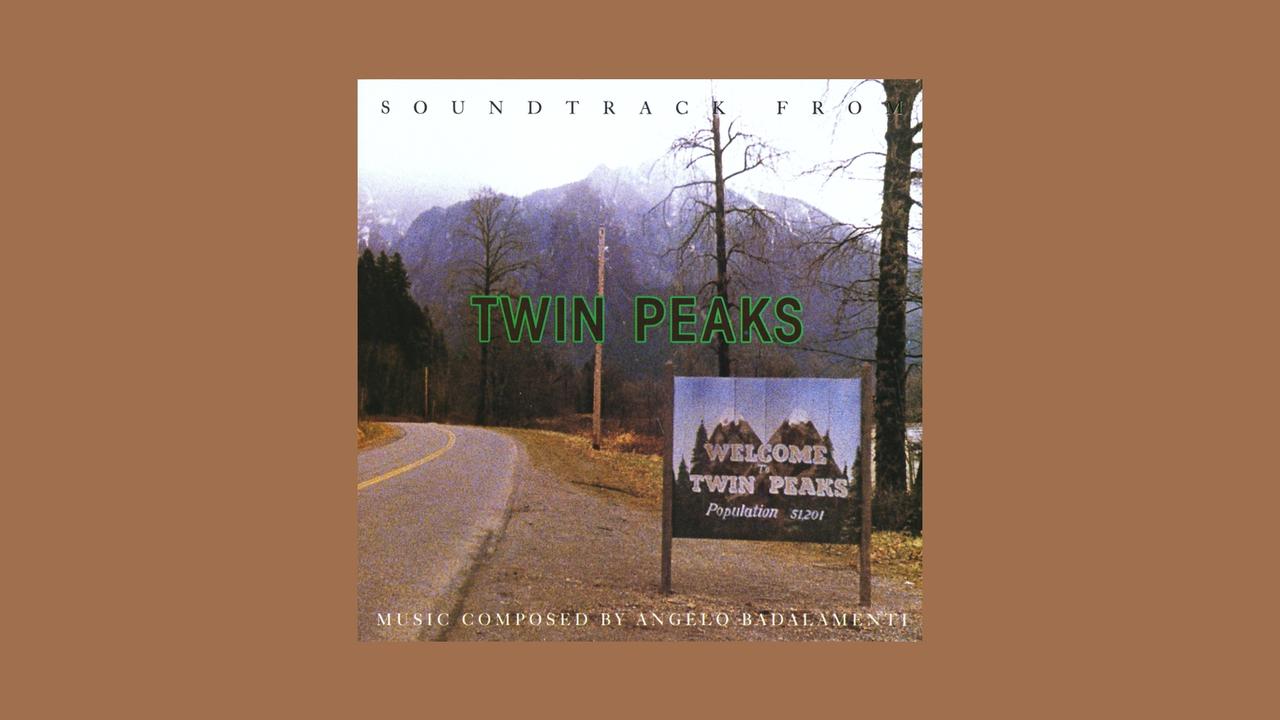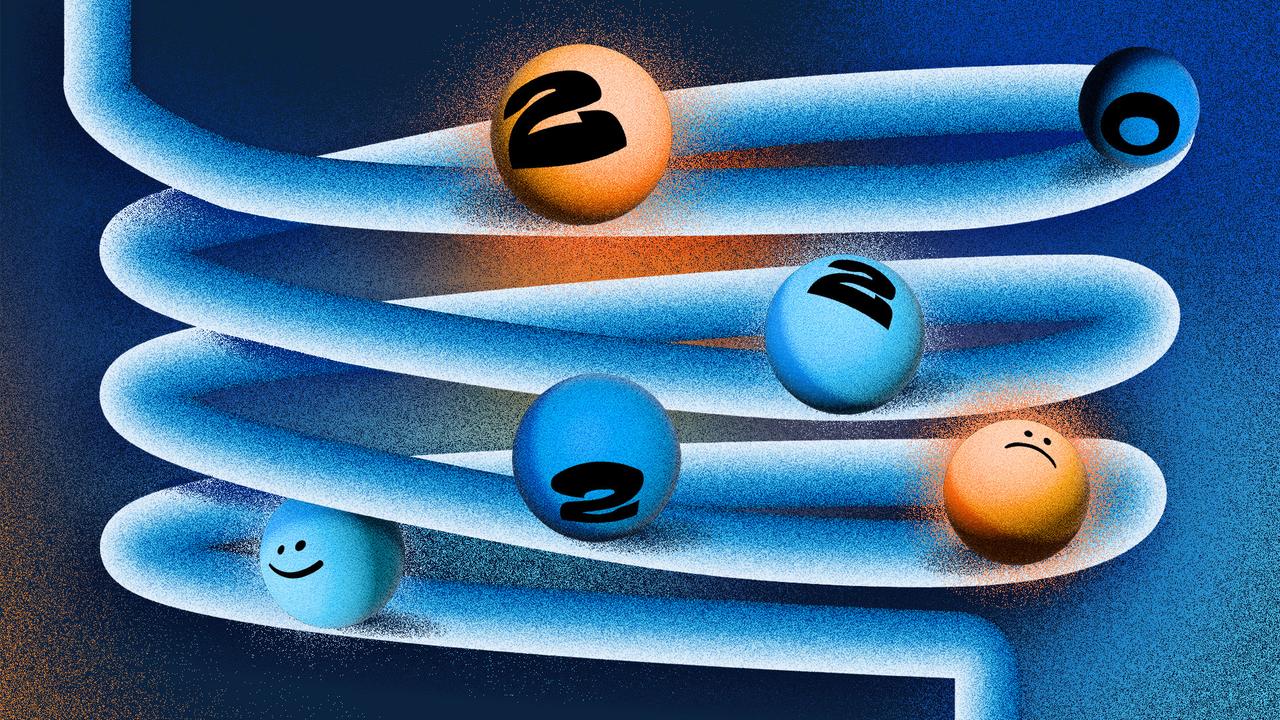Jóhann Jóhannsson – A User’s ManualChapter 14 – The Theory of Everything (2014) – Deutsch
15.2.2023 • Sounds – Gespräch: Kristoffer Cornils, Thaddeus Herrmann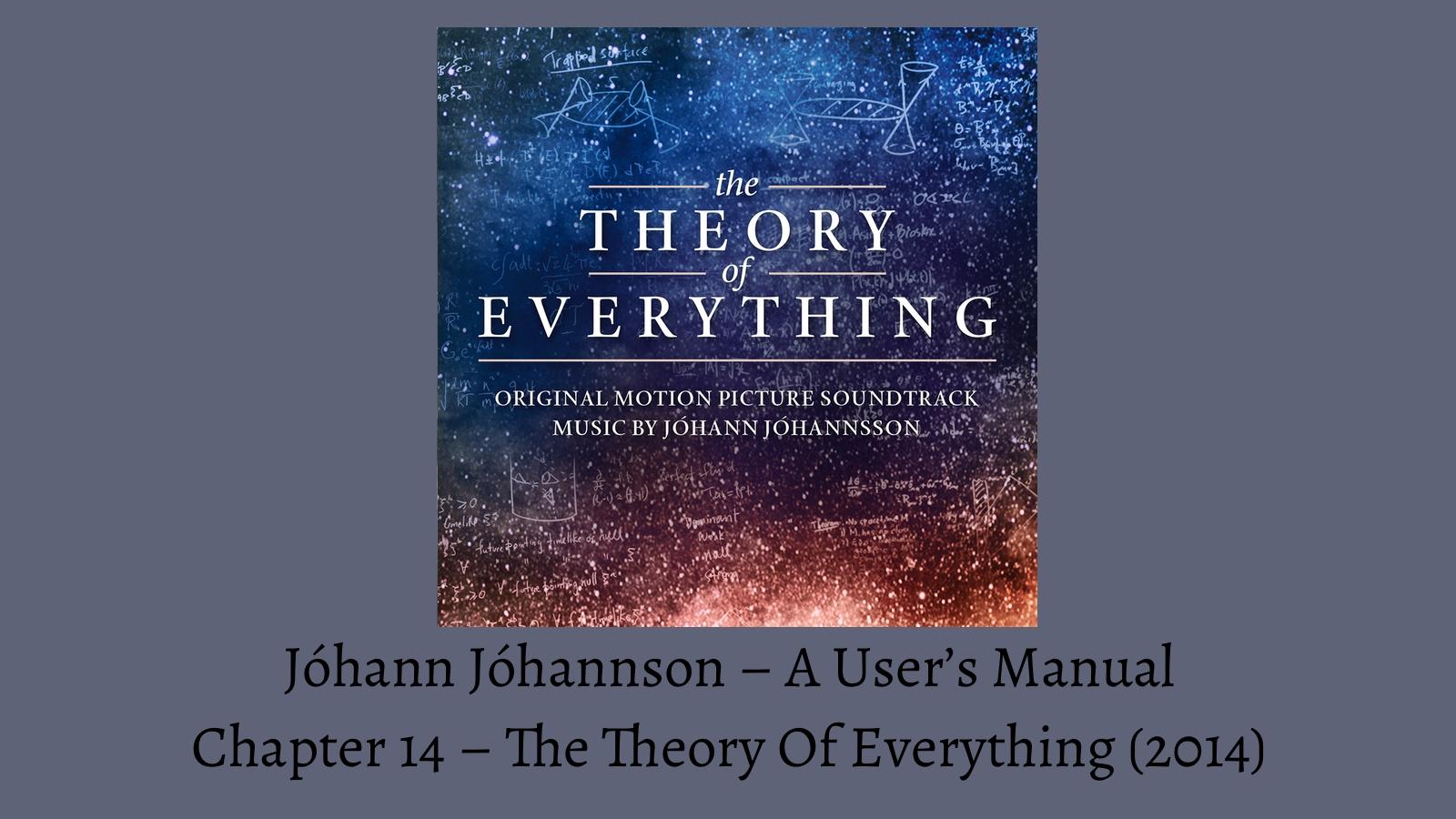
Weit über 20 Alben hat Jóhann Jóhannsson in seiner Karriere veröffentlicht. Wer weiß schon, wie viele Tondokumente noch in der Schublade liegen, die postum noch veröffentlicht werden könnten. Regelmäßig lassen Kristoffer Cornils und Thaddeus Herrmann das Werk des Komponisten Revue passieren – chronologisch, Album für Album. In der 14. Folge geht es um „The Theory of Everything“ aus dem Jahr 2014, den Soundtrack zum Stephen-Hawking-Biopic von James Marsh.
English version? Click/tap here.
Ein junger Physiker verliebt sich in eine Literaturstudentin und stellt nebenbei noch eine der bahnbrechendsten Theorien der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Doch der Körper, in dem dieser Geist arbeitet, arbeitet gegen ihn. Er überlebt länger als ihm vorausgesagt wurde, doch die Ehe zerbricht und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend. Die Geschichte von „The Theory of Everything“ wurde vom Leben geschrieben und nachdem Jane Hawking sie im Jahr 2007 in ihren Memoiren zusammengefasst hatte, nahm Regisseur James Marsh das als Grundlage für einen Film, den Jóhann Jóhannsson vertonen sollte. Er heimste eine der fünf OSCAR-Nominierungen dafür ein, obwohl – oder vielleicht gerade weil – er sich damit musikalisch in ganz anderen Gefilden als noch mit vorigen Soundtrack-Arbeiten bewegte.
Kristoffer: Der schlimmste Ort Berlins ist das Soho House. Dort fallen soziales und finanzielles Kapital in eins, ziehen Menschen mit Hang zum Kokain ihren Juice Cleanse solange durch, bis die Bar aufmacht. Ich war ein paar Mal dort, habe mir den Plattenladen im Erdgeschoss angeschaut (vergesst es), Interviews geführt (mit wem, sage ich nicht) und sogar ein ungewolltes Vorstellungsgespräch gehabt (mit derselben Person sogar). Am 11. November 2014 bin ich etwas lieber als sonst dort hingegangen, denn ich war zu einem Screening von „The Theory of Everything“ eingeladen. Ich ging allein in den Keller, entlang an schwarzen Wänden – der absonderliche Versuch, dem ganzen Unfug einen gleichzeitig industriell-edgy und bourgeois-eleganten Anstrich zu verleihen, literally – und machte kurz auf der Toilette Halt, wo kosmischer Big Ambient à la Emeralds lief.
Dann ins Kino, einem postmodernen Anachronismus aus satten Samtsesseln und viel Gold. Der Film passte dazu. Überproduziert und -budgetiert, cinematografisch wie durch einen Instagram-Filter (wie gesagt: 2014!) gezogen und basierend auf dem Standardnarrativ von Hollywood-Kitsch: viel Liebesduselei, weil ja niemandem einfach so zuzumuten ist, sich für die Geschichte eines radikalen Denkers zu interessieren, wenn nicht eine Frau als Motivation dafür dient. Bäh. Voll war das Kino nicht, Jóhann Jóhannsson aber war zugegen. Nach der Vorstellung unterhielt er sich auf Isländisch mit ein paar Menschen und ich bin nicht dazwischen gebrettert, um ihm ein „Hi, you shook my hand last year, remember me?“ reinzupfeifen. Das war das letzte Mal, dass ich ihn aus der Nähe gesehen habe. Was ich ihm allerdings hätte sagen können: „Sorry about that film but the score is fantastic.”
In den vergangenen zwei Jahren ist es zwischen uns beiden irgendwie zum irrlichternden Meme geworden, dass wir aus irgendwelchen Gründen annahmen, der jeweils andere hätte eine komplett andere Meinung zu dieser Musik. Doch das stimmt nicht: Wir lieben sie beide. Nur allerdings aus verschiedenen Gründen, wie wir letztens beim Dinner feststellten. Was sind deine?
Thaddi: Moment! Bevor wir auf die Musik zu sprechen kommen, möchte ich deine Soho-Steilvorlage aufnehmen. Ich wohne ja in der erweiterten Nachbarschaft und habe als Journalist dort auch zahlreiche Termine durchgemacht und Interviews geführt. Einmal wäre ich fast rausgeflogen, weil mir an der Rezeption nicht geglaubt wurde, dass jemand tatsächlich auf der Terrasse auf mich wartete. Fand ich toll. Ich kann dir nur beipflichten – und einerseits hinzufügen, dass Detroiter Producer mit zweifelhaften Manieren dort gerne logieren, und andererseits alles noch hätte viel schlimmer kommen können. Stell dir vor, der Club im Keller hätte wirklich eröffnet! Nun werden diese Räume zum Glück anderweitig genutzt – und sogar sinnvoll. Glück gehabt. Alles weitere dann in meinen Memoiren.
Die Musik also. Zunächst noch ein paar Fakten – du merkst vielleicht schon, dass ich mich vor meiner eigenen Geschichte zu diesem Album etwas drücke. Die habe ich noch nie erzählt – you hear it here first! Ein 65-köpfiges Orchester. Der Großteil wurde in den Abbey-Road-Studios aufgenommen, die Klavierpassagen vor allem in den Air Studios. Jóhannsson selbst sagt, dass das Klaviermotiv im Opener „Cambridge 1963“ der Ausgangspunkt für den gesamten Soundtrack war. Vielleicht ist diese Information entscheidend, denn: So befreit von allem hatte ich den Komponisten bis zu diesem Punkt noch nicht erlebt. „The Theory Of Everything“ markiert für mich nicht nur ein neues Kapitel in seinem Schaffen. Die Musik ist in ihrer Intimität, Offenheit, Verletzlichkeit und Angreifbarkeit nach wie vor singulär in seiner Diskografie. Mir ist das Angreifbare besonders wichtig. Denn ganz objektiv gehört trieft uns der Kitsch – das Gefällige – hier ja schon grenzwertig laut entgegen. Aber: Das macht alles nichts, bzw. ist epochal sinnstiftend – zumindest für mich.
Ich lege mich mal auf die Couch. Als ich damals die Promo bekam, war ich persönlich einigermaßen am Ende. Beyond repair. Ich lud die Dateien auf mein Telefon und drückte „Play“. Es war Winter und es konnte mir gar nicht kalt genug sein. Die Tränen liefen mir über das Gesicht auf meinen Spaziergängen durch die feindliche Stadt. Und immer wieder blieb ich stehen. Links, rechts, geradeaus? Ich wusste es schlichtweg nicht. Geändert hätte es auch nichts. Alles egal irgendwie. Das unfassbar leicht-wirkende Changieren zwischen … naja, nennen wir es easy und deep dieses Soundtracks hat mir geholfen. Mich getragen. Das ist auch der Grund, warum ich bis heute nie eine Zeile über die Musik geschrieben habe. Vermintes Gebiet sozusagen. Zu heikel, zu persönlich.
Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, sehe ich, dass mir die Kompositionen nicht nur dabei geholfen haben, mich wieder „zu fangen“. Hilfe an- oder in Anspruch zu nehmen kam für mich damals noch nicht in Frage. Das war rückblickend natürlich ein Fehler beziehungsweise einfach dumm. Aber so ist das eben. Mittlerweile bin ich schlauer. „The Theory of Everything“ bleibt deshalb ein Album, über das ich nur schwer sprechen und schreiben kann. Ich verknüpfe mit der Musik zu persönliche Dinge. Eine Lebensphase, die ich eigentlich nicht mehr erleben wollte, dann aber doch noch mal erlebt habe. Und mit professioneller Hilfe viel besser auf die Reihe bekommen habe. Pure Kraft also, dieses Album. Sinnvoll argumentieren kann ich das nicht. Aber ich weiß, dass du verstehst, wie ich das meine. Und nun bist du wieder dran.
Kristoffer: Das ist eine gleichermaßen unschöne wie schöne Geschichte. Unschön, weil … na ja, ist klar. Tatsächlich kannten wir uns dereinst noch nicht persönlich – beziehungsweise lediglich „vom Lesen“, wie das in unserer Branche heißt, ich dich zumindest – und ich sollte erst knapp anderthalb Jahre später auf deiner Matte stehen, um mit dir und Christian über Musik zu sprechen, was immer auch hieß: nach getaner Arbeit über Jóhannsson.
Jóhannssons Musik kann Halt und Hoffnung geben, wenn der Boden unter den Füßen wegrutscht und der Horizont kippt. Ich kann vielleicht nicht behaupten, dass es mir mit „The Theory Of Everything“ genauso gegangen wäre wie dir – mit „The Miners’ Hymns“ im Gesamten und „The Cause of Labour Is the Hope of the World“ im Speziellen aber in jedem Fall.
Was ich mit Sicherheit sagen kann: Der Herbst 2014 war auch nicht die beste Zeit meines Lebens. Und damit kommen wir zum Schönen an Jóhannssons Musik, das deine Geschichte so eindrücklich illustriert: Sie kann Halt und Hoffnung geben, wenn der Boden unter den Füßen wegrutscht und der Horizont kippt. Ich kann vielleicht nicht behaupten, dass es mir mit „The Theory Of Everything“ genauso gegangen wäre wie dir – mit „The Miners’ Hymns“ im Gesamten und „The Cause of Labour Is the Hope of the World“ im Speziellen aber in jedem Fall.
Vielleicht kehren wir aber zum Handfesten zurück, das heißt zur Musik. Du sagst, dieser Soundtrack würde für dich ein neues Kapitel in Jóhannssons Schaffen markieren. Ich verstehe das nicht oder würde schlicht widersprechen. Ist dieser Score nicht eigentlich eine komplette Anomalie in seinem Werk? Als nächstes auf dem Zettel stehen haben wir „I Am Here“, den OST zu „Sicario“, „End of Summer“ und schließlich sein Quasi-Comeback-Album „Orphée“ – alles keine Veröffentlichungen, die unbedingt etwas mit „The Theory Of Everything“ gemein hätten, wenn du mich fragst.
Nein, ich denke gerade, dass sich Stärke und Strahlkraft dieser 27 (!) Stücke daraus speisen, dass sie weitgehend abgekoppelt von Jóhannssons sonstigem Schaffen stehen. Natürlich gibt es da so einige Motive und Ideen, kompositorische Vorlieben und spezifische Klänge, die wir bereits seit „Englabörn“ oder „And In The Endless Pause There Came The Sound Of Bees“ aus seinem Werk kennen und die sich noch in nachfolgenden Arbeiten bemerkbar machen. Aber in Stimmung und Stil ist „The Theory Of Everything“ sehr singulär, oder nicht?
Das zumindest macht seine Stärke für mich aus, deshalb funktioniert dieses so nah am Kitsch orientierte Auftragswerk für einen wirklich furchtbar bescheuerten Film so wunderbar gut: Gerade indem er sich weitgehend den Konventionen des klassischen Soundtracks beugt. Das Orchester beziehungsweise tradierte Solo-Instrumente für derlei Hollywood-Produktionen – Klavier, Klavier, Klavier und Streicher obendrauf! – hat Vorrang vor allen Experimenten, zu denen er in der Lage gewesen wäre und denen er sich in seiner Arbeit an den Autoren-Blockbustern von Denis Villeneuve widmete.
„The Theory Of Everything“ ist die reine Lehre, ein formstrenger Soundtrack, der meisterhaft mit Leitmotiven und Atmosphäre arbeitet. „Befreit“ nennst du seine Arbeit hier. Ich stimme dem vollumfänglich zu, würde nur aber hinzufügen, dass diese Freiheit gerade aus der Einschränkung heraus geboren wurde, hier etwas sehr Konventionelles abliefern zu müssen. Aber vielleicht meintest du genau das auch?
Für mich ist das Album ein Kipppunkt.
Thaddi: Da du ja keine Couch hast, würde ich beim nächsten Mal eine Tagesdecke mitbringen, mich bei dir aufs Bett legen, und mich deinen Analytiker-Fragen und -Notizen ergeben. Ich stimme schon zu. So ein Album hat Jóhannson nie wieder aufgenommen. Das ist interessant, weil – wie du richtig sagst – wir in seinem Gesamtwerk Motive und Ideen beobachten, die immer wieder mal auftauchen, abgeschliffen und den Umständen angepasst werden. „The Theory Of Everything“ sticht heraus – ist in all seinem Verständnis für etwaige Erwartungshaltungen an das „Prinzip Soundtrack“ zumindest für mich ein Meilenstein. Das Konventionelle klingt an der Oberfläche genau so: konventionell. Ein großer Wurf einerseits und ein vielleicht cleverer Trick andererseits. Faktisch hören wir hier Kompositionen, Arrangements und Stücke in einer Stimmung, die Komponist:innen mit Sicherheit in sich tragen, vielleicht ob ihrer mehr oder weniger mühsam aufgebauten Reputation – bewusst oder unbewusst – so aber nie zugelassen haben oder zulassen wollten. Für mich ist das ein Kipppunkt.
Was heißt schon „konventionell“? Große Momente? Atmo? Emotionen? Ja, aber natürlich reichen diese Parameter nicht. Für durchschnittliche Filmmusik schon, Jóhannson jedoch ist nicht der durchschnittliche OST-Macher. Für mich ist es so: Er sieht die Bilder, versteht das Potenzial des Films und setzt ihm mit der Musik etwas entgegen. Etwas, das auf der Oberfläche wunderbar funktioniert, die Bilder perfekt orchestriert, gleichzeitig jedoch abstrahiert. Für mich ist der Soundtrack ein Beispiel für Erhabenheit, die klassischen und gelernten Formeln folgt, aber dennoch weiter geht. Die Emotionen sind offensichtlicher als in anderen Alben. Damit macht sich Jóhannsson natürlich angreifbar. Aber ich bilde mir ein zu verstehen, warum und vor allem wie er das bewerkstelligt. Mit großen Ideen, die aufgenommen wurden, bevor die allumfassende Reflexion der eigenen künstlerischen Chuzpe wichtig wurde.
Kristoffer: Erhabenheit ist ein schönes Stichwort, weil es so groß und kompliziert ist. Das liegt vor allem daran, dass sich darunter einiges vorstellen lässt. Bei mir ist das Wort mit Vorstellungen von Gravitas, Größe und Wucht verbunden. Die lassen sich hier sicherlich auf die eine oder andere Art auch anwenden, aber würden nur eine Seite der Medaille beschreiben. Die andere ist geprägt von Leichtfüßigkeit, Bescheidenheit und Subtilität. Diese Ambivalenz macht meiner Meinung nach „The Theory Of Everything“ zu einem großen Werk und ein Werk ist es überhaupt, weil Jóhannsson es anscheinend so konzipiert hat. Das ist keine Zusammenstellung von Szenenmusik, vielmehr scheint er hier tatsächlich ein durchgängiges Album, das heißt eine Erzählung, konstruiert zu haben. Und war kompositorisch so weit, dass er sie umsetzen und zugleich aber Konzessionen an die Bilder machen konnte. Denn die – oder zumindest das Script, Storyboard, wie auch immer – werden sicherlich den initialen Funken geliefert haben, zwangsläufig natürlich, aber insgesamt lodert doch eine ganz andere Flamme in dieser Musik. Dieser Soundtrack ist ein trojanisches Pferd: Der Komponist streicht alle Punkte auf der Hollywood-To-Do-List durch und drückt derweil seine ganz eigene Vision durch. Das macht „The Theory Of Everything“ zu einer Schlussnote und vielleicht also gebe ich dir doch recht, was das Öffnen eines neuen Kapitels angeht: Indem er dieses für sich schließen konnte, hatte er sich alle möglichen Freiheiten erkämpft, wie sie den Rest seiner Karriere geprägt haben. Auf eine Art verdanken wir dieser Arbeit wohl solche Großtaten wie „Arrival“, denn Jóhannsson hatte sich bewiesen, die Ohren der Welt für sich gewonnen zu haben. Er konnte endlich unbekümmert das tun, was er als seine eigentliche Aufgabe ansah: Den Sound eines Films zum Mitspieler machen.