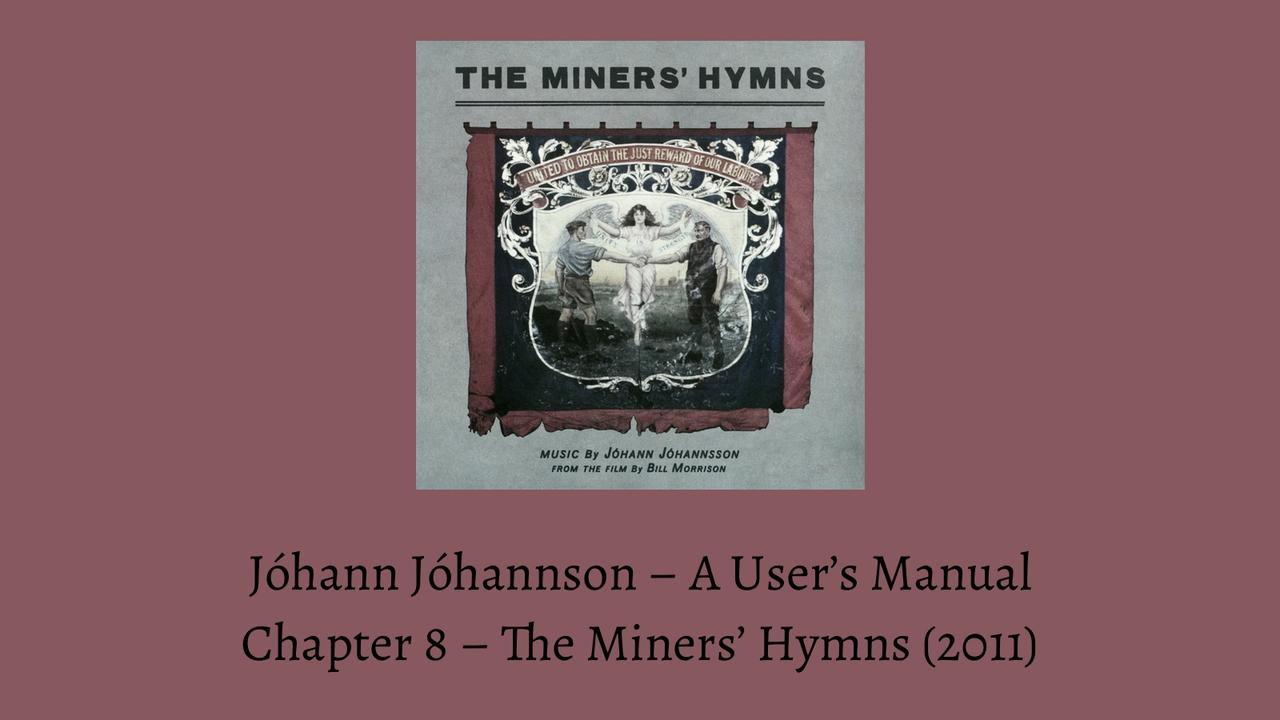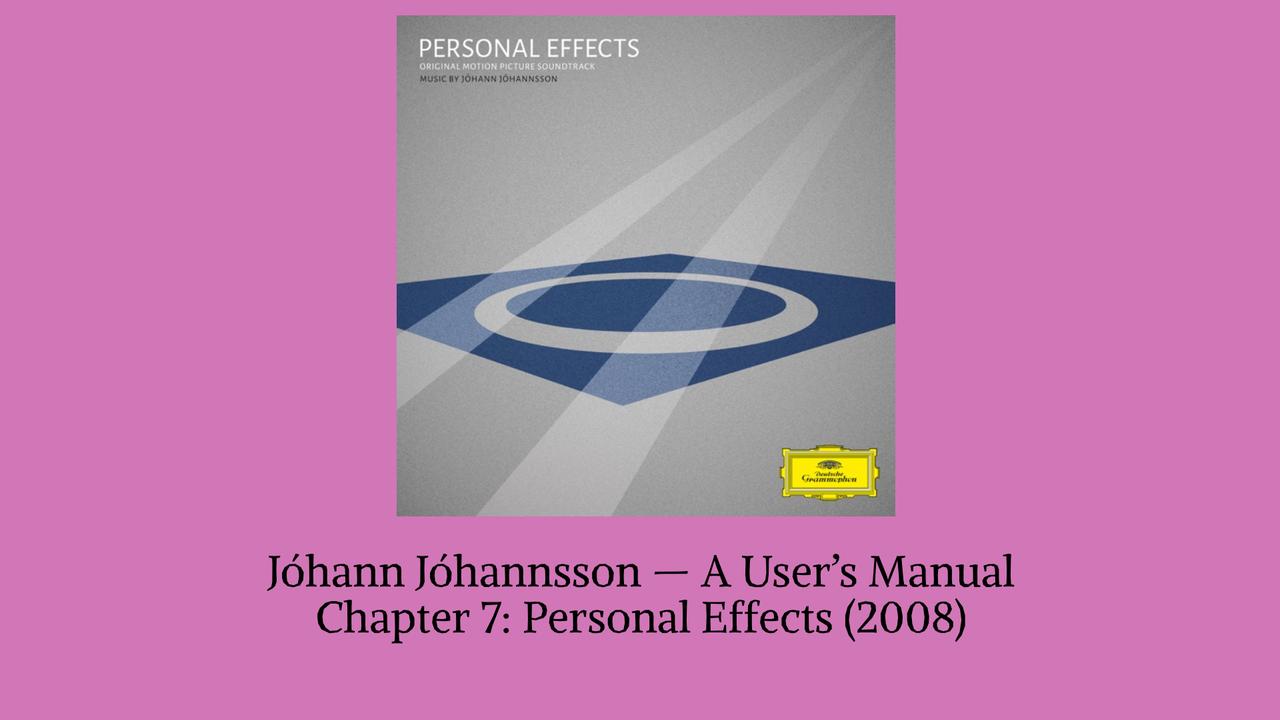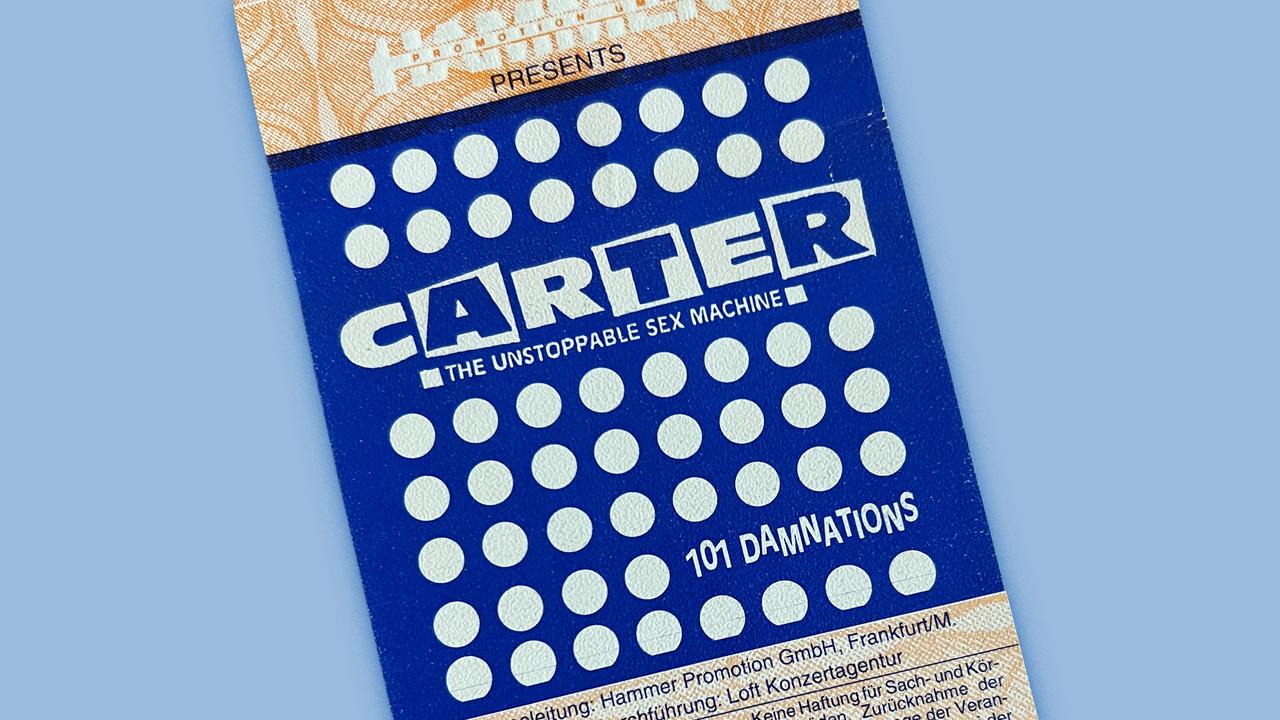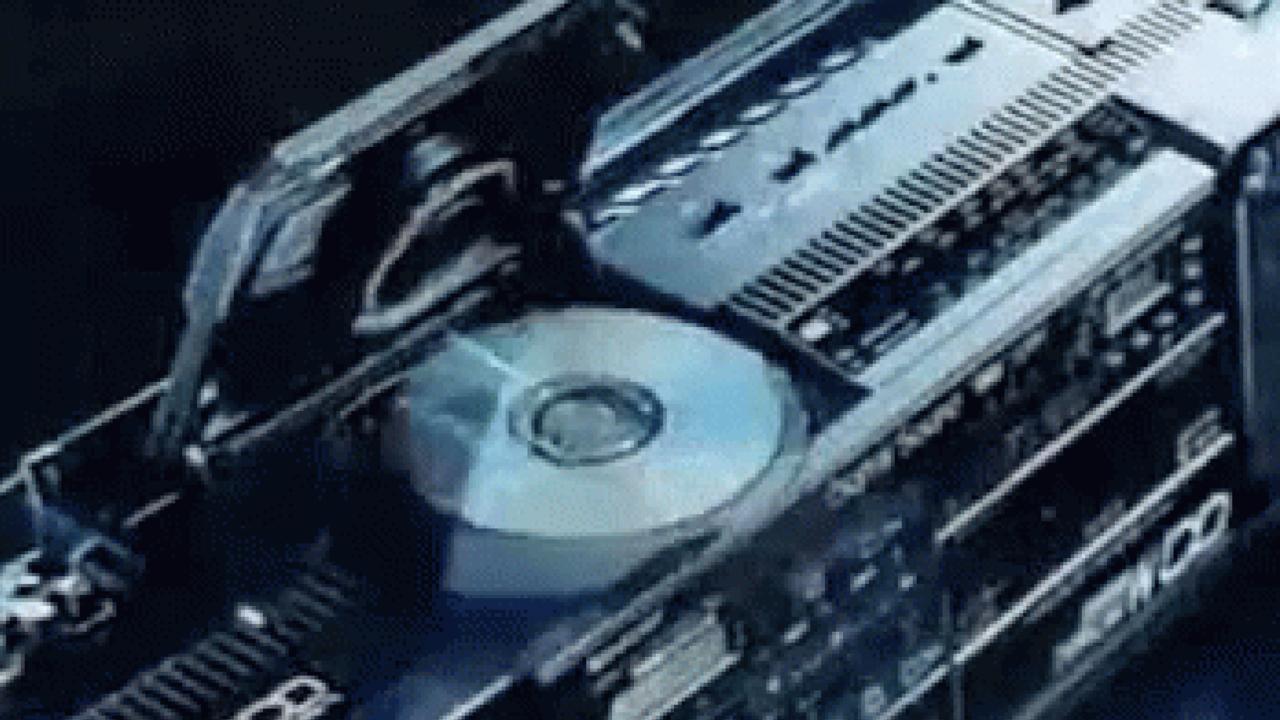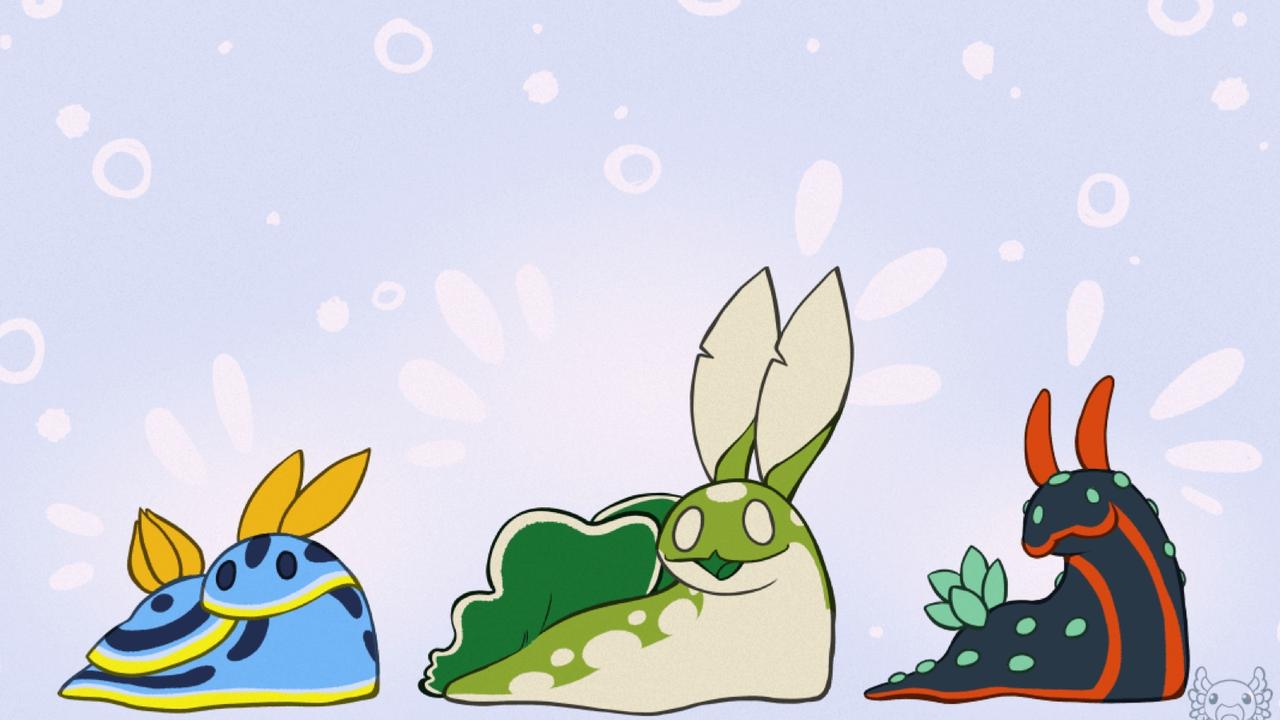Jóhann Jóhannsson – A User’s ManualChapter 8 – The Miners’ Hymns (2011) – Deutsch
14.2.2022 • Sounds – Gespräch: Kristoffer Cornils, Thaddeus Herrmann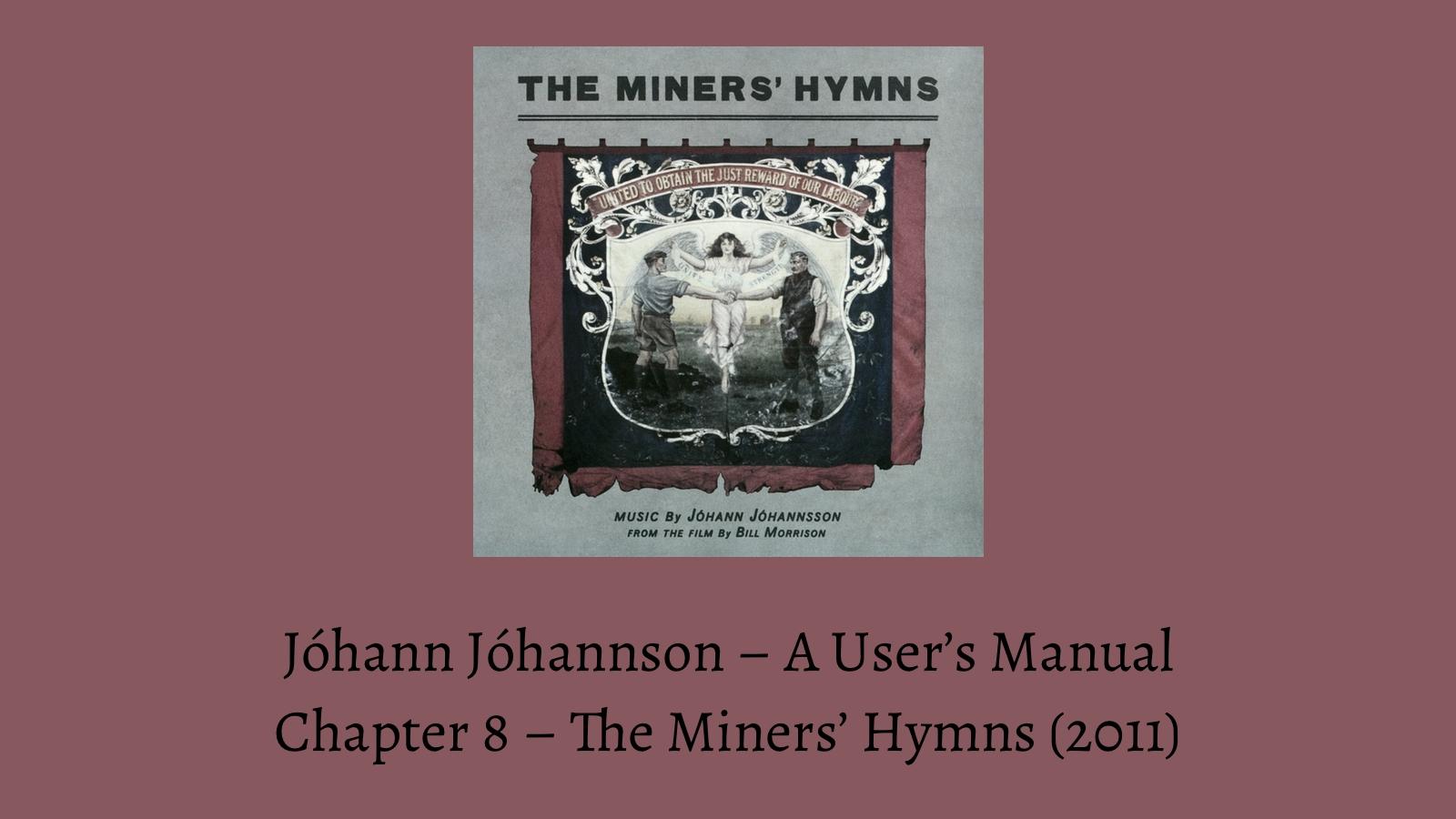
Weit über 20 Alben hat Jóhann Jóhannsson in seiner Karriere veröffentlicht. Wer weiß schon, wie viele Tondokumente noch in der Schublade liegen, die posthum noch veröffentlicht werden könnten. Einmal pro Monat – zumindest in der Theorie – lassen Kristoffer Cornils und Thaddeus Herrmann das Werk des Komponisten Revue passieren – chronologisch, Album für Album. In der achten Folge geht es um „The Miners’ Hymns“ aus dem Jahr 2011, den Soundtrack zum gleichnamigen Film von Bill Morrison.
English Version? Click here.
„The Miners’ Hymns“ ist ein Film ohne Worte, der mittels Bildern und Musik von der Geschichte des Kohleabbaus in Nordengland nacherzählt. Regisseur Morrison wandte dafür ganz ähnliche Techniken an, wie sie ihm etwas weniger als ein Jahrzehnt zuvor mit „Decasia“ zum Durchbruch verhalfen – Archivaufnahmen von Minenarbeiter:innen werden collagiert und damit neu kontextualisiert. Kein Kommentar verbindet die historischen Aufnahmen, das Narrativ wird allein über Juxtapositionen verschiedenen Bildmaterials – Szenen aus Arbeits- und Privatleben der Kumpels treffen auf Aufzeichnungen von Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Streikenden – aus den unterschiedlichsten Epochen konstruiert.
Doch entstand das Projekt in enger Zusammenarbeit mit Jóhann Jóhannsson und wurde nicht etwa bei einem Dokumentarfilmfestival, sondern im Jahr 2010 beim Durham International Brass Festival uraufgeführt – und zwar als Konzert mit Screening in der Kathedrale von Durham, die auch in einigen Szenen des Films zu sehen ist. Der regionale Kontext wird auch von der Instrumentalisierung aufgefangen: Neben einer Orgel, Schlagwerk und Elektronik wurden die sechs Stücke vor allem für 16 Blechblasinstrumente geschrieben, wie sie selbst Teil der kulturellen Traditionen um den Bergbau in Großbritannien sind. Als Soundtrack-Album bildet „The Miners’ Hymns“ Aufnahmen ab, die drei Monate nach den Uraufführungen am 15. und 16. Juli 2010 ebenfalls in der Kathedrale von Durham angefertigt wurden.
Film und Soundtrack wurden in den Folgejahren, insbesondere im Jahr 2014, dem 30. Jubiläum des unter Margaret Thatcher mit aller Härte niedergeschlagenen britischen Bergarbeiter:innenstreiks immer wieder live aufgeführt.
Kristoffer: Wir saßen lange nicht mehr gemeinsam an einem Tisch, um über Jóhann Jóhannsson zu reden. Seit letztem September, um genau zu sein. Das Leben kam uns beiden in die Quere oder wir kamen nicht zur selben Zeit am selben Ort zueinander. Kommt vor. Ein bisschen aber habe ich diesen Moment auch gefürchtet und ihn vielleicht absichtlich vor mir hergeschoben. Denn selbst über ein für mich so enorm wichtiges Album wie „Virðulegu Forsetar“ kann ich noch problemlos reden, ein monumentales Werk wie „Fordlandia“ analysiere ich mit Leichtigkeit zu Tode. Aber „The Miners’ Hymns“? Das wird schwierig.
Fangen wir mit den Fakten an: Es ist das erste Album Jóhann Jóhannssons, das ich wirklich bewusst wahrgenommen habe und stellte somit mein Einstiegstor in dessen Welt dar. Aufgesperrt könntest übrigens gar du höchstselbst es haben: Ich erinnere mich zumindest daran, von dem Album damals auch in der de:bug gelesen zu haben und deine Begeisterung sprang ja immer schnell auf mich über. Ich musste mir dazu meistens die Platten nicht einmal anhören! Bis heute ein toller Service.
Aber zurück zu „The Miners’ Hymns“ und vor allem „The Cause of Labour Is the Hope of the World“: Das ist Musik, die mir das Leben gerettet hat. Vielleicht nicht buchstäblich, allemal aber in einem … nein, Quatsch: jedem möglichen übertragenen Sinne. Und weißt du was? Diesen Film habe ich immer noch nicht gesehen, bis heute nicht. Ich will das unbedingt, brauche es allerdings auch nicht. Denn zwischen meinen Ohren laufen zu dieser Musik ganz andere Dinge ab. Nur welche genau, das lässt sich schwer bestimmen. Das vielleicht ist es ja doch aber, was dieses Album – so höre ich es, nicht als Soundtrack – für mich so allumfassend, so überlebensgroß, überlebensgroßartig macht: dass ich es überhaupt nicht greifen kann. Ein bisschen wie die Luft also, die ich Zug für Zug einatme. Jetzt wird’s pathetisch, klar. Aber ich kann ja nicht anders. Oder doch, aber dann muss ich noch weiter ausholen. Also sag’ du doch bitte mal endlich was, gerne was Konkretes. Dir gefällt das Ding auch ganz gut, oder?
Thaddi: Ich danke dir für das Intro! Und will versuchen, mich Schritt für Schritt an deine Position heranzurobben. „The Miners’ Hymns“ ist das Album von Jóhann, das ich so gut wie nie höre. Warum? Keine Ahnung. Denn immer wenn ich es dann höre, zieht mich die Musik in mein Inneres wie ein tödlicher Strudel im Bermuda-Dreieck. Mein Jóhannsson-Rettungsmoment ist dieses Album hingegen nicht. Zu meinem kommen wir später in dieser Reihe. Aber natürlich fasst mich das Thema an. Mit Großbritannien verbindet mich eine große Liebe; eine Liebe, die sich im Laufe der Jahre immer mehr gen Norden verschob. Wobei: Norden bedeutete für mich maximal Manchester, eine Stadt, die aber meiner Einschätzung nach gut in den Topos „Nordengland“ passt – auch wenn dort, soweit ich weiß, nie wirklich Kohle abgebaut wurde. Aber natürlich spielt die Stadt – oder der Metropol-Raum mit dem Manchester-Kapitalismus – eine entscheidende Rolle in der Transformation des Landes, die letztendlich auch den Kohleabbau beeinflusste und bedingte. Den Kampf der Bergarbeiter*innen gegen Thatcher holte ich erstmals mit einem ganz anderen Album auf meinen Radar – mit „Pax Britannica“ von Test Dept, Einer unmittelbaren Auseinandersetzung mit Thatchers Regime.
Als ich zum ersten Mal nach Manchester reiste, erlebte ich eine Stadt in Trümmern. Da war alles fertig. Und in Städten wie Newcastle oder Sunderland – an der Ostküste – mag es noch schlimmer ausgesehen haben. Der Verfall der Industrie, die einst Wohlstand und Prosperität versprach und auch lieferte, war vorbei, es regierte Hoffnungslosigkeit. Die Innenstädte wurden bald mit EU-Geldern neu aufgebaut, hübsch gemacht. Ich war mal ein Wochenende in Newcastle – das war fantastisch. Aber ich wohnte im Hilton und musste mir keinerlei Gedanken um irgendetwas machen – British Council sei Dank. Was ich sagen will: Ich verstehe die Disparität zwischen gewachsener Tradition – dem Bergbau –, dem notwendigen wirtschaftlichen Umbau und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Konsequenzen, die natürlich nicht konsequent angegangen wurden. Und in genau dieser Irritation, in der meine Sympathie natürlich bei den Bergarbeiter*innen liegt, frage ich mich: Nope, tut mir leid. Euer Job ist einfach von gestern. Ich kann das so neutral konstatieren. Der Trailer des Films „The Miners’ Hymns“ macht mich natürlich dennoch nachdenklich. Zumindest für einen kurzen Moment. Mir tut das alles leid und weh, eine andere Möglichkeit sehe ich aber nicht. Und dann kommt Jóhann mit seinem Album dazu. Auch ich habe den kompletten Film nie gesehen, aber der Trailer vermittelt ja einen guten Eindruck:
Aber nun mal zur Musik, oder?
Wenn ich an „The Miners’ Hymns“ denke, steht eher ein vages Gefühl oder ein buntes Assoziationsfeuerwerk im Raum.
Kristoffer: Uff, ja. Die wird vom Kontext natürlich fast erdrückt, aber sie steht selbst auf sehr festen Beinen. Ich habe eine Review gelesen, in der eine Rezensentin bemerkte, dass diese Musik ja so gar nichts mit den Blechbläserensembles zu tun habe, deren Tradition hier zumindest indirekt aufgenommen wird. Das fand ich interessant, weil ich selbst überhaupt gar nicht auf den Gedanken gekommen wäre, dass Jóhannsson hier etwas bewusst rekonstruieren wollte. Obwohl es andererseits natürlich recht deutliche Querverbindungen gibt, allemal natürlich durch die Instrumentierung. Sagen wir es so: Die Musik marschiert nicht, sie wogt auf und ab. Meistens sehr unmerklich. Tatsächlich fällt es mir schwer, sie mir wirklich zu merken: Abgesehen von „The Cause of Labour Is the Hope of the World“ kann ich keines dieser Stücke vor meinem inneren Ohr abrufen. Wenn ich an „The Miners’ Hymns“ denke, steht eher ein vages Gefühl oder ein buntes Assoziationsfeuerwerk im Raum. Ich traue mir aber immerhin zu, das Album in seiner Diskografie als eine Art Scharnier einzuordnen, als Relais, als Brücke zwischen den mächtigen, impressionistischen Drones von „Virðulegu Forsetar“ und den sehr konkreten, nicht minder mächtigen Drones seiner Soundtrack-Arbeiten wie „Sicario“ oder sogar „Arrival“.
Thaddi: Dass du dir die Musik nicht merken kannst, ist fast schon ein bisschen witzig, geehrter Herr Professor Dr. Dr. Drone! Aber: Den Bogen von der traditionellen Musik des Bergbau-Gewerks und Jóhannssons Interpretation hatte ich bislang auch nicht nicht geschlagen bzw. als entscheidend wahrgenommen. Doch bleiben wir einen Moment in diesem Bild und der daraus resultierenden Erwartungshaltung, dass es dem Komponisten darum hätte gehen können. Dann ist das Album wohl eher eine verrauschte Hallfahne der Geschichte. Aber ganz ehrlich: Nichts anderes hätte ich von Jóhannsson erwartet. Coverversionen sind seine Sache ja nicht.
Kristoffer: Stimmt natürlich, obwohl es in der Hinsicht schon interessant ist, wie er mit den plakativen Slogans der Labour-Bewegung arbeitet: „An Injury to One is the Concern of All“, „Industrial and Provident, We Unite to Assist Each Other“ – das sind doch mal wirklich Ansagen. Und dazwischen mischt sich christliche Rhetorik, „They Being Dead Yet Speaketh“ und so weiter. Das ergibt eine interessante Gemengelage im Kontext der Musik, die ja mit Ausnahme des letzten Stückes eben überhaupt nicht plakativ ist. Sondern nur merkwürdig durch die Schatten schwebt, wie ein großes dunkles Echo früherer Zeiten.
Vielleicht können wir diese Platte als unvermutetes Hauntology-Album einordnen, ich bin ja in erster Linie Professor der Gespensterkunde. Und vielleicht wird so auch in musikalischer Hinsicht ein Schuh draus: Jóhannsson wollte eben nicht Coverversionen abliefern, die die Vergangenheit neu in der Gegenwart manifestieren sollten. Sondern vielmehr das erfahrbar machen, was du auf deinen Reisen im Norden Englands gespürt hast – die Gespenster vergangener Epochen, verlorener Kämpfe. „They Being Dead Yet Speaketh Of Hope“. Denn die ist ja – ich liebe diese Mehrdeutigkeit! – der „Cause“ von „Labour“, also Ursache oder Grund und gleichermaßen zukunftsgerichtetes Anliegen der Labour-Partei oder eben aller Arbeit an sich. Das ist in semantischer Hinsicht wahnsinnig vielschichtig und gibt diesem Album dann vor allem zum Schluss noch einen eindrücklichen Drall. Du merkst: Ich will eigentlich nur über dieses eine Stück sprechen.
Thatcher machte platt, was platt zu machen war.
Thaddi: Das können wir auch gleich tun. Doch zunächst: Was du beschreibst, sehe ich ganz ähnlich. Nur leider wurde aus der Ausblick auf Hoffnung ja nie eingelöst. Im Gegenteil. Thatcher machte platt, was platt zu machen war. Es hätte mich in der Rückschau auch nicht gewundert, wenn sie für den Bau einer Mauer plädiert hätte und alles oberhalb von Birmingham zur autonomen Zone außerhalb ihrer Zuständigkeit erklärt hätte. Nur um den „armen“ Norden loszuwerden. Denn faktisch war die Lage im Norden ja schon damals genau so grim, wie John Lanchester sie in seinem Roman „The Wall“ unter ganz anderen Vorzeichen beschreibt. Ödes Land, ausgebeutete Gruben, Menschen mit Akzenten, die man in London nicht versteht. Das ewig dunkel Dräuende, das – bis auf das letzte Stück, wir sind gleich da – passt also musikalisch genau zu dem, was die Tory-Politik anrichtete. Fun fact: Erst Ende letzten Jahres wurde der letzte Schienenbus in Nordengland außer Dienst genommen, der wirklich nur ein auf ein Fahrgestell montierter Omnibus war. Das hätte man sich im Süden des Landes nie erlauben können. Dürfen. Das Gefälle zwischen dem Norden und dem Süden ist noch heute spürbar.
Kristoffer: Total. Aber ich kann nicht anders, als darin – oder besser gesagt: in der künstlerischen Aufarbeitung des Ganzen – ein tagesaktuelles und wegweisendes Potenzial zu sehen. Denn natürlich befassen sich Musik und Film dezidiert mit dem Vergangenen und du hast auch ganz richtig gesagt, dass Bergbau an sich nun wirklich nicht mehr der Status quo sein sollte. Ich habe ja auch mal sehr viel Wut auf mich gezogen, als ich in einem Text zu der Serie „Chernobyl“ – warum ist Hildur Guðnadóttir auf diesem Album eigentlich nicht dabei? Egal! – darauf hinwies, dass es in seiner Symbolik schon etwas zynisch sei, dass ausgerechnet die Kohlekumpel als die Retter daher eilen. Nostalgie dafür ist also auch hier fehl am Platz. Aber ich schweife ab.
Oder auch nicht. Denn ich verweise auf den Hauntology-Diskurs bzw. generell Hantologie, weil die heraufbeschworenen Gespenster der Vergangenheit ja eben nicht etwa bloße Abziehbilder vergangener Zeiten sind oder sein sollen. Sondern wie ein anderes Gespenst, Geburtsjahr 1848, ausgehend von vergangenem Scheitern und uneingelösten Versprechen neue Weichen für die Zukunft stellen sollen. Erinnern wir uns doch auch an die politische Situation in Großbritannien und der Welt, als „The Miners’ Hymns“ veröffentlicht wurde: die London Riots! Occupy („We Are the 99%“ wäre auch ein möglicher Titel für eines dieser Stücke gewesen) ging durch die Welt, der arabische Frühling – dieses, jenes. Und das drei Jahre nach einer großen globalen Finanzkrise, die ohne Thatcherismus so nie möglich gewesen wäre.
Das Album erinnert mich an zurückliegende gemeinsame Bestrebungen und ergo hochaktuelle Momente der Solidarität.
Der große Umbruch kam damit zwar leider nicht, aber immerhin erinnerte dieses Album so in einem extrem spannenden Kontext an zurückliegende gemeinsame Bestrebungen und ergo hochaktuelle Momente der Solidarität. Der Bergarbeiterinnenstreik von 1984 ist ja unter anderem deshalb extrem spannend, weil sich ihm sehr viele unterschiedliche Gruppen angeschlossen haben – die LGBTQI-Bewegung etwa. Da kam es ausgehend von einer simplen Einsicht („An Injury to One is the Concern of All“) zu Bündnissen zwischen Gruppen, die vor allem für soziale Anerkennung kämpften, und der klassischen Arbeiter*innenbewegung. Das als Film mit der passenden Musik dazu erfahrbar zu machen, während in London die Leute erneut auf die Straße gingen, um gegen Neoliberalismus und Austerität zu protestieren oder zumindest ihrem Frust freien Lauf zu lassen – das hat doch was, oder?
Thaddi: Das ist ein großer Bogen, der selbst Number 10 zum Einsturz bringen dürfte. Sehr gut gelöst – und damit nochmals aktueller als die Riots von 2011. Auch wenn ich die Solidarität unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen von damals nicht überbewerten würde, selbst wenn sich das richtig gut anfühlt. Um ein richtiges Klischee auszupacken: Ich glaube nicht, dass sich Vorarbeiter Pete mit der versteckt queeren Marcy im Pub „The Drunken Duck“ spontan angefreundet hätte. Ist aber auch egal. Wenn mich die vergangenen zwei Jahre etwas gelehrt haben, dann dass ich bis an mein Lebensende Utopien besser finde als Dystopien. Aber nun bin ich es, der abschweift.
Kristoffer: Das ist in erster Linie ein ordentlicher Klumpen von nur lose sortierten Gedanken, den ich gerade auf dich loslasse! Aber das sind genau die Art von Assoziationen, die dieses Album in seinem Verlauf in mir auslöst. Ich glaube ja überhaupt nicht an das inhärent politische Potenzial von irgendwelcher Form von (Pop-)Musik, aber sie reflektiert und kommentiert natürlich bestimmte historische oder zeitgenössische Prozesse. Und „The Miners’ Hymns“ gelingt – vielleicht nicht hundertprozentig gewollt, Jóhannsson war ja doch kein Hellseher – es durchaus, beides in ein einziges Werk zu integrieren. Darin nämlich wird die Vergangenheit auf höchst aktuelle Weise aufgearbeitet, auch wenn es dazu nur sehr grobkörnige Filmaufnahmen zu sehen gibt. Er tat das allerdings, ohne wirklich mit der Slogankeule zu hantieren, denn mit Ausnahme der Tracktitel gibt es nichts Plakativ-Politisches an dieser Platte. Sie steht in Verbindung mit dem Film sehr für sich und ist gleichzeitig in Richtung Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin offen. Und vielleicht macht es das für mich so schwer, sie zu greifen, weil ich sie dementsprechend immer wieder anders hören kann. Für dich ist das aber schon eher ein Düster-Soundtrack, oder wie?
Thaddi: Nein, überhaupt nicht. Allerdings haben den generationsübergreifenden Geschichtsrahmen ja nun bereits aufgezogen. In diesem Sinne bin ich jetzt und hier eher bestürzt über meine neue Interpretation des Albums, das sich durch eine eisige Kälte aufzeichnet, gerade wenn ich die unterschiedlichsten Bilder assoziiere. Das macht mir ein wenig Angst. Es fühlt sich an, als hätte das Böse für immer gesiegt. Das stimmt natürlich generell, ich möchte in diesen Stollen aber im Moment nicht einfahren, um ehrlich zu sein. Das Album ist für mich ein dunkles Ungetüm, das über ein Land oder einen Planeten rollt, wo nichts mehr gilt.
Kristoffer: Das ist natürlich eine Steilvorlage: Wie kannst du bitte den letzten Track hören und danach nicht denken, dass schon noch alles gut wird? Das geht ja selbst mir so. Mir!
Thaddi: Dann hören wir den jetzt endlich. Moment. Du hast natürlich vollkommen recht. Das ist aber ein Kniff, den Jóhannsson gut beherrscht. Bei „And in the Endless Pause there Came the Sound of Bees“ ist es ja letztendlich nichts anderes, nur dass das Dunkle in der Mitte der Komposition geparkt wird.
Kristoffer: Ja, hier aber kommt das große, lichte Finale. Das ist ein narrativer Taschenspielertrick sondergleichen, aber er funktioniert schon irre gut. Das ganze Album wird von einer Getragenheit, nahezu einer Lethargie dominiert, die zum Ende hin jedoch in triumphalen Gesten ganz wunderbar aufgelöst wird. Wobei Auflösung vielleicht das falsche Wort ist: Eigentlich wiederholt sich ja auch nur ständig alles als Crescendo und ebbt dann wieder ab. Das spricht gleichzeitig vom Scheitern und der Schönheit von Umsturzversuchen, wie es die Notwendigkeit unterstreicht, sie immer und wieder anzugehen. Und klar: So ein wirkliches happy ending gibt es dementsprechend selbst mit diesem Stück nicht. Aber einen Ausblick, eine Möglichkeit, Zukunft. Und daran werde ich mich noch mein ganzes Leben lang klammern können.