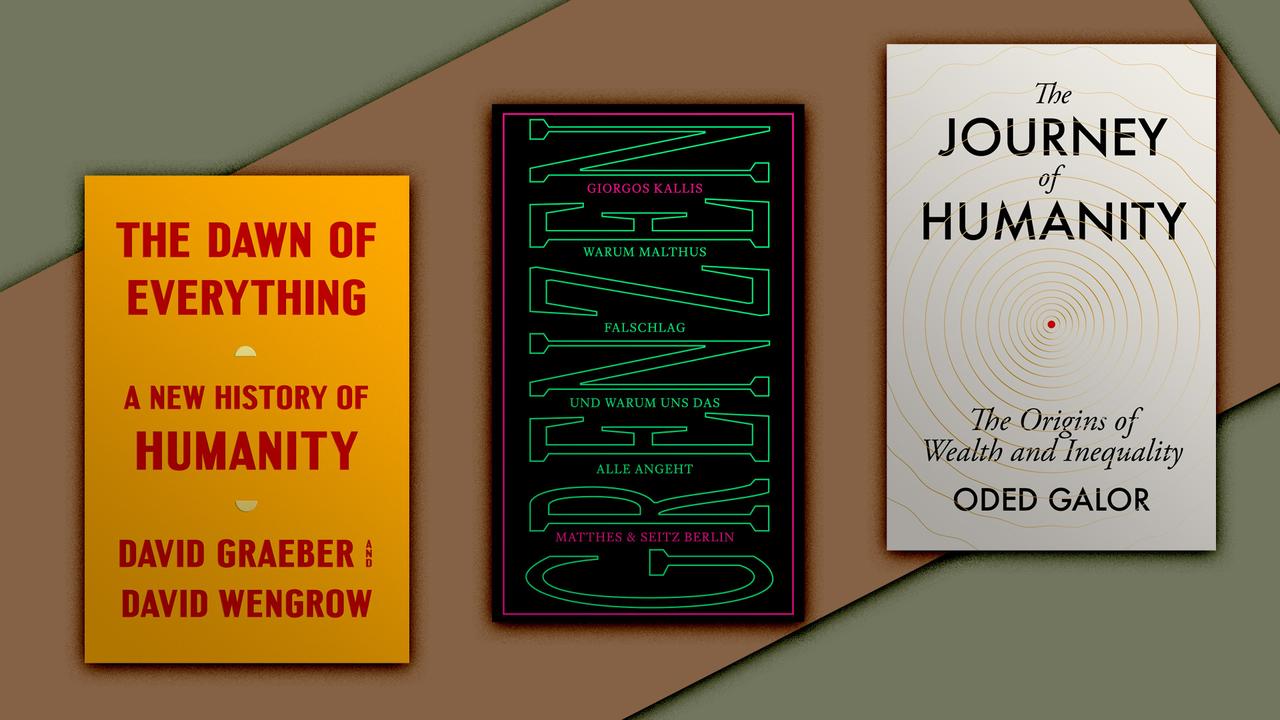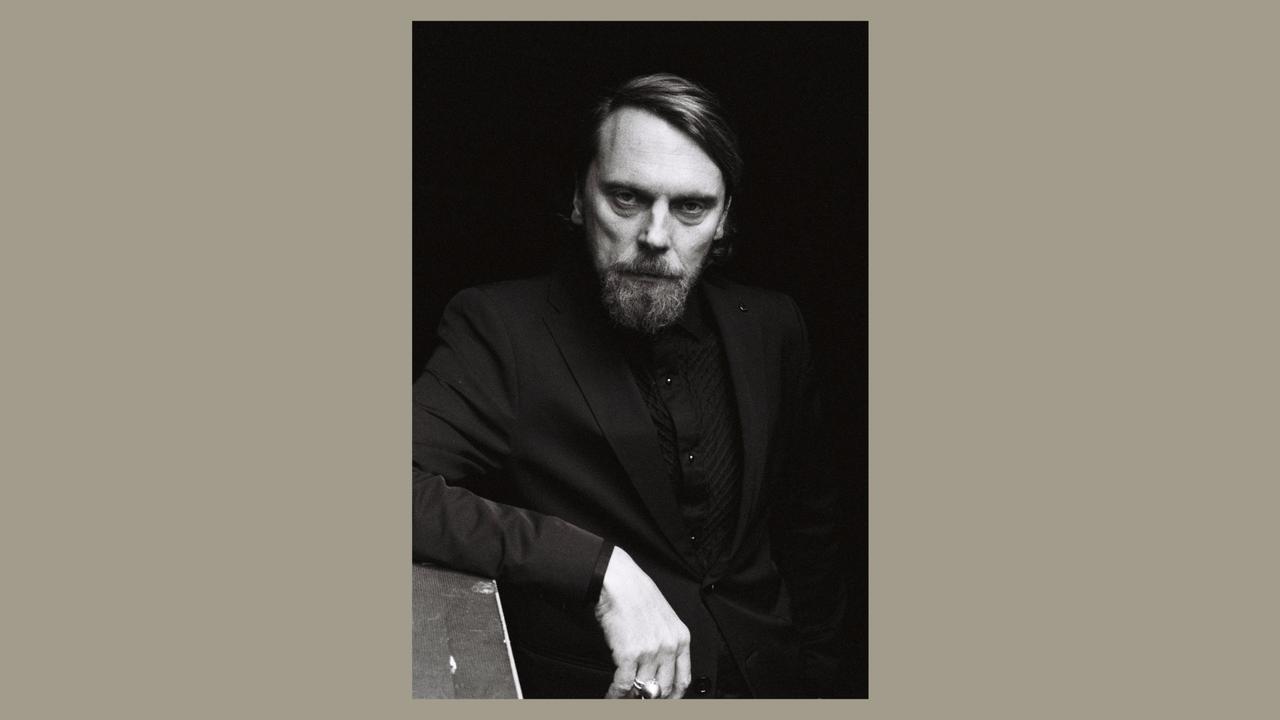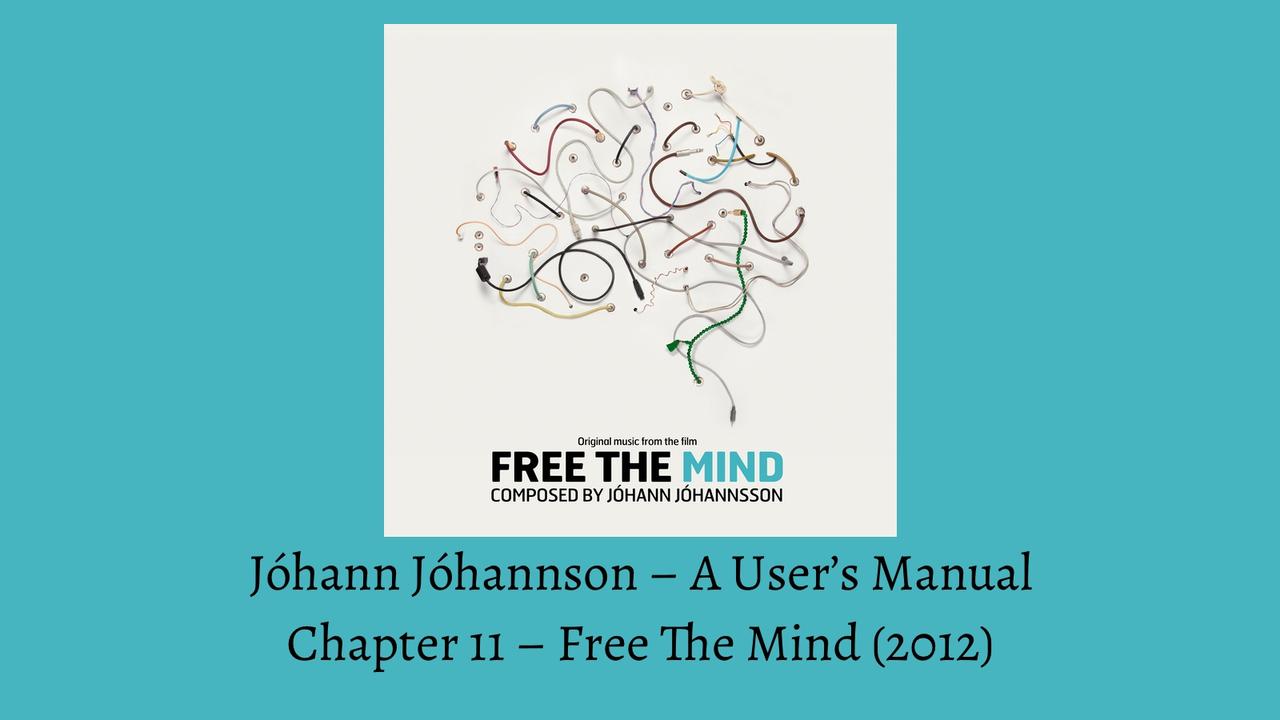„Sound ist immer auch politisch“Emeka Ogboh im Interview
12.9.2022 • Kultur – Interview: Thaddeus Herrmann
Foto: Selbstporträt des Künstlers
Zwischen Field Recordings, Craft Beer, DJ-Sets, Musiker-Dasein und interdisziplinärer Kunst: Emeka Ogboh fühlt sich in zahlreichen kreativen Habitats zu Hause. Mit seinem aktuellen Album „6°30ʹ33.372ʺN 3°22ʹ0.66ʺE“ definiert der Nigerianer das Potenzial des Field Recordings neu. Ein Gespräch über den ÖPNV in Lagos, die Schönheit im Chaos, kulturelle Aneignung und den Umgang mit dem Politischen in der Musik.
Emeka Ogboh ist ein stiller Botschafter für eine bessere Welt. Für eine Welt des Miteinanders, des Zuhörens, der kulturellen Neugier. Der nigerianische Künstler legt sich dabei nicht auf eine Kunstform fest: In seinen zahlreichen Arbeiten pendelt er zwischen Installation, Intervention, Musik, Sound, Architektur und Grafik. Er verbindet unterschiedliche Aspekte miteinander und schafft so Räume, Momente und Erinnerungen, die uns auf immer wieder unerwartete Weise vor Augen führen, wie wichtig die Besinnung auf das Gemeinsame in unserer zerklüfteten Weltgesellschaft ist. Laut, provokativ und rechthaberisch ist er in seiner Arbeit nicht, im Gegenteil. Statt gut gebrülltem Messaging mit ihm als Absender verwebt Ogboh subtil und multidimensional zahlreiche Gewerke des Kunstgeschehens. So bieten seine Arbeiten zahlreiche Möglichkeiten der persönlichen Annäherung. Ogboh will alle Sinne ansprechen – und braut, wenn es sein muss, für ein Projekt sein eigenes Bier und macht traditionelle Gerichte seiner Heimat zum wichtigen Teil seiner Installationen. Oberflächlich bieten seine Arbeiten wenig Reibungsfläche. Das ist bewusst so angelegt. Denn bei genauerem Hinschauen, Hinhören und Hinschmecken entwickelt sich wie von selbst ein tiefes Verständnis für seinen Ansatz und die dahinter schlummernde Motivation. Ob mit einer Installation an einem abseitig gelegenen Gate auf Berlins ehemaligen Flughafen TXL, im Berliner Gropius-Bau, auf der Documenta oder Biennalen in Venedig oder Dubai.
Im Sommer 2022 veröffentlichte Ogboh sein zweites Album, „6°30ʹ33.372ʺN 3°22ʹ0.66ʺE“. Die Basis bilden Field Recordings aus Lagos, aus dem urbanen Leben der afrikanischen Metropole. Als Musiker macht er sich schon seit einigen Jahren mehr und mehr unabhängig, produziert mittlerweile selbst und hat mit „Danfotronics“ sogar sein eigenes Label gegründet. Die vielschichtigen Aufnahmen hat er mit Beats und Sound verwoben, die der Kultur der elektronischen Musik seiner Wahlheimat Berlin eine vollkommen neue Facette hinzufügen. Damit ist das Thema für Thaddeus Herrmann gesetzt.
Woran arbeitest du gerade?
Eigentlich wollte ich mir 2022 eine Auszeit nehmen. Aber natürlich funktioniert das nicht wirklich. Faktisch bin ich aktuell damit beschäftigt, mein Label Danfotronics auf feste Beine zu stellen. Ich habe schnell gemerkt, dass ich das nicht einfach nebenher laufen lassen kann. Dabei habe ich überhaupt keinen festen Release-Plan, und es soll eh mehr auf dem Label passieren als Musik und Tonträger. Nun wühle ich mich durch die Bürokratie.
Du fügst deiner ohnehin schon facettenreichen Arbeit einen ganz neuen Aspekt hinzu.
Ganz genau.
Das passt sehr gut zu einem kleinen gedanklichen Experiment, das ich mit dir durchspielen möchte. Vor dir liegt eine Visitenkarte. Es steht nur dein Name darauf, Emeka Ogboh. Was würdest du ergänzen? Welche Berufsbezeichnung, welchen Titel? Mit anderen Worten: Wie beschreibst du das, was du tust, am treffendsten?
Hmmm, ich bezeichne mich immer noch als Artist. Aber vielleicht wäre das für die Visitenkarte schon zu viel. Wahrscheinlich würde ich einfach nur meine Nummer und E-Mail hinzufügen. Ehrlich gesagt: Ich weiß ja nicht, worum es bei einem kommenden Projekt gehen könnte und wie ich mich involviere. Es war nie mein Plan, mich mit meiner Arbeit so breit aufzustellen, aber es hat sich nunmal so entwickelt. Also: Nummer und E-Mail.
Ruf mich an, dann sehen wir weiter ...
Klar, warum nicht? Meine Arbeit beinhaltet immer unterschiedliche Aspekte, Medien und Kunstformen. Das ist auch der Grund, warum ich das Label größer bzw. anders denken möchte und nicht als traditionelle Plattenfirma mit den immer gleichen Abläufen: Künstler:innen finden, aufnehmen, Promo machen, veröffentlichen, verkaufen. Ich will das Rad nicht neu erfinden. Aber vielleicht gelingt es mir, dass das Rad besser in unsere Zeit passt.
Ideen hast du doch bestimmt schon. Jenseits des klassischen Formats, mit dem du begonnen hast: einer Doppel-LP.
Ich halte es tatsächlich für die beste Idee, genau so zu starten. Aber das ist nur der Anfang. Es wird auch auf die Menschen ankommen, mit denen ich auf Danfotronics arbeiten möchte. Sie dort abzuholen, wo sie in diesem Moment mit ihre Kreativität stehen. Das ist ein organischer Prozess, den ich selber ja auch so lebe.
Sprechen wir über deinen eigenen kreativen Prozess. An welchem Punkt stehst du gerade – und wie bist du dort angekommen?
Meine Arbeiten hatten immer, oder zumindest meistens, mit Musik zu tun. Was nicht bedeutet, dass ich mich von Anfang an als Musiker verstanden habe. Ich habe viele Jahre regelmäßig mit Musiker:innen zusammengearbeitet, die versuchten, meine Ideen umsetzen, zu adaptieren, Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt keine Blaupause für das, was ich tue. Und oft sind meine Ideen so abstrakt, dass es mir sehr schwer fällt, sie zu erklären. So eine Kollaboration geht also immer hin und her. Und kann für beide Seiten sehr frustrierend sein. Ich entschied mich dazu, mir die Produktion von Musik selber anzueignen. Ich war in meiner Laufbahn immer wieder an diesem Punkt: Um Dinge wirklich so umsetzten zu können, wie ich sie fühle, muss ich die entsprechenden Techniken lernen. Das erste Album, das ich selbst produziert habe, war „Beyond The Yellow Haze“, das ich zunächst auch selbst auf Vinyl veröffentlichte. Die Version auf A-Ton, also Ostgut Ton, ist ja ein Re-Release. Das Album war mein erster Versuch, die Soundscapes aus Lagos mit elektronischer Musik zusammenzubringen. Und schon damals hatte ich den Namen „Danfotronics“ für ein Label im Kopf. Mit der neuen Platte „6°30ʹ33.372ʺN 3°22ʹ0.66ʺE“ hatte ich zwei Möglichkeiten: auf Ostgut Ton zu warten oder es selbst zu versuchen und „Danfotronics“ wirklich zu starten.
Mich interessiert, wie du dich einem neuen Projekt annäherst. Auf dem Weg heute früh habe ich in der S-Bahn immer wieder stumm auf mich eingeredet und mir den Begriff „Multimedia“ verboten. Hat nicht geklappt. Deine Arbeiten beziehen aber schlicht zu viele Formen und Medien mit ein. Wie funktioniert so ein Entscheidungsprozess?
Ich habe Grafikdesign studiert und viele Jahre Webdesign gemacht. Das war mein Job, in diesem Metier kannte ich mich aus. Klang im Netz wurde immer wichtiger, also begann ich, die Sound-Komponente unterbewusst mitzudenken. Mein erster Berührungspunkt mit Musik auf beruflicher Ebene. Das war wie eine Befreiung, ich entdeckte neue kreative Möglichkeiten und Ausdrucksformen. Um deine Frage zu beantworten: Das Wichtigste für mich ist, vor Ort zu sein. Das ist immer der erste Schritt, wenn ich in einem Raum etwas tun, ihn bespielen soll. Hinfahren. Ich muss Ort und Raum auf mich wirken lassen, dort Zeit verbringen. Nur so entsteht Inspiration. Nur so kann ich eine Beziehung aufbauen. Das gilt auch für meine Musik: Ja, ich arbeite vornehmlich mit Field Recordings aus Nigeria, besonders aus Lagos. Mein Archiv ist voll. Das ist zunächst nur Material. Der kreative Prozess beginnt im Studio, beim genauen Durchhören der Aufnahmen. Ich bin immer auf der Suche nach dem einen Detail als Ausgangspunkt für einen Track – oder ein ganzes Projekt. Bei der Musik im Speziellen bedeutet das, Loops immer und immer wieder zu hören. Die Beats und der Rest entstehen dann irgendwann wie automatisch, ergeben sich einfach.
Field Recordings haben eine lange Tradition. Als Form der Dokumentation, als technische Herausforderung, die Umwelt abzubilden, die so noch nie abgebildet wurde, oder als eine Art klanglicher Grundierung für eigene Musik, also als entweder bunte, monochrome oder irgendwie dazwischen entstehende Sound-Tapete, die im besten Fall interessant und bereichernd ist. Ich empfinde deine Herangehensweise als im besten Sinne unentschieden, also als irgendwo dazwischen. Was fasziniert dich an Field Recordings?
Ich führe mein Interesse schon darauf zurück, dass ich viel Zeit in Lagos verbracht habe. Wäre ich in Berlin geboren worden ... ich weiß nicht, ob es ähnlich verlaufen wäre. Ich sage nicht, dass Berlin nicht klingt ...

Foto: Marco Krüger
Oha, interessant!
Tja! Natürlich ist Berlin nicht still. Und wahrscheinlich würde ich dir auch etwas anderes sagen, wenn ich tatsächlich mein ganzes Leben hier verbracht hätte. Lagos ist so divers. Du bist ständig mit Gerüchen konfrontiert, mit visuellen Eindrücken und eben auch Sound. Klang ist in Lagos enorm wichtig, um sich zurechtzufinden, von A nach B zu gelangen. Hier in Berlin ist an allen Bussen das Fahrziel ganz eindeutig ausgezeichnet. Man sieht auf den Displays die kommenden Haltestellen. In Lagos funktioniert das anders. So ein Info-Design existiert dort nicht. Die Fahrer:innen reden also die ganze Zeit. Ziel und Route werden immer und immer wieder ausgerufen – ein ganz besonderes Storytelling. Ein anderes Beispiel: Natürlich wird in Berlin auch viel im Straßenverkehr gehupt, auch wenn es faktisch ja verboten ist. In Nigeria ist das nicht so, selbst die Hupen bilden den Alltag also klanglich ab. Du hörst, was abgeht. Es ist dort immer Geräusch – eine Orientierungshilfe. Selbstständige Handwerker:innen und Dienstleister:innen sind auf der Straße unterwegs. Wenn ich also meine Schuhe ausbessern lassen möchte, muss ich gar nicht aktiv suchen. Ich mache nur die Ohren auf, höre raus und weiß, wenn jemand vorbeikommt und genau diesen Service anbietet. All diese Informationen, die alltägliche Kommunikation, sind Teil meiner Aufnahmen. Man muss ganz genau hinhören im Nachhinein, auf Details achten. So findest du neue Ausgangspunkte für Tracks. Für mich ist jede Stadt ein Komponist. Du musst nur die Ohren trainieren.
Seit ich in Berlin lebe, habe ich praktisch keine Field Recordings mehr gemacht. Verglichen mit Lagos ist der Sound der Stadt eindimensional. Ja, es gibt Verkehr. Ja, es gibt Krach. Vielleicht Kirchenglocken. Diese Veränderung im Alltäglichen hat etwas mit mir gemacht. Konkret habe ich mich noch intensiver mit meinem Archivmaterial beschäftigt und auch mehr Zeit für das Kompositorische investiert, die Zusammenarbeit mit anderen Musiker:innen etc.
„Musik hat eine größere Kraft.“
Hilft dir das, den Klang deiner nigerianischen Heimat einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen zu können?
Ja, durch die Musik beziehungsweise das Musikalische. Früher habe ich für meine Installationen und Arbeiten die Field Recordings praktisch nicht bearbeitet und sie stattdessen mehr oder weniger 1:1 eingesetzt. Roh. Für mich war auch das Musik, aus heutiger Sicht aber weniger musikalisch. Auch vor meinem Umzug nach Berlin habe ich elektronische Musik gehört, die stete Konfrontation damit jedoch in Berlin hat meine Perspektive verändert. Für mich ist das eine neue Perspektive.
Es gibt die „dunkle Seite“ der Field Recordings. Ich nenne das „koloniales Sampling“. Musiker:innen eignen sich Klänge an, die in keinem Zusammenhang mit ihrer eigenen Vergangenheit stehen und im besten Fall eine Art Exotismus sind. Die Rechtfertigung dafür läuft in der Regel über das Wischiwaschi-Argument, dass Techno und Co. ja ohnehin auf afrikanischer Musik und der rhythmischen Struktur basieren. Ich finde das billig bis nicht hinnehmbar.
Ich bin diesbezüglich tatsächlich offen. Natürlich kannst du das als Aneignung interpretieren, mit geht es aber eher um die Message, die in der Musik mitschwingt, sie vielleicht sogar bestimmt. In diesem Fall macht es für mich faktisch keinen Unterschied, ob Producer:in XYZ selbst schon in Afrika war oder nicht. Oder eine andere Beziehung zum Entstehungsort dieser Sounds hat. Wenn die Klänge des afrikanischen Kontinents wirklich nur Verwendung finden, um „anders“ zu klingen, dann ist das problematisch. Wer Beats etc. aber einfach mag – warum denn nicht? Ich mache ja auch nichts anderes. Musik ist Musik. Ein Beispiel: Als Kids in Nigeria ging es uns ja nicht anders. Wir sprachen Pidgin-English – und ich erwarte nicht, dass andere Menschen dazu eine Beziehung aufbauen. Und wir hörten Weihnachtslieder – über Schnee und die ganzen anderen Dinge. Wir fanden die Musik super, auch wenn uns die Texte rein gar nichts sagten. „Jingle Bells“? Wir hatten keine Ahnung von Weihnachten und Glocken. Aber die Musik hat uns damals bewegt. Schnee? Haben wir nicht in Nigeria. Das funktioniert in beide Richtungen. Der Nigerianer Burna Boy singt in Pidgin English – und die Kids in Finnland flippen aus, singen seine Tracks nach, nur basierend auf dem Klang seiner Stimme. Es geht nicht immer vornehmlich darum, was gesungen wird. Um die Themen. Musik hat eine größere Kraft.
Musik bringt uns zusammen.
Natürlich! Das gilt. Frequenzen, Melodien ...
Ich denke immer noch über den Moment nach, an dem du nach Berlin kamst und das Mikrofon erstmal hingelegt hast ...
Natürlich ist Berlin voller Sound!
Ja, das weiß ich nur zu gut. Field Recordings werden oft aber auch als extrem arty wahrgenommen. Eine Tatsache, die du auch einfach hättest mitnehmen können.
Ich weiß das. Aber mir fehlt das Interesse an diesem Ansatz. Bislang hat Berlin noch nicht zu mir gesprochen, wenn es um Aufnahmen geht. Ich warte einfach, was zukünftig passieren wird.
„Die Perspektive ist doch viel entscheidender, die Interpretation dessen, was man hört.“
Das Dokumentarische von Field Recordings impliziert auch eine politische Komponente.
Selbstverständlich. Sound ist immer auch politisch. Ich suche nicht bewusst danach in meinen Aufnahmen oder reduziere sie darauf. Ich habe in der Vergangenheit jedoch einige Projekte gemacht, bei denen die Geschichte meines Landes im Mittelpunkt stand. Ich habe Archive besucht und alte Reden gehört, die 1960 auf dem Tafawa Balewa Square zur Unabhängigkeit Nigerias gehalten wurden. Ich durfte diese Aufnahmen schließlich nicht verwenden, weil sie als zu politisch angesehen wurden. Aber das Politische muss sich ja gar nicht so explizit darstellen wie in einer Rede. Die Perspektive ist doch viel entscheidender, die Interpretation dessen, was man hört. So wie die Busfahrer:innen. Warum rufen sie denn die Stationen noch aus? Warum gibt es die Displays in den Bussen nicht? Was sagt das über die politische Realität in Nigeria in 2022 aus, über den technischen Fortschritt? Für mich als Musiker ist es ein sehr wichtiger Aspekt, den Hörer:innen diesen Raum zu lassen. Ich bin nicht derjenige, der sagt: Hierum geht es.