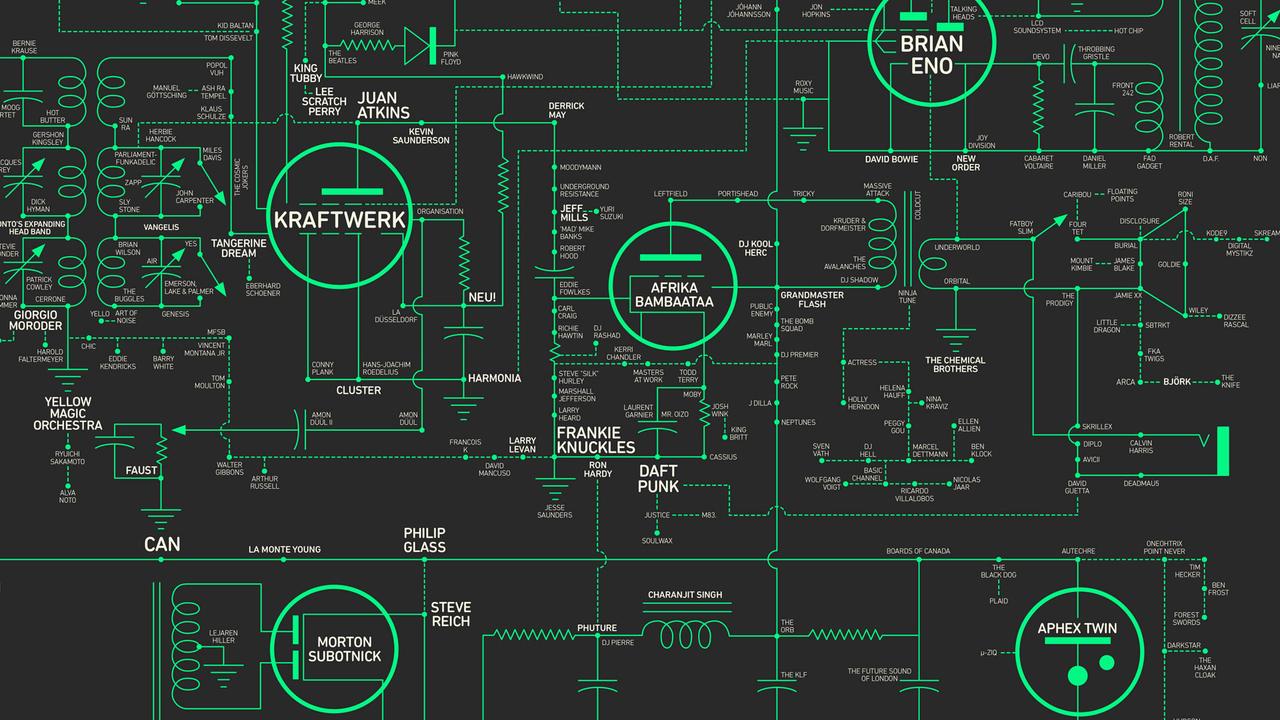„Was in Neuköllner Hinterhöfen passiert, hat oft Weltniveau!“Über digitale Konzerte und die Zukunft von Livemusik – Interview mit Beat Halberschmidt
19.3.2021 • Sounds – Text: Ji-Hun Kim
Foto: Glenda Moor
Der Berliner Musiker, Komponist und Medienmacher Beat Halberschmidt ist seit vielen Jahren ein wichtiger Umtriebiger in der hiesigen Kreativszene. Einige kennen ihn als Bassist bei Marteria, wenn er Stadien und Festivalbühnen abreißt oder auch als Gründer der Event-Plattform Ask Helmut, die vor einiger Zeit aber verkauft wurde. Seit einiger Zeit ist Beats neues Steckenpferd, die Online-Konzert-Plattform berta.berlin. Über 120 Konzerte hat er mit seinem Team im letzten Jahr aufgenommen und produziert. Für viele Artists waren das die einzigen Konzerte überhaupt. Ji-Hun Kim sprach mit Halberschmidt über die Hintergründe des Projekts, über Missverständnisse von digitalisierten Live-Events und was die wesentlichen Learnings aus der Zeit sind.
Was ist berta.berlin genau? Wie ist es dazu gekommen?
Es ist ähnlich wie mit meinem vorigen Projekt Ask Helmut. Ich fand es schon immer schwierig, „mal eben das Projekt vorzustellen“. Ich versuche vielmehr Sachen zu verbinden, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas fehlt. Berta Berlin verbindet verschiedene Aspekte. Zum einen möchte ich etwas aufbauen, das wie ein Archiv, ein Museum funktioniert. Wir produzieren und sammeln aber auch Inhalte. In diesem Fall sind das digitale Mitschnitte von Live-Performances, meist Konzerte. Da schaffen wir gewisse Standards, kuratieren. Ästhetik und Format sind uns wichtig. Wir möchten abbilden, was an innovativen Strömungen in der internationalen Berliner Musikszene stattfindet. Auf der anderen Seite kann das aber auch eine Art „Getty Images“ für Konzert-Content sein: Medien oder Veranstalter können hier interessanten Content finden, bei dem die Rechte bereits geklärt sind und so relativ schlank eine Lizenzierung von Live-Inhalten bekommen, die zum allergrößten Teil den Artists zugute kommt. Das ist aber vor allem strukturelle Arbeit, die im Hintergrund stattfindet. Generell haben wir bislang viel selbst produziert. Das wollen wir gar nicht per se. Wir möchten auch Produktionen von anderen Teams auf der Plattform mit aufnehmen und so ein großes Angebot schaffen.
Wer kuratiert die Artists und wie läuft das ab?
Wir sind ein Zweipersonen-Team. Das sind Jean-Paul Mendelsohn und ich. Im Falle der Serie, die wir im Gretchen machen, entscheidet Lars, der Booker vom Gretchen, mit. Kuration ist kein Buch mit sieben Siegeln. Wir hören uns Sachen an – und dann gefällt es uns hoffentlich unter dem einen oder anderen Aspekt.
Ich habe von vielen Artists bei euch zum ersten Mal überhaupt gehört. Das ist alles alles eher unclubbig – und unterscheidet sich von Boiler Room oder anderen Club-Livestreams, die es ja auch reichlich gab.
Die haben alle ihre Berechtigung und sind auch wichtig. Es gibt viele tolle Formate. Boiler Room ist elektronischer, obwohl da auch Live-Performances vorkommen. Der Fokus liegt dort aber immer auf DJ-Sets. Und davon braucht es auch nicht noch mehr. Aber eine Performance mit echten Instrumenten ist auch gefilmt nachvollziehbarer – man hört ja was passiert. Auch hier gibt es natürlich tolle Formate. Berlin Sessions, das ist aufwendig gefilmt, bewegt sich hauptsächlich im Indie- und Pop-Bereich. Unsere Inspiration waren KEXP und Tiny Desk. Hier sind die meisten Artists aus Übersee und ganz selten finden dort europäische Künstler statt – es sei denn, sie sind sehr bekannt. Uns war noch wichtiger, dass es junge Projekte sind, also solche, die sich vielleicht noch ausprobieren. So dringt man tiefer in die Szene und in die Nische vor, findet viele spannende Sachen, auch wenn die Acts in kleineren Locations spielen, wodurch man aber auch näher dran ist. Ein Geschenk, wenn man in Berlin lebt, und dass im Wedding oder Neukölln in irgendeinem Hinterhof solch eine Musik passiert. Das hat oft Weltklasse-Niveau.
In Berlin gibt es eine ausgesprochen frische, agile und – wie du schon gesagt hast – internationale Jazz-Szene. Gleichzeitig steht Berlin dank der starken Lobby sehr für Techno und Clubs. Aber nach dem Jahr 2020 kann man sich durchaus fragen, wieviel Techno die Stadt noch braucht und verträgt, und wie das in Zukunft überhaupt aussehen soll. Ich sehe schon einen Trend hin zur „handgemachten“ Musik. Sie ist in der Regel greifbarer, ich merke das auch bei mir selbst, wie ich öfter zur Gitarre oder zum Klavier greife als zum Ableton-Beat. Wie würdest du diese Berliner Szene beschreiben? Wirklich präsent, außer für Expert*innen, scheint die ja nicht zu sein, oder wie siehst du das?
Das ist für mich total spannend. Ich habe noch nie so viel Live-Musik erlebt wie im letzten Jahr. Das ist natürlich absurd, weil für die Allermeisten das Gegenteil der Fall war. Aber ich habe um die 120 Konzert-Performances gesehen, auf so viel bin ich noch nie gekommen. Es gibt unterschiedliche Szenen. In Berlin gibt es den Bereich der Echtzeitmusik. Da geht es um improvisierte Musik, die im Moment entsteht, aber kein Jazz im klassischen Sinne ist. Da ist man schon weitergegangen. Teilweise ist das freie Musik, experimentell. Es gibt aber auch wilde elektronische Maschinen. Dann gibt es Sachen, die bewegen sich in der zeitgenössischen Klassik, neue Musik, da gibt es klare Überschneidungen. Ich rede von Leuten wie Tilman Kanitz, dem Ensemble KNM oder dem Solistenensemble Kaleidoskop. Die treffen sich in einem Experimentierfeld, haben aber eher den klassischen Hintergrund und kommen weniger vom Jazz. Dann gibt es eine Szene, die hat eher was mit UK-Jazz und dem Groove-Zeug zu tun, das ist tanzbarer, es gibt House-Einflüsse. Da merkt man: Die Leute hatten schon mit elektronischer Musik zu tun, auch wenn Instrumente gespielt werden. Und es gibt wiederum Überschneidungen mit der Jazz-Szene, die sonst in der Donau 115 oder nebenan im Valentin Stüberl Orte gefunden haben. Viele haben hier studiert. Wir finden hier weniger klassische Pop-Rock-Geschichten, wobei es auch in diesem Segment immer wieder interessante Acts gibt. Es ist uns wichtig, auch denen eine Bühne zu geben. Innovation ist ein wesentlicher Faktor. Dann gibt es eine Musik, wo ich heute gar nicht mehr weiß, wie man die bezeichnen soll. Man nannte das mal Weltmusik, das ist aber ein vorbelasteter Begriff. Was ich meine, ist Musik, die stark in der lateinamerikanischen oder afrikanischen Musikkultur verwurzelt ist. Auch bei indischen oder türkischen Sachen – sowohl Klassik und Pop. Musikerinnen wie Derya Yildirim – da gibt es viele tolle Geschichten. Die Serie mit dem Gretchen bringt unseren Grundgedanken gut auf den Punkt: Da spielen alle im gleichen Setting, wie bei einem Showcase – so lässt sich das vergleichbar machen und wir können Standards schaffen. Wir legen großen Wert auf die Tonaufnahme, machen Mehrspurmitschnitte, mischen das im Studio noch mal. Und am Ende des Tages ist es immer der Sound, der dich mit der Musik verbindet und nicht das Bild. Letzteres ist ein schönes Beiwerk, aber oftmals werden die Wichtigkeiten vertauscht. Gerade bei Live-Videos gibt es oft viele teure Kameras, aber dann einen einfachen Stereomitschnitt vom Mischpult dazu. Das ist vom Sound her nicht cool.
Wie sind die Acts mit den Gigs im letzten Jahr umgegangen? Für viele dürfte der Videomitschnitt das einzige Konzert gewesen sein, ganz anders als vor zwei Jahren, wo man so eine Performance wahrscheinlich zwischen Dutzenden Festival-Gigs noch reinquetscht. Das macht doch was mit kreativen Menschen und bildet sich doch auch in der Performance ab?
In der Tat. Bei unseren Produktionen haben wir in der Regel ein drei- bis vierstündiges Zeitfenster. Von der Ankunft der Band, dem Aufbau und einer kurzen Besprechung. Wie nehmen wir auf? Wir haben mit der Zeit immer mehr Guidelines entwickelt. Ich finde es spannend, wie unterschiedlich diese Herausforderungen angenommen werden. Wie wird der zeitliche Rahmen optimal genutzt? Oft gibt es feste Repertoires, die Setlist, die man runterspielen kann. Aber meine schönen Erfahrungen waren, dass schnell verstanden wurde, dass wir einen Fokus auf die Musik und den Sound legen. Das ist ja das Anliegen der allermeisten Acts. Ich kenne das von eigenen Projekten. Wenn man plötzlich mit Fernsehen oder so zu tun hat, ist man schnell ein Programmpunkt oder die Person am Licht entscheidet, wie gefilmt wird, der Sound-Aspekt rückt in den Hintergrund.
Wie sieht so ein Prozess aus?
Bei Derya Yildirim war es spannend. Sie hat das während ihres Gigs auch thematisiert, indem sie sich fragte, wo die Leute sind und für wen sie das eigentlich macht. Sie fühlte sich in der Situation nicht richtig wohl. Obwohl sie erstmal alles nett fand. Aber in einem leeren Raum zu spielen, kann für viele befremdlich sein. Einen Tag später bekam sie das Material, eine erste Fassung, viel geschnitten wird bei den Konzertaufnahmen ja nicht. Die Künstlerin war danach sehr gerührt und begeistert, was da für eine intime und intensive Stimmung trotz aller Umstände entstanden war. Sie war sehr angetan, auch weil sie mit anderen Streaming-Formaten nicht so gute Erfahrungen gemacht hatte. Man weiß nie, was am Ende herauskommt. Das Feedback des Publikums während einer Performance ist ja ein wesentlicher Faktor. Es kommt zum Dialog, gerade bei Improvisationen. Wir wollen nicht mit physischen Konzerten konkurrieren, wir machen ja eigentlich PR für physische Konzerte. Und wollen helfen zu vermitteln, was dabei Spannendes passiert. Die Artists haben bei uns ein Mitspracherecht, was die Tonmischung anbetrifft. Dieser Ansatz ist uns wichtig. Es geht darum, die Musik und die Stimmen in den Vordergrund zu rücken. Beim „A l’arme“- Festival hatte ich viel Austausch mit Caspar Brötzmann. Zunächst war er überhaupt nicht zufrieden mit dem Ton, er hat die Produktion angezweifelt. Das gemeinsam auszuarbeiten, bis auch er damit glücklich war und sagte, dass das Projekt auch für ihn eine super Bestandsaufnahme ist ... Die Sets sind 20 Minuten lang. Die sind gut zu handlen. Der Schritt von 20 Minuten auf 75 ist dann eine ganz andere Sache. Das ist ein langer Weg. Im Falle von Brötzmann hat das Set eben auch ihm geholfen, seine bisherige Arbeit zu validieren.
Lass uns über Live-Streams generell reden. Da ist in den letzten zwölf Monaten eine Menge passiert, vom lauten DJ-Rauschen bis hin zu ernstzunehmenden Formaten und teils verzweifelten Versuchen Festivals wie das Tomorrowland zu digitalisieren. Perlen wie „Playing the Piano for the Isolated“ von Ryuichi Sakamoto waren in meiner Wahrnehmung indes viel zu selten.
Es ging Ende März 2020 los. Ich war ehrlich gesagt ratlos bis schockiert. In was für einem Tempo alle möglichen Veranstaltungen als Live-Stream realisiert wurden: Das fand ich gut. Aber qualitativ habe ich nicht verstanden, dass es da so wenig Bedenken gab. So ein Stream ist ja nur rudimentär ein Live-Event. Es fehlt ganz viel. Wie verhält sich eigentlich ein Live-Event zu einem intensiven Erlebnis? Was lässt sich davon digital sinnvoll reproduzieren? Inwiefern funktioniert digital auch anders als live? Da ist wenig passiert – bis auf einige Ausnahmen. Das Tolle an Live-Events ist ja: Ich bin in einem Raum, der Einfluss auf mich hat. Es sind andere Menschen da. Du empfindest eine gemeinsame Konzentration der Zuhörer*innen in diesem Geschehen.
Es kommen alle wegen einer Sache – wenn 2.000 Menschen wegen eines Acts an einen Ort sind, alle Fans sind und dann auch noch Geld dafür ausgegeben haben, ist das nochmal was anderes, als wenn selbst eine Band wie Radiohead ohne Bühne unangekündigt am Alexanderplatz spielen würde. Da wundern sich 50 Prozent der Leute erstmal: Wer ist das denn? Da sind Konzerte in der Regel ganz anders aufgeladen.
Die positive Erwartungshaltung schwingt immer mit. Man ist dem ausgeliefert. Du kannst da hingehen, aber in der Regel bleibt man in der Konzerthalle und der Sound ist omnipräsent. Wie laut ist ein Konzert? Was passiert mit Licht? Das sind alles Faktoren, die so eine Erfahrung ausmachen. Dann gibt es die Einflussnahme durch das Publikum. Wenn die Crowd richtig mitgeht, sind das einmalige Erlebnisse. Ich verstehe durchaus Hardliner-Fans, die mit einer Band mitreisen und alle Konzerte einer Tournee besuchen. Jeder Abend ist anders und es gibt eine andere Energie. Für mich waren die meisten Live-Streams zu lang. Man kann Menschen am Computer nicht so lange gefangen halten. Selbst wenn der Fernseher groß ist, sind wir immer noch im Pantoffelkino mit Fernbedienung.
Schwierig fand ich vor allem Live-Events bei Instagram und Facebook, weil die Plattformen ja eigentlich darauf aus sind, dass man permanent weiter scrollt und neue Inhalte liket oder teilt. Ein Konzertformat, das Fokus und Aufmerksamkeit einfordert, widerspricht völlig der Logik dieser Plattformen. Das hat man in der Aufmerksamkeitsökonomie auch redlich gespürt. Als würde man eine Eisskulptur auf einer Herdplatte erschaffen. Viele haben dann auf Twitch gesetzt, da war das Problem vielleicht weniger ausgeprägt.
Ein Versprechen der Digitalisierung ist ja, dass man Inhalte von ihrer räumlichen und zeitlichen Limitierung befreit. Das kann eine Chance sein. Auch wenn man dazu Monetarisierungsmodelle für Künstler*innen entwickelt, die in deren Interesse funktionieren. Es passieren ja spannende Sachen. Dass man in anderen Ländern wahrgenommen werden kann, war vor 20 Jahren ja nicht denkbar. Inwiefern Live-Streams aber auch nachhaltige Einnahmequellen für Bands sein können, darüber kann man reden. Zu wünschen wäre es. Das untergräbt ja auch die Möglichkeit neue Formate zu etablieren, weil so was kostet immer Zeit. Ich fand es schade, dass im Theater-Bereich so wenig im Theater passiert ist. Da wurde dann eher …
… die Generalprobe abgefilmt.
Genau. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, sich dem aktuellen Nutzungsverhalten der Leute anzupassen. Sich mehr Serien zu überlegen zum Beispiel. Ich habe als Komponist viel mit Theater und Tanz zu tun gehabt. Man arbeitet im Theateralltag oft an einzelnen Szenen. Diese Dynamik hätte man auch seriell produzieren und veröffentlichen können.
Gerade Theater hat mit dem Kammerspiel und dem kleinen Ensemblestück ja auch viele Erzählformate, die, sag ich mal, hygienekonform sind. Das sind Aspekte, die auch für die Filmproduktion von Bedeutung sind. Ben Hur mit 3.000 Komparsen lässt sich erstmal schlichtweg nicht filmen. Ich will aber kein Theater-Bashing betreiben.
Ein Beispiel: Im Gretchen hätten im Mai letzten Jahres eigentlich 35 Events stattfinden sollen, teilweise mehrere an einem Tag. Das ist alles weggebrochen und dennoch haben sie für unsere gemeinsame Serie wie auch für andere so was von die Türen aufgemacht. Wir können diese Räume nutzen, um an Sachen zu arbeiten, auf die man vorher vielleicht auch gar nicht gekommen wäre. Da bekommt man sogar Unterstützung vom ganzen Team. Das finde ich beeindruckend. So einen Spirit hätte ich woanders vielleicht auch erwartet, auch in den klassisch subventionierten Disziplinen. Die Räume sind ja alle vorhanden. Ich habe vergangenes Jahr vielleicht ein, zwei Konzerte selber gespielt. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren natürlich lachhaft. Dass ich plötzlich letztes Jahr so viel hinter der Kamera stand, war Flucht und Abwechslung zugleich. Ich war dankbar, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Da sind die Fragen wie – ist das jetzt mein neuer Job? Wird das bezahlt? – erst viel später aufgekommen. Machen, ausprobieren, entwickeln, das hat mich weitergebracht. Es ist eine Ausnahmesituation, und wir müssen so produktiv wie möglich damit umgehen.
Mich interessiert in der ganzen Gemengelage, was mit dem Berufsbild Musiker*in passiert ist. Die letzten 20 Jahre hieß es: Wer keine CDs mehr verkauft, soll halt live spielen. Die meiste Musik hat sich dann in diese Richtung entwickelt. Heute sind Live Nation oder Anschutz globale Imperien, die natürlich auch die Doktrin gepusht haben, Verwertungen auf Konzerte und Festivals zu konzentrieren. Heute heißt es dann wieder, dann solle man als Musiker*in doch YouTuber werden, Vocal-Coach via Zoom oder man baut sich eine Patreon-Community auf. Die Wege sind divers. Du bist ja selbst professioneller Musiker, spielst Bass bei Marteria, was in Deutschland live bestimmt zu den größten Hausnummern gehört. Wie schätzt du das auch als aktiver Musiker ein? Wie gehen deine Kolleg*innen damit um?
Patreon finde ich interessant. Jean-Paul Mendelsohn, mein Partner, hat früher das XJazz-Festival organisiert. Er ist Manager von Ätna, einem tollen Avantgarde-Pop-Duo. Jean-Paul ist umtriebig und greift oft früh solche Bewegungen auf. Ich habe durch ihn und über Umwege den CEO von Patreon sogar mal getroffen und finde das Konzept durchaus faszinierend. Hier geht es nicht darum, dass Artists täglich was Neues auf Social Media posten. Fans unterstützen hier, damit Kreative ihrer Arbeit nachgehen können. Auf der utopischen Ebene weitergedacht, finde ich das spannend. Das ist eine Art der direktesten Unterstützung kreativer Prozesse, die ich kenne. Man befreit sich auch von den Strukturen, die die ganzen Businesses drumherum aufgebaut haben. Eine möglichst direkte und vor allem kontinuierliche Unterstützung, die sogar die Absicherung des Lebensunterhalts ermöglichen kann. Das ist ein Modell, wie kreative Arbeit gesamtgesellschaftlich getragen werden kann. Ich sehe darin eine Möglichkeit, wie Künstler*innen in Zukunft für ihre tägliche Arbeit entlohnt werden können. Dafür braucht es aber auch die richtigen Formate und Inhalte. Das Verständnis, das Digitale auch als relevanten Output zu verstehen, mit denen ich die Qualität meiner Arbeit dokumentieren kann. Ich habe Ende der 90er als professioneller Musiker angefangen. Da hatte ich mit meiner damaligen Band einen Deal bei Motor, die dank Rammstein zum riesigen Label wurden. Damals haben wir aus heutiger Sicht absurde Produktionsetats und Vorschüsse bekommen. Klar, heute kann man günstiger produzieren als noch vor 20 Jahren. Die heutigen Verhältnisse stimmen dennoch hinten und vorne nicht. Was mich am meisten schmerzt mit dem Musikstreaming, ist die Entwertung einer Produktion. Aufwendige lohnen sich doch nur dann, wenn der Outcome das wieder reinbringt. Diese Logik ist bei den Bruchteilen von Cents, die man bei Spotify bekommt, mittlerweile vollkommen obsolet. Früher hat man gespielt, um Tonträger zu promoten, heute ist es umgekehrt. Vom ganz kleinen Teil der Superstars, die millionenfach gestreamt werden, mal abgesehen. Die gesamtgesellschaftliche Schere zeichnet sich auch in der Musik ab. Neue Projekte, neue Bands: Dass die Musik heute zum Lebensunterhalt machen können, verschiebt sich meiner Meinung nach immer weiter. Es gibt Leute, die haben medial schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Die sind angesagt und alles was dazu gehört, aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt: Die Wenigsten können davon leben! Vor 20 Jahren wäre das noch möglich geworden – eine traurige Entwicklung. Wer jedoch weniger Zeit in Musik investiert, muss sich am Ende auch mit qualitativen Defiziten auseinandersetzen. Lange hieß es: Live spielen wird immer wichtiger. In Wirklichkeit müssen viele junge Talente erstmal kostenlos spielen, wenn nicht sogar für Gigs bezahlen, weil die Konkurrenz natürlich auch groß ist. Wer nicht kostenlos spielt, spielt halt nicht. Jetzt bricht die Branche aber weg. Wie groß ist der Bedarf an einer Sache? Wenn jemand groß und bekannt ist, kann der Act natürlich eine Paywall installieren. Aber wie finden wir heute die neuen Sachen? Vor allem bezahlt niemand für etwas, von dem man nicht weiß, was es ist.
Es fehlt die Sichtbarkeit. Selbst als Newcomer auf der entsprechenden Bühne auf dem Coachella bist du immer noch auf dem Coachella und kannst von Fans, wenn auch zufällig entdeckt werden. Man entdeckt ja keinen Live-Stream, und Newcomer zu entdecken wird so gesehen in der Tat immer schwieriger.
Das Problem an YouTube ist ja, dass man da alles findet. Nicht nur Musik, auch Sport, Selbstoptimierung und alles Mögliche. Deshalb bemühen wir uns um einen kuratorischen Rahmen und ein redaktionelles Konzept. Neue Projekte können durch solche redaktionellen Rahmen entdeckt werden. Aber wenn man die Entwicklung der Tonträger und Konzerte anschaut, die Bereitschaft, für Musik Geld zu verlangen bzw. zu bezahlen, schwindet. Wenn Grönemeyer einen Live-Stream macht, dann bezahlen Leute Geld dafür. Für die meisten ist das aber kein Ersatz und kein verlässlicher Hebel, um Einkommen zu generieren.
Ich denke dabei auch an die jungen Leute. Unsereins hatte Ende der 90er den Traum eines Rockstars und wollte das nachmachen. Welche Role Models, Narrative gibt es denn heute für 18-jährige Artists? Ich wäre mir unsicher, ob ich heute noch uneingeschränkt Musiker werden wollen würde. Das hat doch Konsequenzen auf die Musikkultur.
Vorletztes Jahr habe ich mit dem Manager von Bilderbuch gesprochen und da meinte er schon, also 2019, dass er keine Ahnung habe, was für einen Weg eine Band gehen könnte, die sich über Instrumente und Livekonzerte definiert. Dabei meint man, dass Bilderbuch schon super erfolgreich seien. Er hatte deine Frage ähnlich vor zwei Jahren schon gestellt und da war von Pandemie noch keine Rede. Das hat also davor schon nicht funktioniert und wurde im letzten Jahr nur verschärft. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es hierzulande so viele Förderprogramme gibt. Aber ich habe da auch zweischneidige Erfahrungen gemacht. Man bekommt immer wieder zu hören, dass es für bestimmte Konzepte und Ideen kein passendes Förderprogramm gibt. Das ist doch eine verkehrte Welt. Weil: Natürlich passen wirklich innovative Ideen in keine Schublade oder bestehende Programme. Das schließt das Andere oder Neue häufig aus. Weniger fragt man sich, ob man das braucht oder ob das was bewirken kann, sondern ob etwas in das jeweilige Programm passt. Da könnte man doch gemeinsam neue Wege und Lösungen finden.