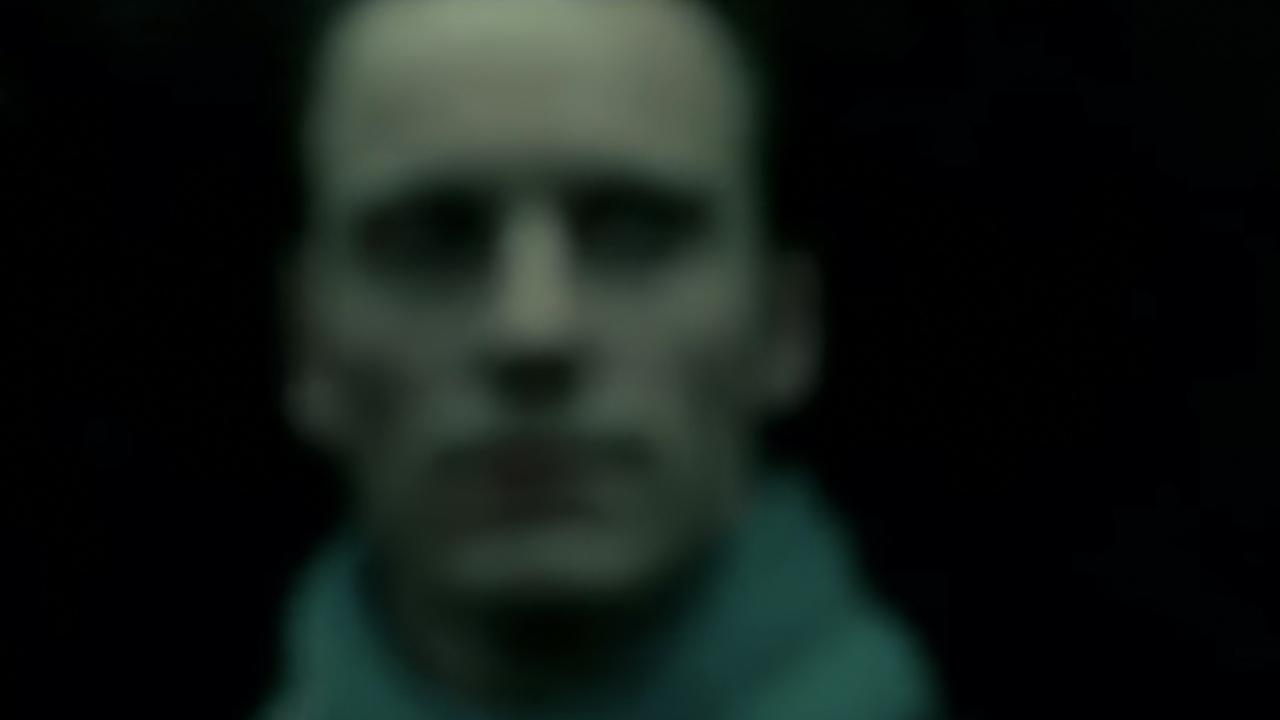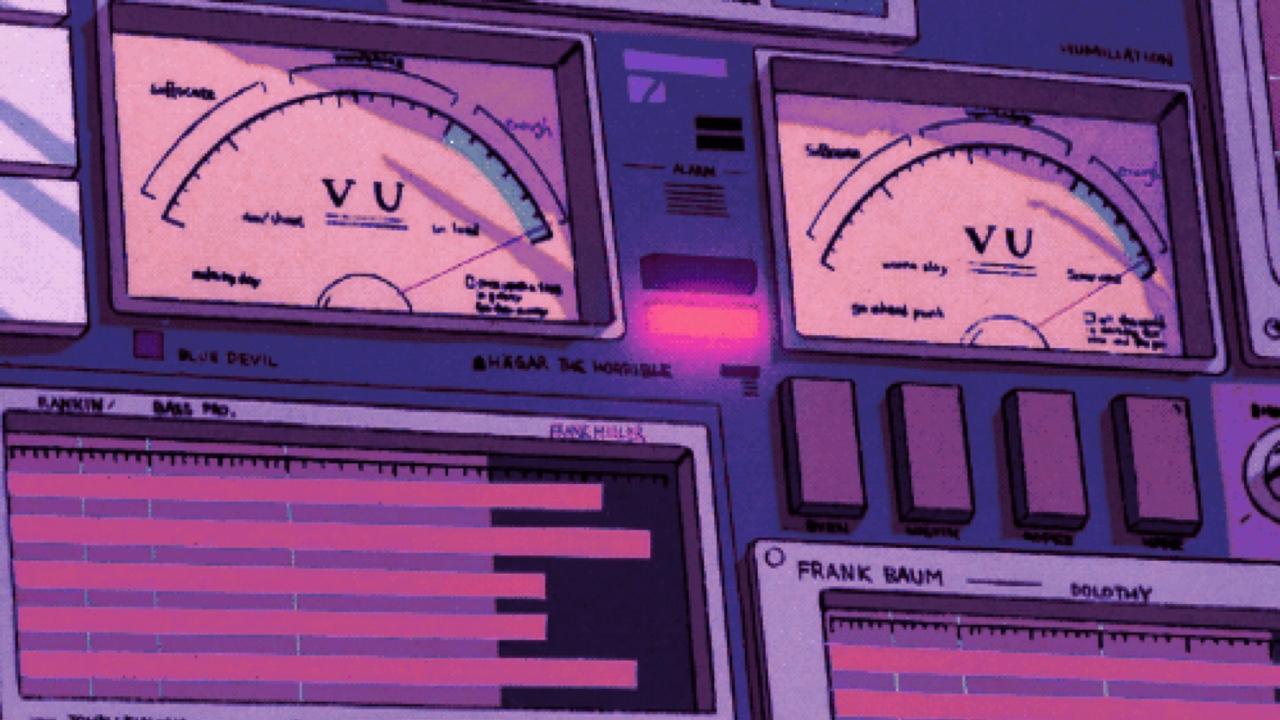Wir bleiben zu Hause, wir gucken Heimkino: Empfehlungen von Sulgi Lie für die Wohnzimmerleinwand. Heute wird aber nicht geglotzt, vielmehr fällt der Blick auf das Gerät, welches uns dieses Glotzen überhaupt erst ermöglicht: die Filmkamera. Sie ist unser ausgerissenes Auge, eine Verlängerung und Verlagerung desselben nach außen. Als mechanischer oder virtueller Apparatus ist sie ein seltsam belebtes Interface – und durch technische Innovation längst nicht mehr an die Beschränktheit menschlicher Wahrnehmung gebunden. Sie nimmt uns als Sehende vielmehr an die Hand und führt uns durch ungesehene Dimensionen und erweitert unseren Blick auf die Welt.
Wenn die menschlichen Augen organisch ordnungsgemäß in den Augenhöhlen sitzen, gelten sie traditionellerweise ja als Spiegel der Seele. Wenn sie jedoch dem Körper entrissen werden, mutiert diese romantische Innerlichkeit nicht nur in Schrecken erregende Äußerlichkeit, sondern auch in Blindheit – bekanntlich stach sich schon der arme Ödipus selbst die Augen aus. Mit der Filmkamera hat das Kino jedoch einen Apparat erfunden, der ausgerissene Augen nicht erblinden, sondern sehen – mehr sehen und anders sehen – lässt. So feiert bereits der sowjetische Revolutionsfilmer Dsiga Wertow die Kamera als ein allsehendes „Kino-Eye“, das den Augenhöhlen entrissen und wild in die Materie hineingeworfen wird.
Wertow hat dieser durchaus rabiaten Vision des technomorphen Kameraauges mit Der Mann mit der Kamera ein frühes filmisches Denkmal gesetzt: Während unsere trägen menschlichen Augen der Perspektive unserer körpergebundenen Wahrnehmung nicht entrinnen können, kann das Kameraauge jede mögliche Ansicht, von der detailliertesten Großaufnahme bis zur immensesten Totale, jede mögliche Perspektive von der Frosch- bis zur Luftperspektive einnehmen. Das Kameraauge ist für Wertow die Signatur einer kollektiven Modernisierung des Sehens, die auch vor der organischen Natur des Menschenauges nicht halt macht. In der alten Parole „Kommunismus = Sowjetmacht + Elektrifizierung“ muss man das Kameraauge unbedingt mitdenken: Man sollte sich Wertows Helden als einen frühen sowjetischen Cyborg vorstellen – bewaffnet mit nichts anderem als einem automatisierten, technisierten, elektrifizierten Auge.
High durch das Camera Eye
Überhaupt spukt die euphorische Idee eines von seinen anthropomorphen Fesseln befreiten Auges durch die frühe Film- und Kinotheorie. So erlebt der ungarische Autor Béla Balász qua Kameraauge einen Delirium-artigen Distanzverlust: „Die Kamera nimmt mein Auge mit. Mitten ins Bild hinein. Ich sehe das, was sie von ihrem Standpunkt aus sehen. Ich selber habe keinen. Ich gehe in die Menge mit, ich fliege, ich tauche, ich reite mit.” High durch das Camera Eye war neben Balász auch Walter Benjamin, dem das Kameraauge mittels Zeitlupen und Zeitraffereffekten für das „optisch Unbewusste“ der Natur die Augen öffnete. Wie Wertow greift auch Benjamin zu einer gewalttätigen Metapher, wenn er die Kamera mit einem chirurgischen Messer vergleicht, das in das Gewebe der Wirklichkeit schneidet, um aus diesen Gewebepartikeln eine neue Wirklichkeit zu erschaffen.
Nimmt man Wertows und Benjamins Metaphern beim Wort, ist das Kameraauge Cyborg und Chirurg zugleich – ein ziemlich monströser Hybrid, aber fast schon eine proto-digitale Schöpfung. Da ist es nur logisch, dass der „Mad Scientist“ zu solch einer zentralen Figur in den Fiktionen des Kinos geworden ist – ist er auch immer daran interessiert, die Grenzen des Sehens auszutesten. Gerade im B-Movie-Bereich wird man da natürlich besonders gut fündig: Zu den abstrusesten Visionären des Sehens gehört der verrückte Wissenschaftler James Xavier (Ray Milland) aus Roger Cormans Klassiker The Man with the X-Ray Eyes. Dem Filmtitel entsprechend ersetzt Xavier seine Augen durch eine neuartige Augenprothese, die es ihm fortan erlaubt, röntgenartig durch die Dinge hindurchzuschauen und die Oberfläche des Sichtbaren zu durchdringen. Was zunächst einen großen Fun-Faktor verspricht – im Casino dem Gegner durch die Karten und auf Partys den Girls durch die Röcke schauen – wird aber nach und nach zum Horrortrip, weil Xavier nur noch abstrakte Lichttexturen sieht, die sein Gehirn nicht mehr zu visuell intelligiblen Gestalten verarbeiten kann. Xaviers neue (Kamera)Augen bilden nicht mehr in analoger Ähnlichkeit die Wirklichkeit ab, sondern erschaffen sie in quasi digitaler Weise neu. Von den Röntgenstrahlen vollends verstrahlt, läuft Xavier nur noch mit einer Sonnenbrille durch die Gegend, bis er sich in einer grandiosen Schlussszene in einer Gospelkirche die Augen selbst aus dem Gesicht reißt. Autsch! – das Kameraauge kann einem halt auch einen schlechten Trip bescheren. Konsequenterweise sieht man in Vor- und Abspann des Films ein Paar ausgerissene Augen in einer Einmachdose.
In SciFi-Treue zu Cormans virtuoser Trash-Buchstäblichkeit lässt auch Steven Spielberg in einer Szene seines Minority Report Tom Cruise seinen eigenen Augäpfeln hinterher rennen, nachdem er sich diese zwecks Identitätstäuschung durch Implantate hat austauschen lassen. In der totalen Überwachungssphäre des Films sind die Augen nämlich nicht länger die Spiegel der Seele, sondern polizeiliches Identifikationsmerkmal qua digitaler Netzhaut-Scans. Die Allgegenwart technologischer Sehmaschinen, so scheint Minority Report dystopisch zu suggerieren, macht das alte menschliche Auge eigentlich überflüssig. Technik als Organprothese; als Extension des menschlichen Körpers, so Marshall McLuhans medientheoretische Einsicht, wird in solchen Filmen auf eine unheimlich Art selbständig: autonomous automatic eyes.
Entfesselte Potenziale
Als ästhetische Tendenz lässt sich im Laufe der Technikgeschichte des Kinos generell eine immer stärkere Abkoppelung des Kameraauges vom menschlichen Auge ausmachen: Montierte F.W. Murnau noch für Der letzte Mann die Kamera auf Fahrräder und andere Bewegungsmedien, um den Blick subjektiv zu mobilisieren, so ist spätestens seit der körperbalancierten Steadycam, die in Kubricks The Shining geisterhaft durch die Hotelkorridore gleitet, der Kameraapparat vom Auge des Kameramanns abgetrennt. Und in den ferngesteuerten und computergestützten Kamerasystemen von heute ist selbst der letzte Rest der körperlichen Verankerung durch ein automatisches Auge obsolet geworden, das eines menschlichen Verursachers und Bewegers gar nicht erst bedarf. Die Digitalisierung des Kinos betrifft also nicht nur die High-Definition-Pixeldichte und die komposite Generierung des Bildes, sondern auch den (Kamera)Mann mit der Kamera hinter der Kamera, der möglicherweise in Zukunft von vorprogrammierten Bewegungsalgorithmen ersetzt wird.
Der kanadische Avantgarde-Filmer Michael Snow hat bereits 1971 in La Région Centrale das digitale Potenzial eines autopoetischen Kamera-Roboters ausgelotet, der in einer menschenleeren Landschaft mittels vorprogrammierter Einstellungen immer neue Kamerabewegungen ausführt. Snows permanent rotierende Kamera bricht auch mit der horizontalen Geometrie des stabilen Blickstandpunkts und lässt den Blick vom Boden abheben und in alle Richtungen herumschleudern – von seitwärts gekippt bis kopfüber.
Im experimentierfreudigen Geiste eines Michael Snow hat in den letzten Jahren Gaspard Noé eine solchermaßen entfesselte Kamera in Enter the Void ins digitale Zeitalter überführt. Nicht zufällig beginnt “Enter the Void” als Drogenfilm, der die Trips seines Protagonisten nicht nur durch computergenerierte Texturen aus dem Inneren des drogeninduzierten Gehirns zu visualisieren versucht, sondern auch durch eine radikale Form der subjektiven Perspektive die Einheit von Figurenauge und Kameraauge simuliert – selbst das Augenblinzeln wird durch kurze Shutter-Effekte nachgeahmt.
Nachdem der Held aber bei einem gescheiterten Drogendeal das Zeitliche segnet, dreht der Film – und mit ihm die Kamera – vollends ab: Die Seele des Protagonisten überlebt als körperloser Geist den biologischen Tod und deliriert fortan als reines Kameraauge durch ein Labyrinth aus Realereignissen, Erinnerungen und Visionen. Die Kamera taumelt, bohrt, saugt und schraubt sich durch Höhen und Tiefen, bis einem wie in Kubricks LSD-trunkener Stargate-Sequenz aus 2001 Sehen und Hören vergeht. In Noés radikaler Psychedelik sieht fast nichts mehr nach traditionellem Kamera-Realismus aus: Eine Welt wie aus flüssigem Phosphor, verstrahlt vom digitalen Kameraauge. Nicht nur reichen sich Kubrick, Snow und Corman bei Gaspard Noé in trauter Eintracht die Hände, auch WertoW, Balász und Benjamin hätte der Film vermutlich gut gefallen: Die Kamera nimmt mein Auge mit und steuert es in das Auge des Zyklons hinein – Enter the Void.