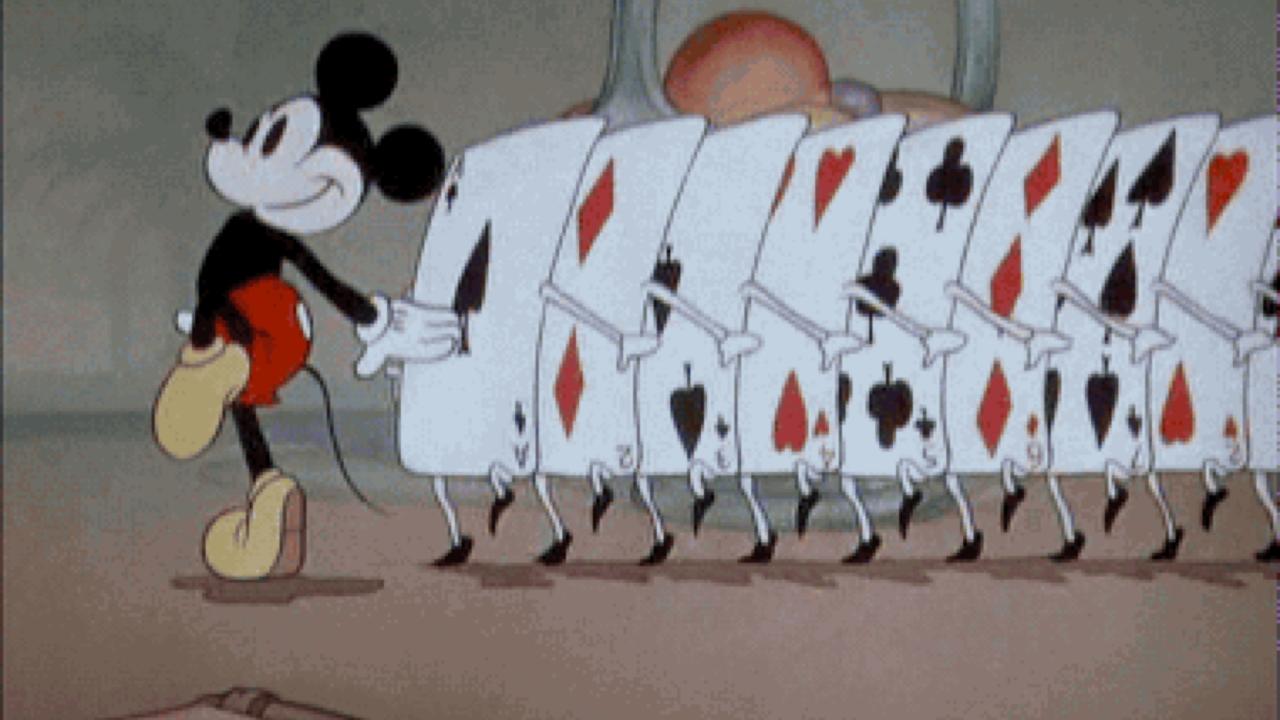Jeden Samstag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Nicht immer neu, doch immer die Erwähnung wert. Heute mit: Tim Linghaus, Alva Noto & Ryuichi Sakamoto und Kele.

Tim Linghaus – We Were Young When You Left Home
Thaddeus: Das wird irgendwie schon immer alles noch bunter und bunter. Seit Jahren suche ich nach einem neuen Begriff, um endlich die Klebrigkeit der „Neoklassik“ loszuwerden. Tim Linghaus ließ sich bislang durchaus in diesem Gewerk einsortieren, besetzte dabei jedoch mit seinen einfach strukturierten und vom richtigen Herzschlag bestimmten Klavierminiaturen einen der vorderen Plätze. iTunes liefert die lang ersehnte Lösung: „klassische Crossover-Musik“. Au weia, na dann. Gestern nun erschien das neue Album des Musikers – und das verwirrt im positivsten Sinne. Natürlich spielt das Klavier buchstäblich immer noch die erste Geige in Linghaus’ Kosmos, die Akkorde fließen angenehm berechenbar und streicheln mit Wohlklang die mitunter angekratzte Seele. Aber: Der Komponist bricht dieses Prinzip immer wieder mit knisternder Kratzbürstigkeit, die so subtil durch die Tracks fährt, dass man zunächst gar nicht recht begreift, was hier gerade passiert. Er hat viel Lambchop gehört, würde ich tippen, sich mit Kurt Wagners Autotune-Abhängigkeit auseinandergesetzt und seine eigene Schlüsse daraus gezogen. Vocals sind ohnehin ein wichtiges Stichwort auf „We Were Young When You Left Home“: Auch sie unterstützen den neuen und viel holistischeren Kompositions-Ansatz, der wie für eine croonende Band im Zigarettennebel beim Slow Jam in der blauesten Blue Hour gemacht zu sein scheint. Dass dabei das Klavier immer wieder ganz stille Soli bekommt, ist nur gut und recht.

Alva Noto & Ryuichi Sakamoto – Two (Live At Sydney Opera House)
Ji-Hun: Dass Carsten Nicolai (Alva Noto) und Ryuichi Sakamoto zwei Großmeister ihres Fachs sind, haben sie schon bei ihren vier gemeinsamen Alben „Vrioon“, „Insen“, „Summvs“ und zuletzt „Glass“ bewiesen. Seit 2002 kollaborieren der Raster-Noton-Pate und die japanische Tastenlegende (YMO), und die Soundscapes, die die beiden schaffen und schufen gehören zu den edelsten und elegantesten in der Audiosphäre. Im vergangenen Jahr waren Alva Noto und Ryuichi Sakamoto gemeinsam auf Tournee. „Two“ nannte sich die Performance, die unter anderem im Opernhaus Sydney aufgeführt wurde. Nun ist das Live-Album erschienen und es ist nicht nur ein immersiv auditives Spektakel, sondern auch ein schöner Blick auf das Oeuvre der beiden Künstler. Der kristalline Formalismus von Alva Noto wird immer wieder durch die feinen elegischen Klavier- und Synthie-Läufe Sakamotos im besten Sinne „aufgeweicht“. Nicht fehlen dürfen hier natürlich Stücke des Filmsoundtracks für „The Revenant“ von Alejandro G. Iñárritu. Eine wunderbare Hybris aus Best-of-/ und Live-Album. Und wer die Klangwelten dieses Projekts noch nicht auswendig kennt, hat nun eine ziemlich perfekte Möglichkeit das nachzuholen. Für Fans ist das hier ohnehin obligatorisch.

Kele – 2042
Benedikt: Bloc Party: Helden meiner Jugend – in damals guter Indie-Gesellschaft versteht sich. Auch knappe 15 Jahre nach Erscheinen, lasse ich für „Helicopter“ oder „Banquet“ jederzeit alles stehen und liegen. Als das letzte Jahrzehnt sich dem Ende neigte und sich die potenziell getrennten Wege der Bandmitglieder abzeichneten, fand ich das – ganz milde ausgedrückt – gar nicht gut. Ehrlich. Ich verstehe bis heute nicht, was diese großartige Kombo zu jener Zeit geritten hat. Ob vorübergehende Wege-Trennung oder Auflösung, war damals nichtmal ganz klar. War eine Scheiß-Zeit, so als Fan. Dementsprechend negativ habe ich auch die ersten Solo-Alben von Frontmann Kele Okereke aufgenommen. Und jetzt gerade höre ich nochmal rein, ins Solo-Debüt, und stelle fest: Auch heute kann ich weder „Boxer“ (2010) noch dem elektronischen Nachfolger namens „Trick“ im Jahr 2014 so wirklich etwas abgewinnen. „Trick“ sollte so etwas wie Rave sein, glaube ich. Funktionierte damals auch, zumindest im Radio, wenn ich mich recht erinnere. Aber klanglich war das doch glattgebügelt bis in die auditive Bedeutungslosigkeit. Völlig abhanden gekommen war alles Kratzig-Raue, das Bloc Party so unverwechselbar hatte klingen lassen. War der Typ hier nicht Frontmann? Zum Heulen. Das Singer-Songwriter-Album „Fatherland“ habe ich mir erst gar nicht mehr angehört, das bereits in diesem Jahr erschienene (Musical) „Leave To Remain“ ist wiederum komplett an mir vorbeigegangen. Nun also „2042“ – Kele Okereke… Überraschenderweise geht mir schon im Opener „Jungle Bunny“ das Herz auf, ob der prominent platzierten Gitarre. Höre ich da Bloc Party? Gibt’s doch gar nicht. „2042“ bringt zusammen, was Kele bislang separat abhandelte: elektronische Beats, großartige Riffs, die an die glorreiche Indie-Historie erinnern, sprechgesangliche Motive, sein persönliches Mitteilungsbedürfnis. Letzteres entspringt hier mehr denn je einer politischen Perspektive: „2042“ handelt vor allem von (institutionellem) Rassismus. Obwohl UK über die Albumlänge hinweg im Zentrum seiner Kritik steht, ist ihm mit „St. Kaepernick Wept“ und der darin verhandelten Geschichte um einen knieenden NFL-Spieler, und die aus rassistischen Motiven erfolgte Ermordung des 14-jährigen Emmett Till im Jahre 1955, ein besonders eindrucksvolles Stück gelungen. Auch „My Business“ und „Natural Hair“ sind mehr als nur einen Durchlauf wert, womit wir beim einzigen Problem der Platte wären: Sie ist zu lang bzw. hat zu viele Tracks – 16 an der Zahl. Manche großartig, manche weniger gut. Allgemeine Handlungsempfehlungen fürs Cherrypicking lassen sich aufgrund der Diversität kaum geben. Da muss jeder selber ran. Fest steht für mich: Das hier ist die bislang beste Solo-Platte von Kele Okereke. No Doubt.