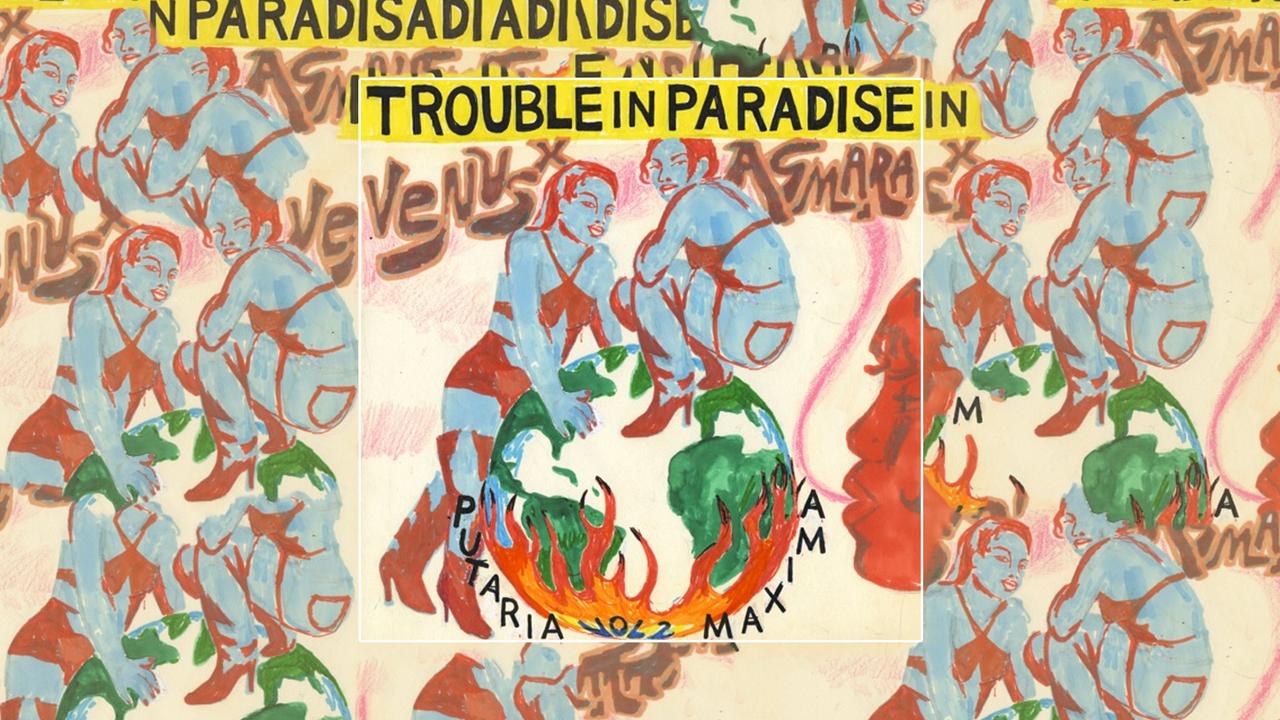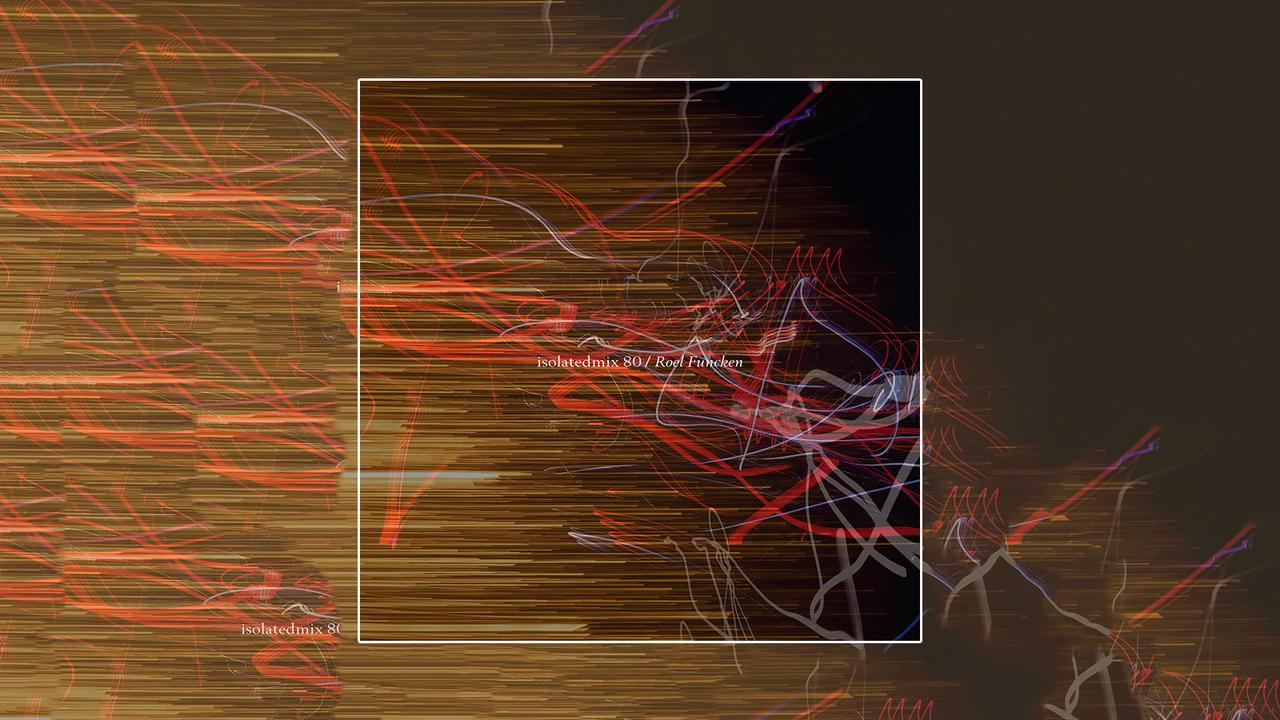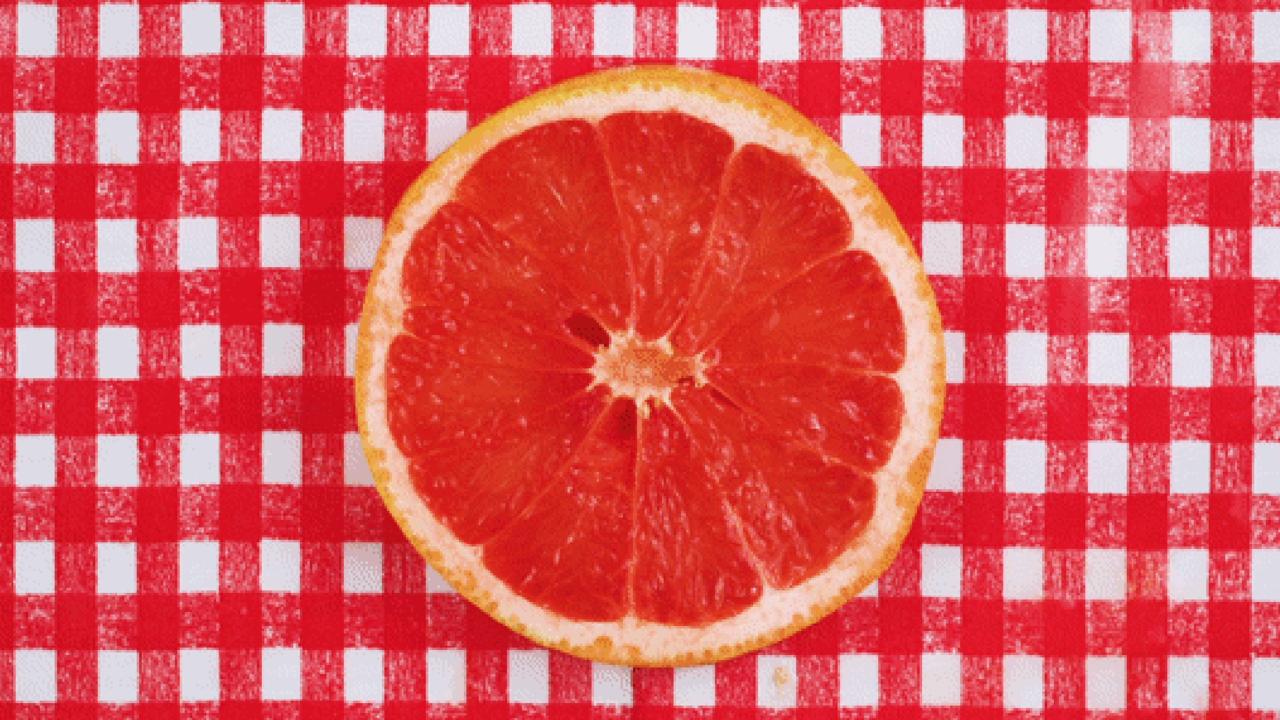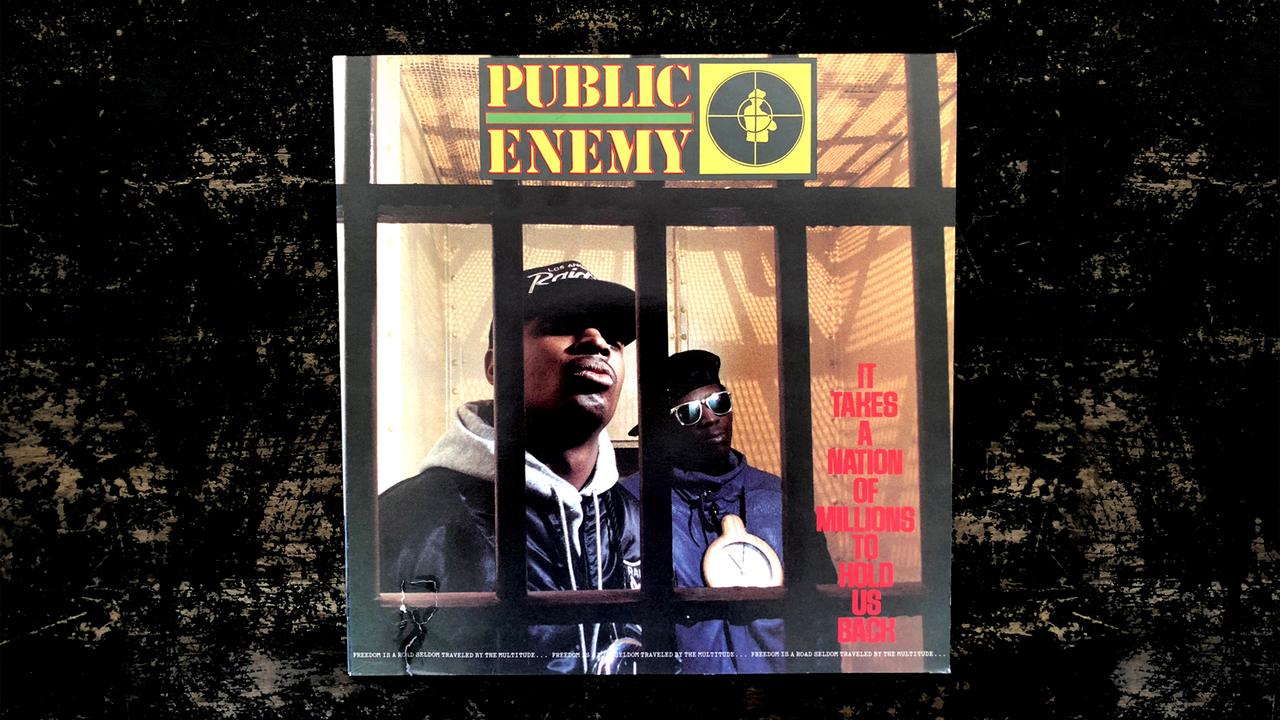Jeden Samstag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Brandneu, wieder entdeckt oder aus der Geschichtskiste ausgebuddelt. Heute mit Ross From Friends, SSTROM und Ekuka Morris Sirikiti

Ross From Friends – Family Portrait
Ji-Hun: Vor einigen Jahren tauchte eine junge Generation neuer Produzenten in der House-Szene auf, die zunächst vor allem durch ihre Künstlernamen für Verwirren, Lacher oder auch Kopfschütteln sorgten. DJ Longdick, DJ Seinfeld, DJ Boring oder auch Ross From Friends. Letzterer hat nun sein Debüt auf FlyLos Label Brainfeeder veröffentlicht. Und das, was einst als LoFi- bzw. Outsider-House begann (bessere Genrebezeichnungen gab es offenbar nicht) und auch Protagonisten der Musikpresse zu verzweifelten Streitgesprächen brachte (Ist das nun wirklich neu? Alles nur ein billiger Scherz? Spielt die Hypemaschine schon wieder zu lange in der eigenen Hose herum? Oder doch gar ernstzunehmende gute Musik?), hat sich im Falle von Felix Clary Weatherall (Ross From Friends) in eine großartige Richtung entwickelt. Weatherall wuchs in einer musikalischen Familie im britischen Colchester auf, sein Vater ist ebenfalls DJ und Experte für Italo Disco und Hi-NRG. „Family Portrait“ spiegelt diese durch Dancegrooves getriebene Sozialisation wider und ist dabei weder groß eklektisch geschweige denn trashig. Ross From Friends beweist, dass er ein feines Gespür für Harmonien und kluge Arrangements hat und LoFi ist das alles trotz der gedämpften Ästhetik auch nicht. Es sei denn Boards of Canada machen neuerdings LoFI-IDM. Ist ja auch Quatsch. Den 12 Tracks auf „Family Portrait“ gelingt das, was den wenigsten Dance-Alben gelingt. Sie sind konsistent, erzählen eine Geschichte und beweisen sich auch als Songs. Ein einfühlsamer und ziemlich souveräner Einstand und bislang das vielleicht House-Album des Sommers.

SSTROM – Otider
Benedikt: Hannes Stenström ist eine Hälfte des schwedischen Duos SHXCXCHCXSH. Deren Debütalbum „STRGTHS“ erschien 2013 auf dem Label Avian, dem Label von Shifted und Ventress. Das sei an dieser Stelle erzählt, weil der Sound auch ziemlich gut in genau dieses Umfeld passt: Techno, düster und repetitiv, dreckig aber deshalb noch lange nicht simpel. Als SSTROM ist Strenström nun solo unterwegs und unterscheidet sich in dieser Arbeit doch massiv von SHXCXCHCXSH, ohne dabei unglaubwürdig zu wirken. Was das nun bedeutet? Ok, Kontext wechseln. Als einstiges Dorfkind findet mein gegenwärtiges Ich auch heute noch manchmal den Weg auf die Bier-nassen Holzplanken eines Festzelts, will sagen: Dorfparty, Mainstream-Musik, Deutsch-Pop und schlimmeres. Was tut man nicht alles, der guten alten Zeit wegen. Jedenfalls fällt dort auf, dass die Rhythmik von House und Techno längst angekommen ist, in den Drum-Patterns furchtbarer Pop-Songs, deren schlimme schlimme Lyrics eigentlich nur die Vorstellung befördern, in der Hand möge sich doch ein Revolver statt des Bierglases befinden, eine Kugel für mich würd' ja reichen, während Glasperlenskrebs „Geiles Leben“ zum Besten gibt. Stattdessen – man will die alten Jungs jetzt auch nicht hängenlassen – versuche ich Stimme, Politur und die Hälfte der Spuren einfach auszublenden. Lass sie im Gehörgang ankommen, aber mein Geschmack sortiert als Bouncer alles aus, was nicht in den Kopf darf. Was übrig bleibt ist House und Techno, in Wirklichkeit repetitiver, als jeder fleißig Mitsingende gerade begreifen kann. Und dann stelle ich mir immer die folgende Frage: Die Schnittmenge ist da, dann kann es doch nicht so schwer sein, diese konträren Welten zu verknüpfen? Den Pop-Appeal, die Melodien, die Massentauglichkeit, aber Rave unten drunter. Natürlich wird das oft versucht, und fast so oft wird gescheitert, wenn man nicht gerade Modeselektor ist. Lange Rede, kurzer Sinn: Hannes Stenström gelingt meinem Empfinden nach genau das.

Ekuka Morris Sirikiti – Ekuka
Thaddeus: Ein ganz und gar verzaubernd-großartiger Fund aus der Musikgeschichte erscheint diese Woche bei Nyege Nyege Tapes: Aufnahmen von Ekuka Morris Sirikiti, einem legendären Mbira-Spieler aus Uganda. Ein Mbira ist ein Lamellophon, hierzulande besser bekannt als Kalimba. Dieses kleine Daumenklavier kombiniert Sirikiti mit einem selbstgebauten, rudimentären, aber umso effektiveren Bassdrum-Konstrukt und natürlich seinem Gesang. Die Aufnahmen entstanden zwischen den späten 1970er-Jahren und 2003 und sind allesamt Radio-Mitschnitte. So kommen zur Musik selbst auch noch ganz unterschiedliche Klangqualitäten als Faszinosum dazu. Es rauscht, es flirrt, es zerrt und die Musik verteilt sich im UKW-Äther, als gäbe es gar keine andere Wahl. In seinen Texten nimmt Sirikiti – so ist zu lesen – alltägliche Dinge in den Blick, bei denen auch immer eine gesamtgesellschaftliche Komponente mitschwingt, teils aus eigener Motivation, teils im Auftrag der Regierung: Zahlt eure Steuern, trinkt keinen Alkohol, bringt eure Kinder in die Schule. Die Aufnahmen stammen aus einer Zeit, in der es in Uganda drunter und drüber ging, sich aber auch Schritt für Schritt demokratisierte. Vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs wirken die Songs noch bizarrer, und auch wenn gerade der Gesang ob der fremden Sprache nur auf musikalischem Level bei uns ankommen, spricht Sirikitis Intonation stille und doch umso dringlichere Bände. Die bislang größte Entdeckung 2018.