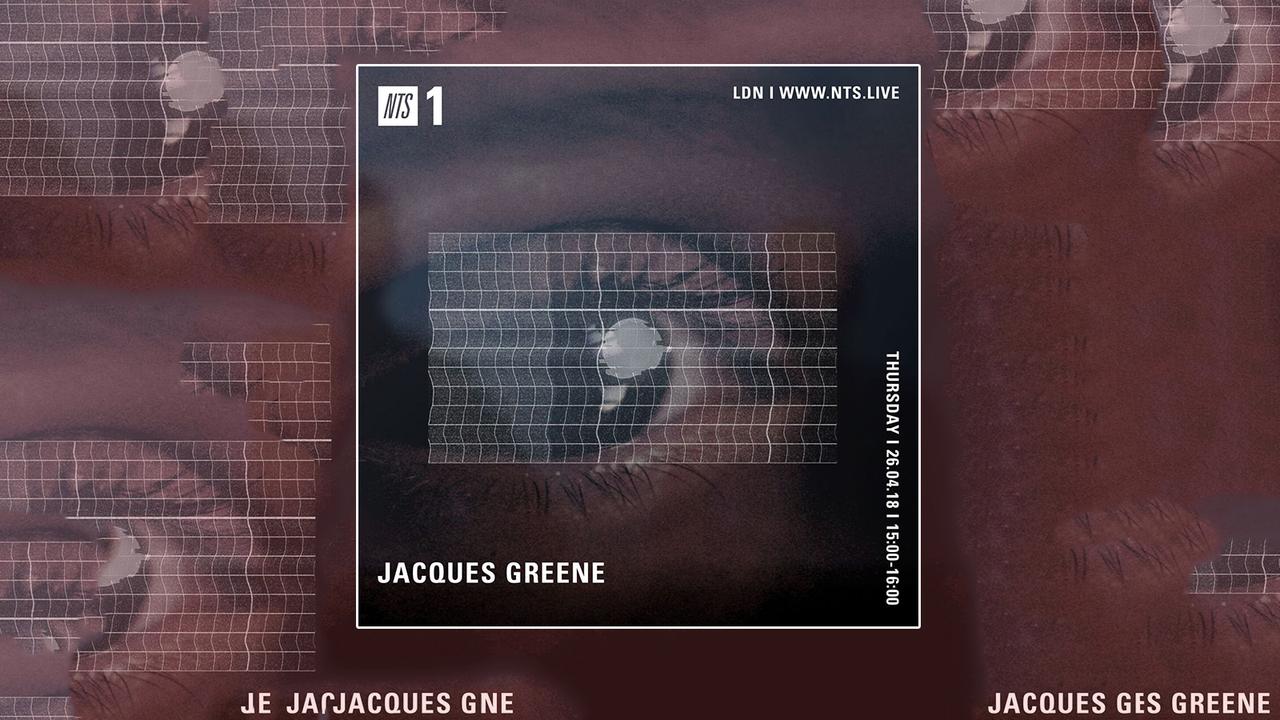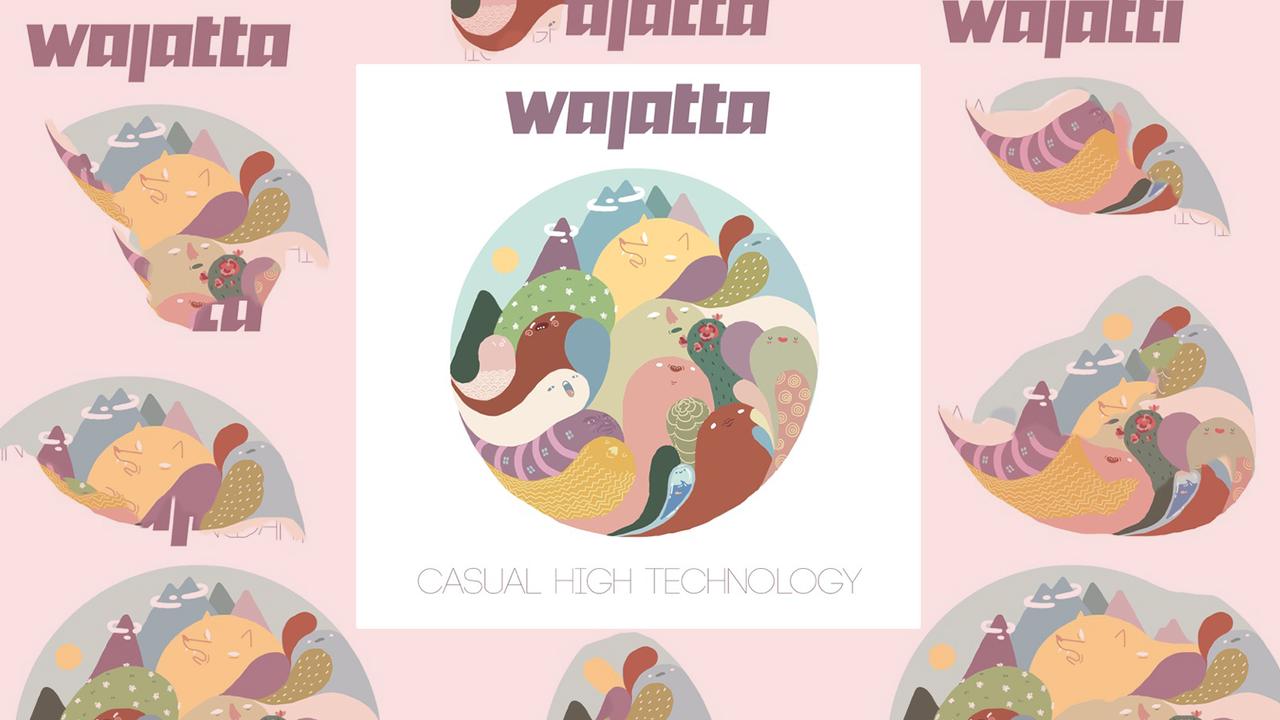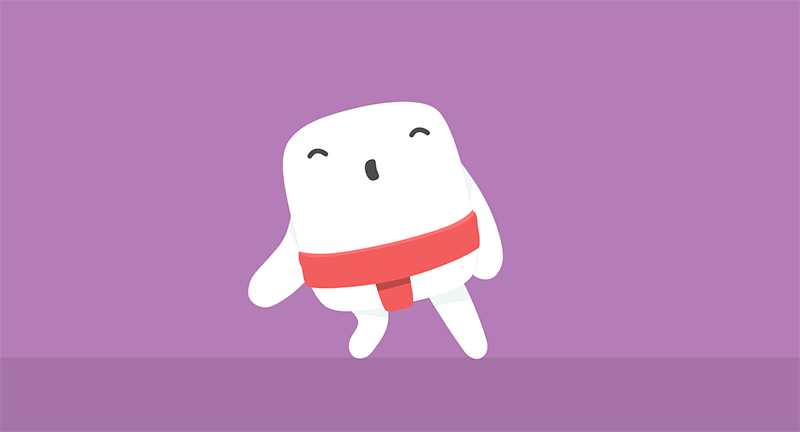
Jeden Samstag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Nicht immer neu, doch immer die Erwähnung wert. Heute mit Pusha-T, Mark Van Hoen und Say Sue Me.

Pusha-T – Daytona
Benedikt: Vorweg: Kanye hats immer noch drauf. Mr. West war für die komplette Produktion des 21-minütigen und sieben Tracks langen Albums „Daytona“ seines einstigen G.O.O.D. Music Signings verantwortlich – und das merkt man. Einstig, weil Pusha-T es mittlerweile vom gesignten Künstler zum Präsidenten des Labels gebracht hat. Dass Kanye aber nicht nur Produzent sondern auch kreatives Mastermind und musikalischer Architekt dieser Platte war, daraus macht selbst Pusha selbst keinen Hehl. Bis zuletzt habe Kanye dieses und jenes ändern wollen, ein paar Mal hätte er alles verworfen und komplett neu angefangen – sowieso, die große Kanye-Kunst des Samplings braucht das eben. Selbst das Cover wurde in der letzten Minute auf nochmal geändert. Der abgebildete Saustall ist Whitney Houstons Badezimmer, gute 80.000 Dollar soll das Bild gekostet haben. Pusha wollte nicht, also hat Kanye dafür allein geblecht. Und Pusha-T? Der tut was er immer tut. Mit seiner unverwechselbaren Stimme unendlich routiniert in Zwei- und Vierzeilern über das eigene Lebenswerk rappen – „Blew through thousands, we made millions / Cocaine soldiers, once civilians“. Eine amtliche Portion Hohn für den Rest. Mit Trump und Weinstein und politischen Andeutungen kommt thematisch ein bisschen US-Weltgeschehen dazu und zwischendurch natürlich immer wieder eingestreut: „Yuugh.“ Nie klang Pusha intensiver, nie waren die Beats besser. Warum nur 21 Minuten, warum nur sieben Tracks? Vielleicht, weil nächste Woche dann sieben Tracks von Kanye himself kommen, eine Woche später weitere sieben Tracks von Kid Cudi und Kanye: More G.O.O.D. Music is on the way. Wenn nicht doch wieder alles verworfen wird.

Mark Van Hoen – Invisible Threads
Thaddeus: Wenn Mark Van Hoen neue Musik veröffentlicht, ist das eigentlich immer eine gute Nachricht. Doch – Überraschung! – seine letzten Alben hatte ich überhaupt nicht mitgeschnitten: Der Bandcamp-Dschungel ist an einigen Stellen einfach zu dicht gewachsen, gerade wenn es um die Aufarbeitung eines über die Jahre stetig gewachsenen Archivs geht. Mark Van Hoen war mal bei Seefeel am Start. Veröffentlichte als Locust. Und ließ die Musik vieler eher akustischen Band elektronisch schimmern. Schimmern ist genau das richtige Stichwort bei seiner neuen Platte, die er dieser Tage auf Touch vorlegt. Ruhige und in sich ruhende Miniaturen, die dabei jedoch kontinuierlich mäandern und in den unterschiedlichsten Schattierungen brodeln, einem immer wieder die Hand reichen. Ob man sie wirklich ergreifen soll, bleibt aber bis zum Schluss rästelhaft. Es ist genau diese Stimmung, die Mark Van Hoen über die Jahre erst entwickelt und dann perfektioniert hat. Seine Musik ist wie ein Blick in eine andere Welt. Besser als das Hier und Jetzt, aber nicht frei von Makel. Damit erschafft der Musiker eine Art des Hyper-Realismus, ausgebreitet und arrangiert in einem komplexen Spiegelsaal der affirmativen Irritation. Oder ganz einfach gesprochen: In diesem Ambient-Skyscraper stoppen die Aufzüge ganz besonders sanft vor der Dachterrasse ab.

Say Sue Me – Where We Were Together
Susann: Mittlerweile ist es ja keine Neuigkeit mehr, dass die zeitgenössische Mode aussieht wie ein Pausenhof in den 1990er Jahren – auch der heutige Indie klingt verdächtig nach „damals“. Und irgendwie freut man sich ja auch darüber: Junge Hörer/innen entdecken, die älteren genießen ihre Komfortzone. Leichtgänger Indie Surf-Pop muss nun nicht zwangsläufig aus Kalifornien kommen, wie Say Sue Me, die in der südkoreanischen Hafenstadt Busan heimisch sind, zeigen. Ihr ambivalentes Verhältnis zu Südkoreas zweitgrößer Stadt greift Sängerin Sumi Choi in „Old Town“ auf: Everyone left this old fucking town / Only I’m getting old with this town / I just wanna stay here / But I wanna leave here. Das Albumcover, auch eher in analoger Filmästhetik vergangener Zeiten, zeigt die unmittelbare Umgebung ihres Proberaums. Apropos 90er: Wichtige Einflüsse der Band seien unter anderem Yo La Tengo und Pavement – zeitgenössische Indie Surf-Parallelen finden sich aber vor allem zu Bands wie Alvvays und Soccer Mommy. Und auch wenn die sprachunbegabten Ohren kein Wort verstehen, so sind die auf koreanisch gesungenen Songs fast am charmantesten (wie in „너와 나의 것 Ours“). Wie klangvoll die Sprache ist, hat hier in letzter Zeit ja schon Peggy Gou vorgemacht. Koreanischer Indie erobert jedenfalls mit diesem Album auch Europa und die USA, in Frankreich supporteten Say Sue Me schon Japanese Breakfast und spielten kürzlich ganze sieben Termine in Deutschland.