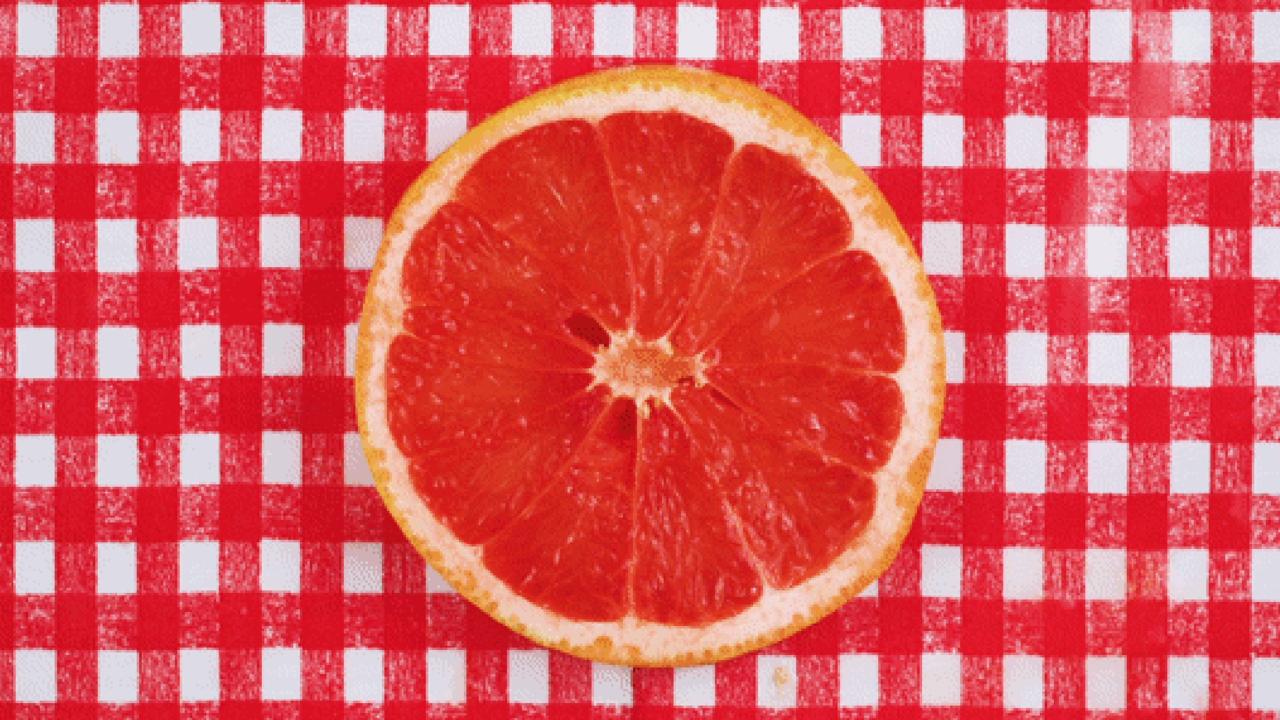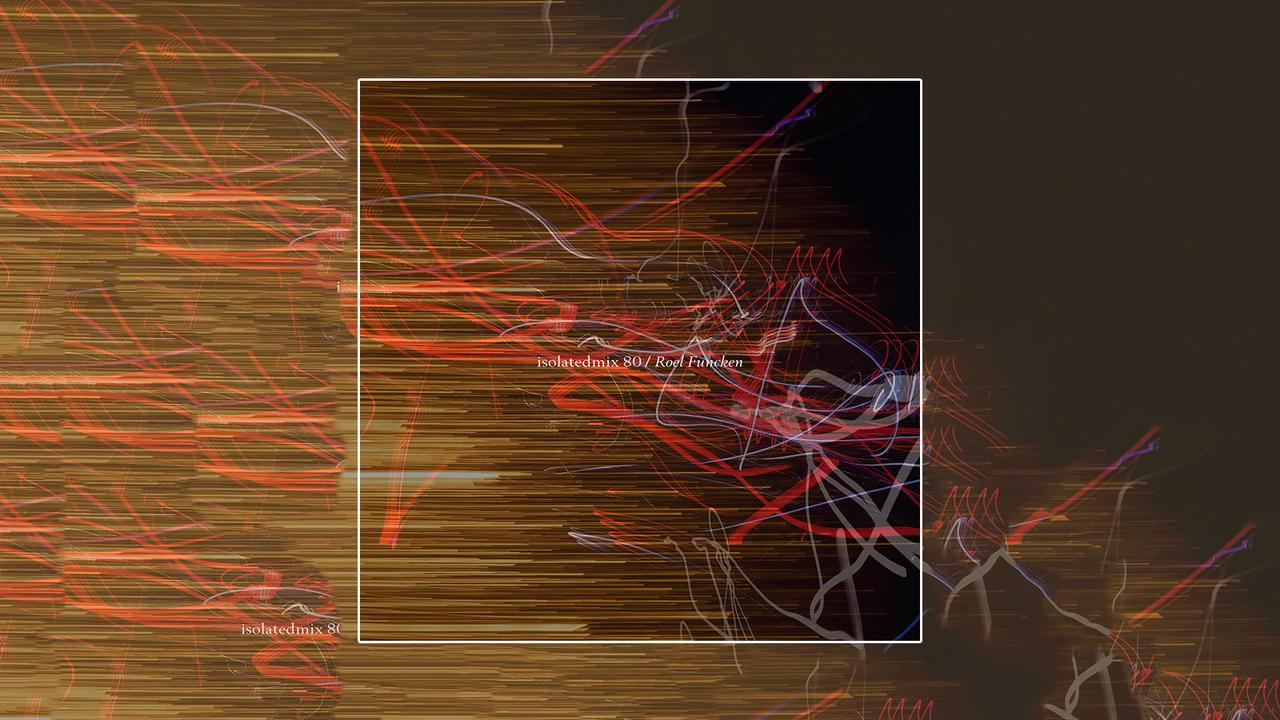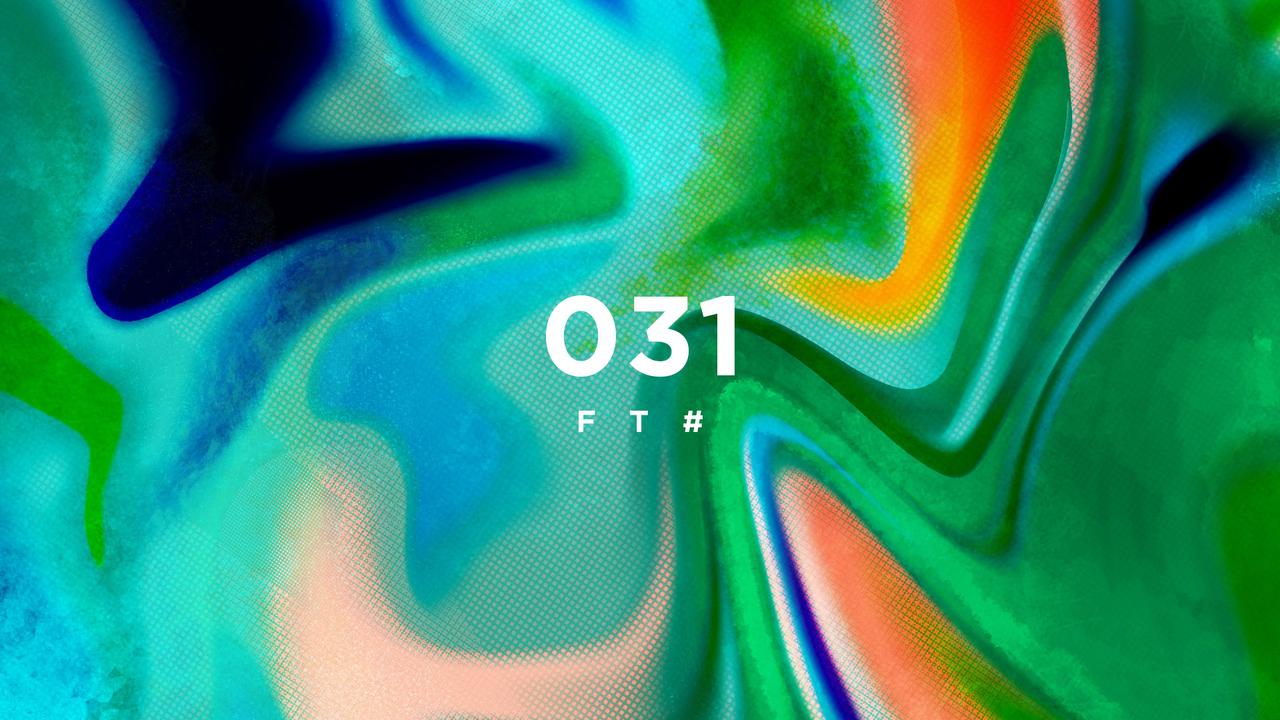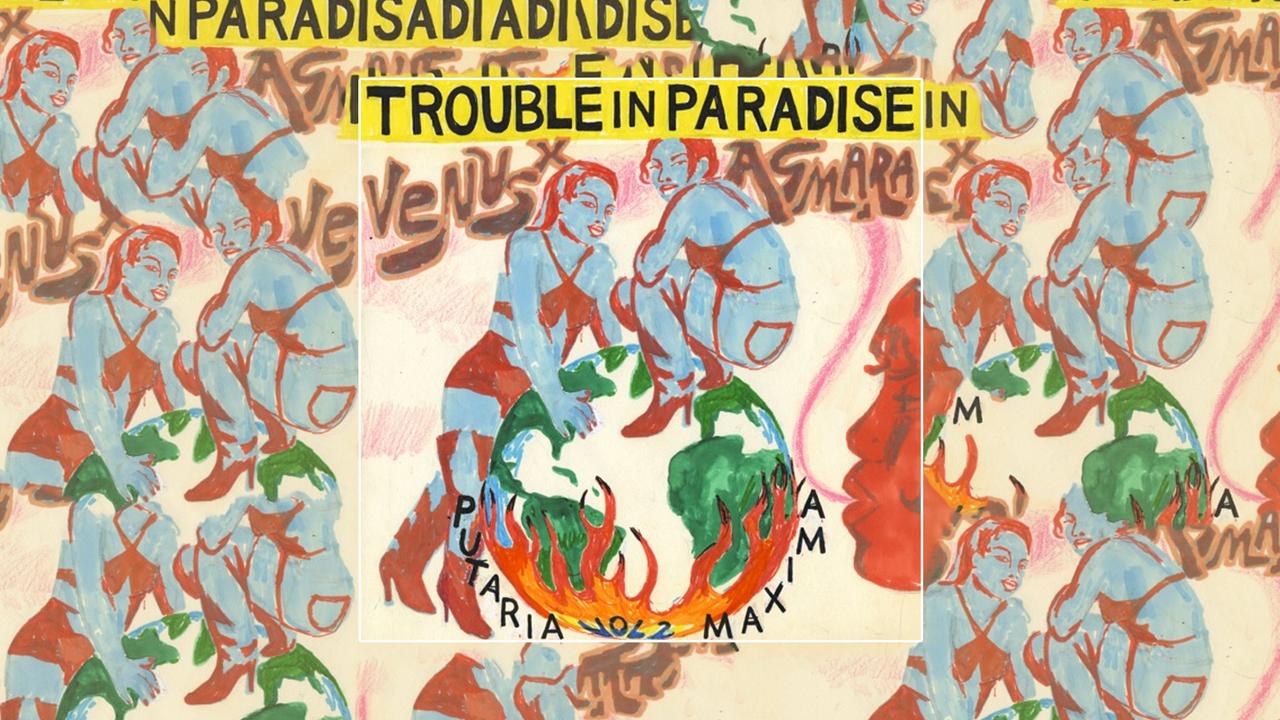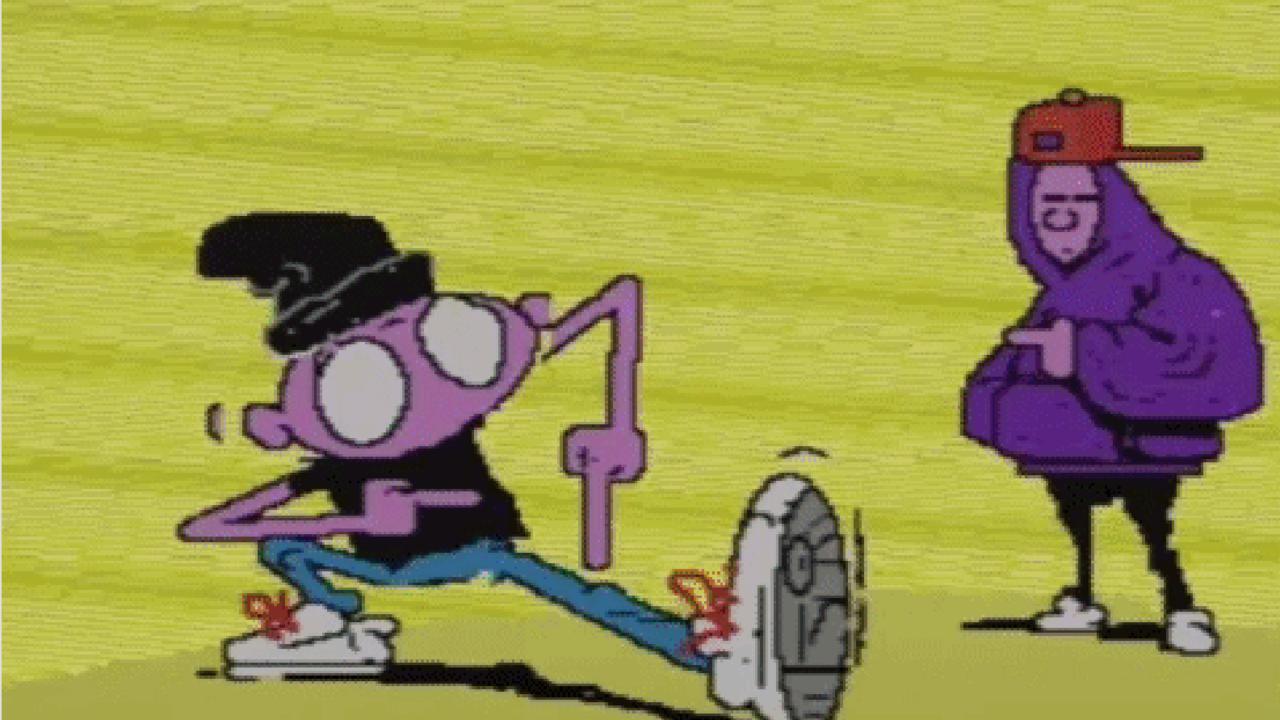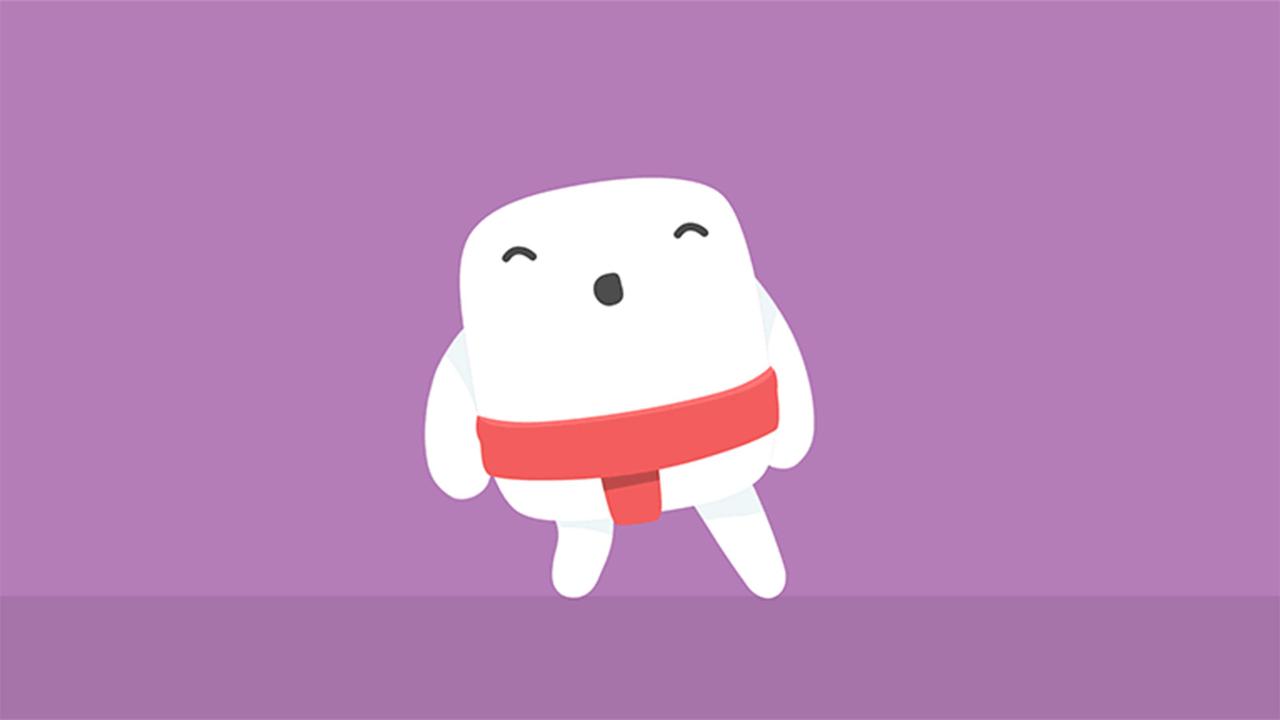Jeden Samstag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Nicht immer neu, doch immer die Erwähnung wert. Heute mit Drake, Casino Versus Japan und Topdown Dialectic.
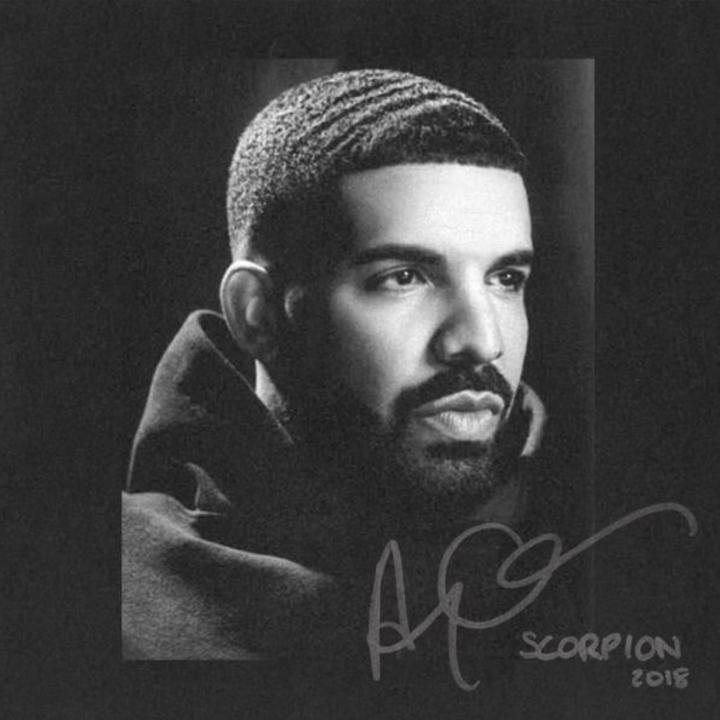
Drake – Scorpion
Benedikt: Hat die Welt auf ein neues Drake-Album gewartet? Nein. Musste es trotzdem kommen? Zweifellos. Nachdem Pusha T auf seinem vor einigen Wochen veröffentlichten Album „Daytona“ in dessen letztem Track „Infrared“ zum Schlag gegen Drake ausholte, und letzterer kaum 24 Stunden später mit dem großartigen „Puppy Freestyle“ antwortete, schien der A-Liga-Beef für kurze Zeit entschieden – zugunsten Aubrey Drake Grahams. Aber dann enthüllte Pusha T in TMZ-Manier im Diss-Track „The Story Of Adidon“, dass Drake ein bislang verheimlichtes Kind mit der ehemaligen französischen Porno-Darstellerin Sophie Brussaux habe, für das er monatlichen Unterhalt zahle. Während das bei manch anderem Rapper kaum eine Zeile wert wäre, kommt des bei Drake einer Entzauberung seiner künstlerischen Identität gleich. Er war doch der Frauenversteher, der Herzschmerztyp, Rapper der in Romantik ersoffenen Emotionen – und trotzdem von (fast) allen geachtet, mindestens aber respektiert – Ghostwriting-Vorwürfe hin oder her. Nun brennt das Kartenhaus. Zugegeben, bloß Teil eines Doppelhauses, in dessen anderer Hälfte der Erfolg wohnt. Und die steht stabil. „Scorpion“ hat zumindest beim Streaming-Dienst Spotify alle Rekorde geknackt, die sich in den ersten 24 Stunden nach Release brechen lassen. Vor allem auch, weil alle wissen wollten, was denn eigentlich los ist. Auf den 25 Tracks des Doppelalbums wird die Vaterschaft immer mal wieder eingestanden. Aber eine Zeile wie „I wasn’t hidin‘ my kid from the world / I was hidin‘ the world from my kid“, wirkt letztlich doch einer fahlen Ausrede ziemlich nah. Die Nachricht bezüglich des Kindes ist erst ein paar Wochen alt, viele Tracks dieses Albums sind älter. Und diese Differenzen sind spürbar, denn augenscheinlich ehrliche Momente, die Drake immer so gut konnte, wirken plötzlich nur noch halb so ehrlich. Musikalisch ist „Scorpions“ immer noch toll, dem Rapper Drake gilt die A-Seite, und spitten kann er ja, aber der Pop- und R’n’B-Künstler, der die weichere B-Seite tragen soll, hat verdammt viel seiner Strahlkraft eingebüßt. Credibility ist eben doch nicht ganz egal, wenn man sich ganz oben bewegt. Es bleibt abzuwarten, ob das Feuer doch noch übergreift und den bis dato ungebrochenen Erfolg zu Asche werden lässt. Dieses Album, dass fast wie eine Werkschau des bisherigen Schaffens wirkt, lässt diese Prognose nicht zu. Trotz großartiger Samples (Mariah Carey) und ungeahnter Gast-Stimmen (Michael Jackson).

Casino Versus Japan – Suicide By Sun
Ji-Hun: Seit 20 Jahren macht Erik Kowalski aus Milwaukee mittlerweile Musik als Casino Versus Japan. Ähnlich wie Fennesz oder Christian Kleine ist die E-Gitarre der primäre Klangerzeuger Kowalskis, was für den Klangkontext der elektronischen Musik noch immer eine Ausnahme ist und sich bewusst gegen die ästhetische Klischee-Vereinnahmung durch Rock, Metal oder Indie stellt. Casino Versus Japan hat für „Suicide By Sun“ 22 Tracks aufgenommen. Ambient, IDM, Loops durch Rückkopplungen, exzessiver Hall und Delay – retrofuturistische, aber durch die Saitenschwingungen menschliche Szenarien tun sich auf. In seiner Stringenz und mit seinem unnachahmlichen Sound ist „Suicide By Sun“ eine ganz wundervolle Ambient-Platte geworden. Ein guter Sommer braucht eben mehr als dünne Trap-Hits und Release-Orgien von Kanye, Drake und Co. Es braucht auch mal solch ausdrucksstarke und interpretationsoffene Skizzen wie die von Casino Versus Japan.

Topdown Dialectic – s/t
Thaddeus: Nichts Genaues weiß man nicht. Aber das gehört sich ja auch so im Post-Post-Post-Zucken des grau melierten Techno. Der namenlose Produzent legt hier acht Tracks vor – alle namenlos, alle gleich lang, alle irgendwie ähnlich und doch auch irgendwie unterschiedlich. Hier dominiert die sanfte Dekonstruktion, bzw. das sanfte Zusammenführen dekonstruierter Überbleibsel eines eindeutig identifizierbaren Erzählstrangs des Dancefloors. Federnd-fordernd muss der sein. Eine Haltung, die sich durchaus auf die Auseinandersetzung mit gleich mehreren Epochen und Strömungen strecken lässt. Die melodischen Elemente atmen Chain-Reaction-Rauschen (späte Phase) und den Geist derer, die diese Erbe bis heute pflegen. Aber: Dub ist das hier nicht. Zumindest nicht explizit. Dafür produziert Topdown Dialectic viel zu modern und am Sidechaining vorbei. Die Stücke haben etwas von einem außer Betrieb befindlichen Kühlhaus, in dem ein Heizstrahler die letzten Eiszapfen von der Decke geholt hat und nun nicht so recht weiß, wen er wärmen soll – vielleicht das zufällig eingespielte Vocal-Sample im kahl geschorenen Echo? Eine abstrakte Geschichte. Das dürfte auch der Grund sein, warum ich seit Wochen nicht mehr von dieser Platte wegkomme. Denn in diesem teilweise sehr konkreten Pool der Unklarheit entsteht ein Mikrokosmos, das zu genau dem Habitat werden könnte, nachdem alle schon so lange suchen. Auf dem Dancefloor und anderswo.