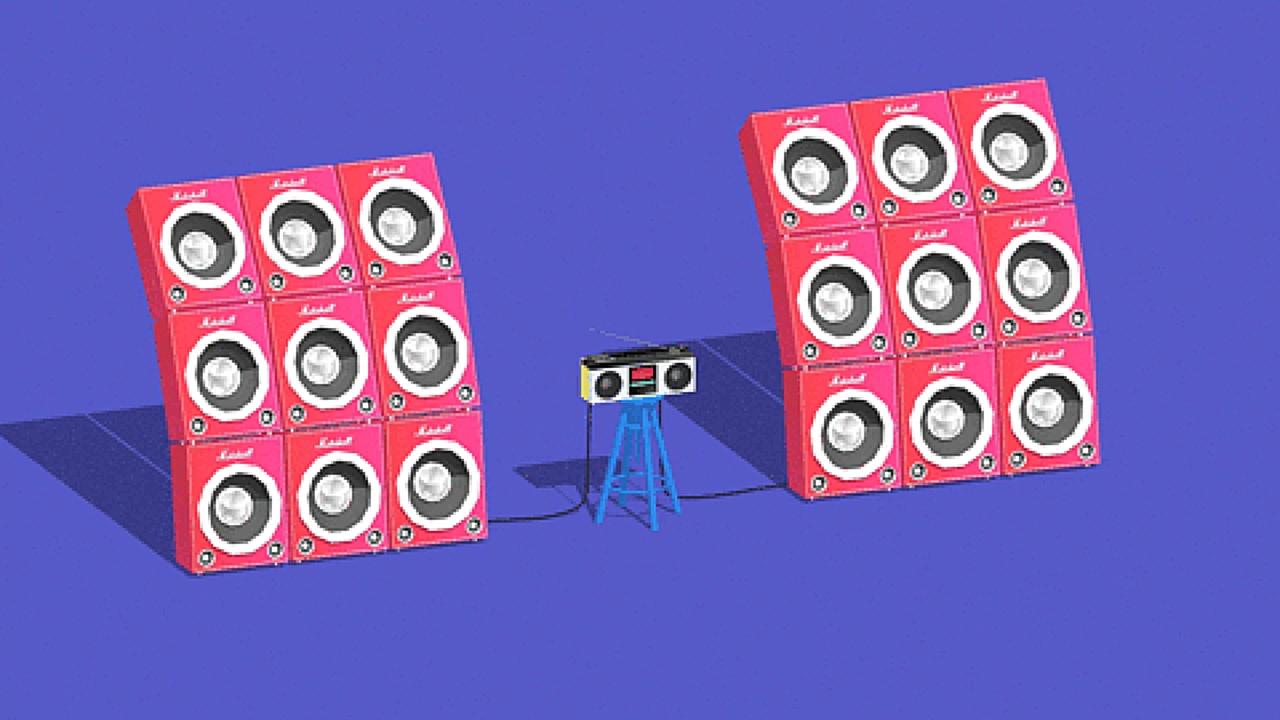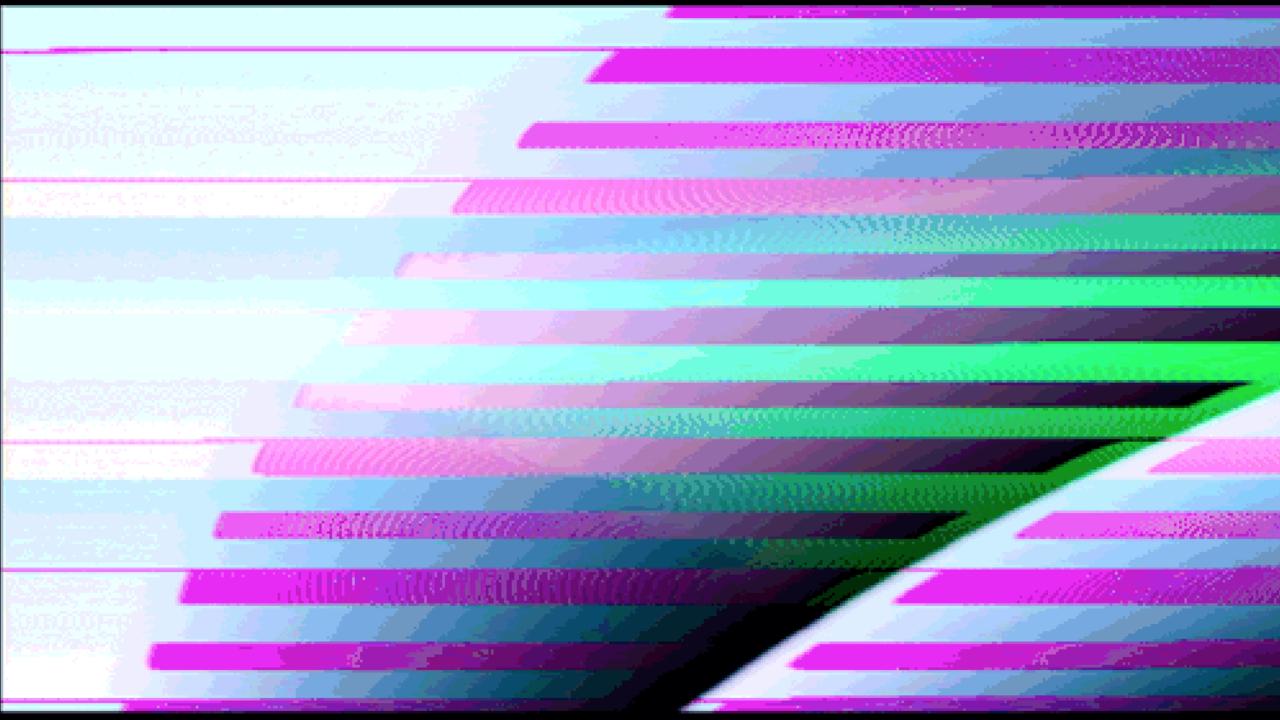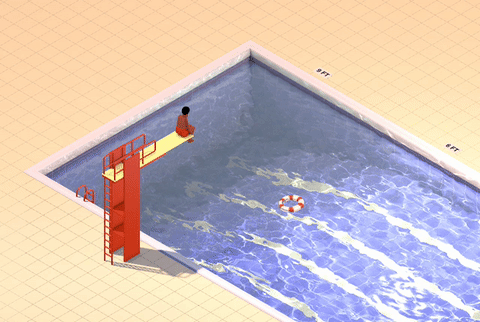
Jeden Samstag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Brandneu, wieder entdeckt oder aus der Geschichtskiste ausgebuddelt. Heute mit Dakota Suite, Dag Rosenqvist, Emanuele Errante, Bob Moses und Shinichi Atobe.

Dakota Suite, Dag Rosenqvist, Emanuele Errante – What Matters Most
Ji-Hun: Vor 20 Jahren erschien die erste Platte von Dakota Suite „Songs For A Barbed Wire Fence“. Heute ist das Album noch immer zeitlos, das betrifft aber auch alle anderen Langspieler des Projekts um Chris Hooson aus Leeds. Heute produziert Hooson Dakota-Suite-Alben mehr oder weniger in Eigenregie, hat sich für sein neues Album aber Künstler wie Dag Rosenqvist und Emanuele Errante mit ins Studio geholt. Die Songs auf „What Matters Most“ sind im Herzen noch immer irgendwie Slowcore. Harmonien werden getupft, die wassersäulenschwere Melancholie, die Räume zwischen den Akkorden, die Luft, das subtile Rauschen, das alles orchestriert Hooson mit wenigsten Mitteln immer noch meisterhaft. Ein wunderbares, hoch emotionales Album und das vielleicht vielschichtigste einer umfangreichen Diskografie eines famosen Songwriters.

Bob Moses – Battle Lines
Benedikt Bentler: Das kürzlich erschienene „Battle Lines“ von Bob Moses wäre fast an mir vorbeigegangen. Besser wär’s wohl auch gewesen. Denn jetzt komme ich nicht wirklich daran vorbei, über dieses Album zu schreiben, obwohl es wirklich kein gutes ist. „Battle Lines“ kaut wieder, was den beiden auf „Days Gone By“ 2015 noch richtig gut gelungen ist: Leicht verdauliche, jugendliche Melancholie – mitunter vielleicht ein bisschen weinerlich, aber schon ok – die sich dank dominanter Gitarre zwar als Indie-Musik klassifizieren lässt, aber mit butterweichem, elektronischem Unterbau ebenso gut im Club aufgehoben war. Das Debüt wurde zum echten Erfolg und vielleicht genau das zum Problem. Denn „Battle Lines“ lässt die Progressivität vermissen, die es dringend und offensichtlich gebraucht hätte, klingt mehr nach Neuauflage des Vorangegangenen, weniger nach Nachfolger und erst Recht nicht nach Fortschritt. Tom Howies Stimme erinnert nun nicht mehr bloß an Coldplays Chris Martin, der Band droht auch das gleiche Schicksal: Irrelevanz dank Repetition. Ich persönlich finde das unfassbar schade. Einerseits, weil die Jimmy Vallance und Tom Howie zwei echte Sympathen sind, andererseits weil ihre Live-Show damals unfassbar viel Power hatte und so grandios war, dass ich direkt wieder zum Konzert gehen würde – aller Enttäuschung übers jetzige Release zum Trotz.

Shinichi Atobe – Heat
Thaddeus: Je länger das mit der House Music nun schon geht, desto seltener finde ich Platten, die noch irgendetwas mit mir anstellen. Mich berühren, mich mitnehmen und dann wieder sanft absetzen. Ich fühle das Feeling nicht mehr. Oder andersherum: Immer mehr Producer fühlen ein anderes Feeling. Eine seltene, aber umso verlässlichere Ausnahme ist Shinichi Atobe, dem in dieser Kolumne schon Anfang Januar durchrauschte – aus gutem Grund. Dem Japaner gelingt es immer wieder, mich das Feeling wieder fühlen zu lassen. Das neue Album – wie immer in den vergangenen Jahren auf DDS, dem Label von Demdike Stare erschienen – versammelt Tracks, die einerseits so klassisch und oldschool sind, dass man das Feeling nicht los wird, die Stücke alle schon im Regal stehen zu haben. Das ist mit Sicherheit nicht beabsichtigt, sondern vielmehr Indiz dafür, dass die Musik von Atobe jeder Deutungshoheit überlegen ist. Arrangements? Fehlanzeige. Dramaturgie? Fehlanzeige. Aufbau? Ganz einfach. Spur rein, noch eine, Spur raus, fertig. In dieser geplanten Einfachheit entwickeln sich so Loops, die erst im Kopf zu solchen werden. Man klammert sich an die kleine Zutat, auf die das eigene Herz in diesem Moment anspringt, und lässt sie nicht mehr los. Eine derart konstante Euphorie ist besser als alles andere. Weil man nie auf den einen Moment warten muss – der ist immer schon da. Das Label fasst es prägnant zusammen: „There’s no sonic fiction involved. Sparse info, no messing, pure gold.“ So ist es. Genau so.