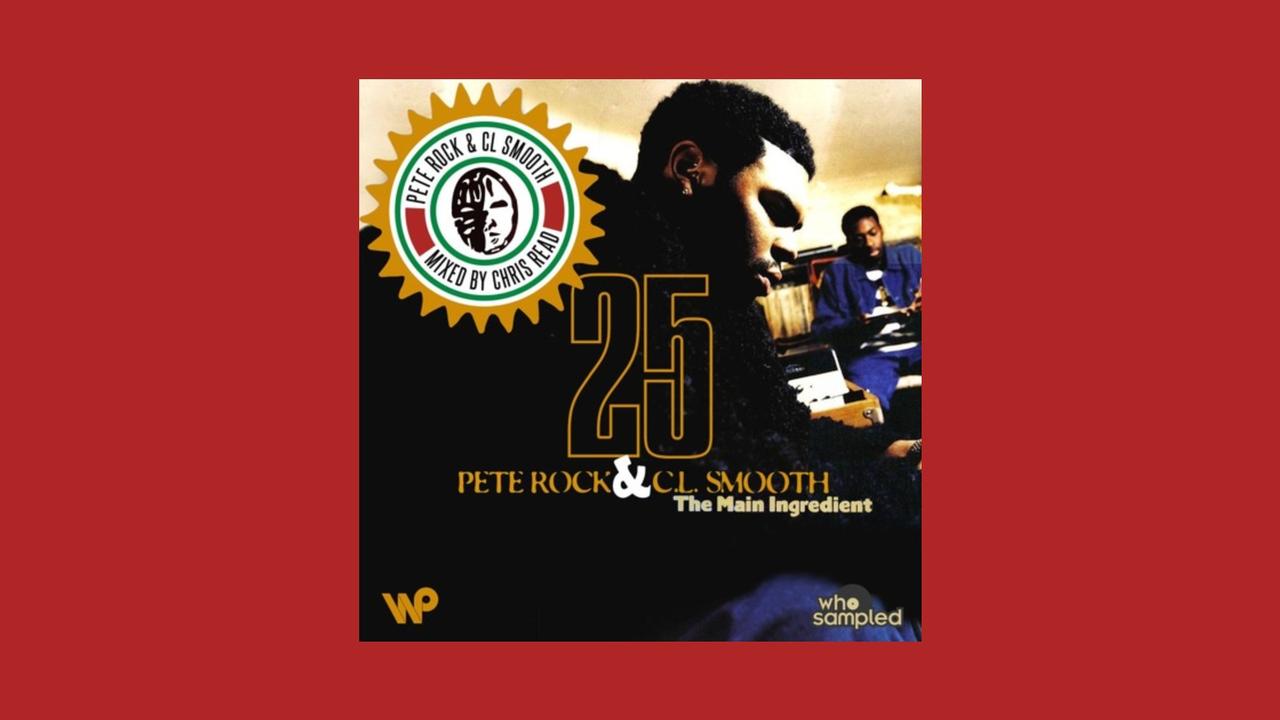Jeden Samstag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Nicht immer neu, doch immer die Erwähnung wert. Heute mit: 070 Shake, Pet Shop Boys und Phase Fatale.

070 Shake – Modus Vivendi
Elisabeth Giesemann: Autotune ist the new normal und die geilste Erfindung seit der Erfindung von HipHop. Denn Autotune ist die beste Art, den Mensch beziehungsweise die Stimme vom Körper zu entfernen. Auf dem Album „Modus Vivendi“ werden mit dieser Stimme diverse dunkle Gefühlszustände besungen und ins afrofuturistische Universum befördert. Denn wie sonst sollte eine Frau im Jahr 2020 starke Gefühle transportieren, wenn nicht als Androidin? Die androgyne Stimme gehört 070 Shake, die seit ihrer großartigen COLORS-Performance klar gemacht hat, dass sie auch ohne ihre Entdecker Kanye und Pusha-T von den Socken hauen kann. Das Album-Cover, das sie im Metropolis-Outfit zeigt, verstärkt den Eindruck von Utopie. Jedoch muss man eingestehen, dass abseits der Raumfahrt die Texte vor allem von klassischen Themen wie Trennung, Eifersucht und Drogenkonsum handeln. Aber das Gute an HipHop ist ja, dass Themen eben auch auf der Ebene Sound und Video behandelt werden.
Ein solches Video gibt es zur 80s-inspirierten Single „Guilty Conscious“ und „The Pines“, und in beiden sieht man 070 Shake, junge Männer und Gewalt. Shake beschreibt in einem Statement am Anfang von „Guilty Conscious“, dass sie mit den prügelnden Jungs einen psychologischen Abwehrmechanismus darstellen wollte, den man landläufig als fragile masculinity bezeichnet. Allerdings hat sie neben ihren Produzenten auch keinen der Männer aus der 070-Crew oder gar die ihr wohlgesonnenen Megastars auf das Album gelassen. Es ist zu 100 Prozent ihres. Modus Viviendi bezeichnet ja eigentlich eine Übereinkunft zweier unterschiedlicher Parteien. Bei dem Album hat man allerdings das starke Gefühl, dass die dunkle Seite gewonnen hat. Songs wie „Microdosing“ oder „The Pines“, eine Interpretation des Folk-Klassikers „Where did you sleep last night“, klingen wie Voodoo-artige Beschwörungen. Es bleibt, dass manche Titel des Spacetrips ein wenig in einem Geschwurbel aus scary und sexy Samples untergehen, aber so ein Album kann ja auch nicht ausschließlich aus Sternen bestehen.

Pet Shop Boys – Hotspot
Jan-Peter: Ein neues Album der Band, die man immer lieben wird, auch wenn sie, bei aller Liebe, nicht gerade in Würde altert. Das letzte Album mussten Ebenso-Fanboy Sulgi Lie und ich ja ziemlich zerpflücken. Die kürzlich erschienene EP „Agenda“ – ein grelles Desaster. Was also bringt „Hotspot“? Der Opener „Will O the wisp“, was zu deutsch übrigens Irrlicht heißt – herrje. Bitte nicht schon wieder stumpfer Dancepop. Das Flackern führt geradewegs in den Sumpf. Mittendrin hört man die BVG-Stimme, die die Haltestelle Hallesches Tor ankündigt. Der Flirt der Boys mit Berlin währt ja schon ein paar Jahre, sie leben zum Teil hier. Und auch, wenn sie für mich ewig irgendwo nahe King's Cross im Nebel stehen werden, so ist das doch sympathisch, dass sie es hier „bei uns“ so mögen. „You Are The One“ ist dann nicht etwa ein Cover des – wundbar poppigen – Aha-Songs, das hätte ich spannend gefunden, sondern eine Hommage an Berlin, von Mitte bis „Sellendoarrf“. Meinetwegen. „Happy People“ ist janz nett, ebenso die erste Single „Dreamland“ mit Alexanderplatz-U-Bahn-Video. Das beste Stück des Albums ist „Hoping for a miracle“, besonders nach hinten raus kommen alte Akkord-Arrangements ins Spiel, mit denen Tennant und Lowe berühmt geworden sind, bevor Stuart Price sie auf eine bedauerliche Nineties-Pastiche getrimmt hat. Ebenso „Only the dark“, das über weite Strecken verdammt nach „Jealousy“ klingt. „Burning the heather“ wäre ein gefälliger Abschluss, aber dann kommt noch „Wedding in Berlin“. Und damit ist leider nicht der Stadtteil gemeint, sondern echt das Heiraten, inklusive Mendelssohn Bartholdys Hochzeitsmarsch über einem funky beat. Es mag inhaltlich um #ehefüralle gehen, fair enough, aber deswegen muss man sich nicht gleich zum Horst machen. Danke aber für ein paar nette neue Lieder. Immerhin.

Phase Fatale – Scanning Backwards
Benedikt: Ich erwische mich immer öfter in seltsamer musikalischen Genügsamkeit. Es muss längst nicht immer so abgefahren ausgefallen und die Erwartungen übertreffend vonstatten gehen, wie in [der letzten Woche]. Woran liegt das? Ist das so ein Ding, das mit dem Erreichen der dritten Dekade des Lebens schleichend Einzug hält? Der Beginn eines musikalischen Altherren-Geschmacks, in dem es sich weitestgehend bequem gemacht wird, nur damit die angeblich so seltene Ausnahme dann so richtig exaltiert zelebriert werden kann, was mit Blick auf die eigene Rolle als kritischer Beobachter zeitgenössischer Kultur sozusagen den Anfang vom Ende darstellen dürfte? Hoffentlich ist dem nicht so. Die neue Platte von Phase Fatale macht nichts neu – gar nichts. Hier werden einmal mehr Industrial und EBM für den Techno beackert, ohne jede Experimentierfreude einerseits, aber dafür auch ohne die oft misslingende Suchen nach der eigenen Differenzierung nur um der Differenzierung willen. Selbstverständlich ist „Scanning Backwards“ astrein ausproduziert, wie es sich für einen Berghain-Resident geziemt, wenn auch auf relativ geringer BPM-Zahl. Das Ding ist: Ich liebe diese Platte. Die industriell stampfende Kick, die verzogenen Drums, die düster gärenden, voluminösen Synthesizer. Dieser Sound ist mein Dancefloor, weshalb ich die LP wenig kritisch und noch weniger aus der Rolle des Beobachters rezipieren kann. Nee. Hier stürz ich mich einfach kopfüber rein und tauche nach acht Tracks ganz glücklich wieder auf.