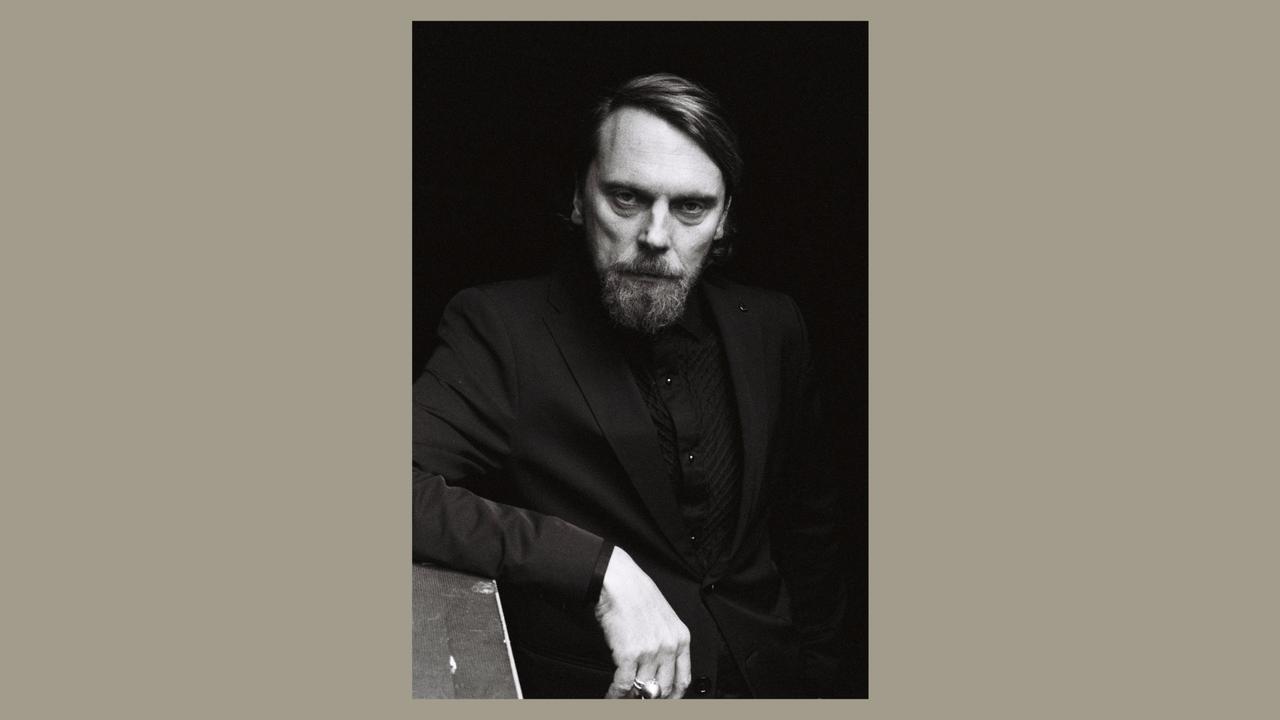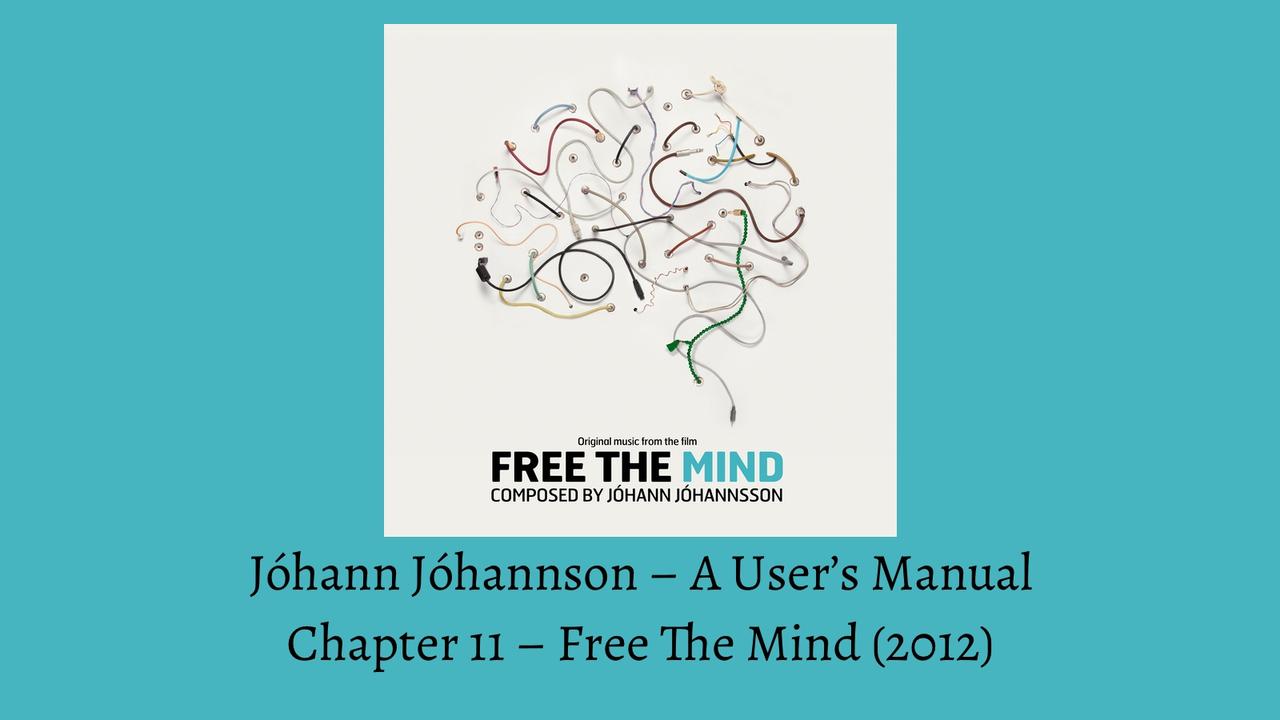„Warum genau mache ich nochmal Musik?“Nils Frahm im Interview
19.9.2022 • Sounds – Interview: Thaddeus Herrmann
Fotos: Promo / Leiter Verlag
„Music For Animals“ heißt das neue Album von Nils Frahm. Drei Stunden und sieben Minuten sanfte Soundscapes. Klavier? Fehlanzeige. Beats? Ebenso. Akustik vs. Elektronik? Passé. Das klingt nach einem fundamentalen Wandel im künstlerischen Selbstverständnis. Und doch ist die Geschichte eine ganz andere. Thaddeus Herrmann hat den Musiker in seinem Studio im Berliner Funkhaus besucht.
Auf dem Gelände des Funkhaus Berlin wachen gerade alle auf. Start-uper:innen strömen in die neu restaurierten Büros, die Milchbar hat schon offen. Was hat sich dieses Areal in den vergangenen Jahren gewandelt! Hier, am gefühlten Ende der Berliner Welt, gab Innovation immer den Ton an. Der Rundfunk der DDR hatte hier sein Hauptquartier, mit bester Technik und weltweit konkurrenzloser Akustik. Das gilt bis heute. Seit 2016 arbeitet Nils Frahm im „Saal 3“ des Gebäudekomplexes, dessen ungenutzte Flächen, Gebäude, Räume und Hallen Schritt für Schritt umgewidmet werden. Berliner:innen verirren sich mehr oder weniger regelmäßig hier hinaus, nach Oberschöneweide, in die Nalepastraße. Für ein Konzert im legendären „Saal 1“ (ob für Depeche Mode, Jóhann Jóhannsson, LCD Soundsystem, Wolfgang Voigt oder eben auch Nils Frahm) oder andere Events.
Es ist der Morgen eines der letzten Sommertage in Berlin. Der Journalist sitzt am Wasser auf einer Bierbank, der Musiker winkt, wir laufen um die Ecke und steigen durch ein ebenerdiges Fenster in den Korridor, von dem zahlreiche Studios und Aufnahmeräume abgehen. „Nicht den Kopf stoßen!“ Auf diesen Fluren lag nie Linoleum, in das der so DDR-typische Reinigungsmittelgeruch hätte einziehen können. Hier wurde immer nur maximal gewedelt und poliert. Alles in diesem Teil des Areals ist perfekt. So wie damals. Es knirscht, es knarzt, es lebt. Auch wenn die Fenster – bestimmt denkmalgeschützt – dem Klimaschutz keinen Gefallen tun.
Es ist still, nur die Kaffeemaschine macht kurz Geräusch und die Ventilatoren laufen. Zeit für eine Bestandsaufnahme der Marke Nils Frahm. Die ging steil durch die Decke in den vergangenen Jahren. Frahm hat an seiner Karriere und seinen Ideen konsequent gearbeitet. Dass daraus jedoch ein popkulturelles Phänomen werden würde, war nicht klar. Zahlreiche Welttourneen später kommt der 41-Jährige mit einem Album um die Ecke, das per se nicht in die von vermeintlichen Auskenner:innen projizierte Laufbahn des Musikers passt. „Music For Animals“ ist eine wundervoll stille Platte. Noch viel stiller und intimer als seine Solo-Piano-Arbeiten je hätten sein können. Wie geht das? Und worum geht es überhaupt? Der Kaffee ist eingegossen, das Smartphone zeichnet auf.
Eigentlich dachte ich ja, wir könnten hier draußen in Berlin-Oberschöneweide einfach eine Stunde lang über den beruhigenden Puls des Arpeggiators abnerden. Das wäre aber vielleicht selbst für unsere Leser:innen etwas zu viel. Lass uns also über den Elefanten im Raum sprechen: die Pandemie und die musikalischen Folgen. Die Zwangspause für Menschen im Allgemeinen und u.a. für Musiker:innen im Besonderen. Du wirst im Info für dein neues Album zitiert: „Es passierte einfach nichts.“ Wie ging es dir damit?
Ich war natürlich genervt. Und hatte ein Autoritätsproblem. Ich wollte eine Pause machen, das war klar. Und dann wurde sie mir verordnet. Faktisch war das egal. Will sagen: Ich hatte totales Glück. Ich wollte ja nicht auf Tour gehen, im Gegenteil: Wir kamen gerade von einer riesigen Tournee zurück. Ich habe Urlaub gemacht und dann kam das Virus. Ich wollte diese Pause also, wir hatten das auch intern besprochen. Ein Jahr, wenn nicht anderthalb Jahre Pause.
Du sprichst von der Tour zu deinem letzten Album „All Melody“. Wie viele Shows habt ihr gespielt?
Ungefähr 200. Das war schon was. Hart. Lang. Ich hatte gen Ende ein diffuses Gefühl, dass diese Tour vielleicht das letzte Mal überhaupt sei, dass es so rummst. Die letzte Show war in Australien. Wir flogen zurück, gen Heimat, und ganz Australien brannte. Ich hatte damals das Gefühl: Okay, das war das letzte Mal. Das Selbstverständnis, die Energie wird zukünftig anders sein. Aktuell bereiten wir wieder eine Tour vor, und diese Gefühl von damals ist geblieben. Dieser Moment des Lift-Offs in Australien ist geblieben.
„All Melody“ ist mir als Album immer fremd geblieben. Ich habe mich damals selber immer mehr beschleunigt in meinem Tun, in der Verbindung ganz unterschiedlicher musikalischer Motive.
Kannst du das genauer beschreiben? Für mich klingt das so, als wäre dir alles zu viel geworden. Zu anstrengend. Eine Nummer zu groß.
Ich wusste damals schon, dass ich auf kommenden Tourneen nicht noch mehr Instrumente hätte mitnehmen wollen, oder meine Musik gar mit einem Orchester zu performen. Ich dachte darüber nach, wie ich zukünftig unter diesem Konstrukt vielleicht durchtauchen könnte. Ich wollte Räume falten, anstatt sie selbst zu besuchen. Maß und Mittel. Wie sich das musikalisch anfühlen und anhören könnte ... ich hatte keine Idee. Auf ein paar Alben, wie „Screws“, hatte ich diesen Weg ja schon verfolgt: nur Klavier, ganz reduziert. Aber im Frühjahr 2020 war das alles recht diffus. Wir haben das dann intern besprochen. Der Betrieb von früher ließ sich nicht aufrecht erhalten. Das Studio schon, aber viele mussten sich etwas anderes suchen. Zum Glück haben auch alle etwas gefunden. Ich war mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht sicher, ob ich jemals wieder auf Tour gehen würde. Ich war an einem Scheidepunkt. „All Melody“ ist mir als Album immer fremd geblieben. Ich habe mich damals selber immer mehr beschleunigt in meinem Tun, in der Verbindung ganz unterschiedlicher musikalischer Motive. Wie ein Techno-Track zum Klavier passt, wie komplex Musik sein kann und in diesem Fall auch sein musste, damit es funktioniert und nicht auseinander fällt. Ja, da steckt viel Arbeit drin, aber hören möchte ich es bis heute eigentlich nicht. Das ist eine Art der Verzweiflung. Kann man so machen, klar. Es lag mir aber nicht nahe, so etwas noch einmal zu versuchen. Ich wollte also etwas verändern.
Wie ging das vonstatten?
Aufräumen. Und zwar ganz praktisch in der eigenen Musik. Ich bin quasi in mein eigenes Archiv gestiegen. Als kreativer Mensch kannst du dich jeden Tag dazu entscheiden, einen neuen Track zu schreiben oder eben auch zurückzuschauen, Musik reflektieren, die du vor zehn Jahren gemacht hast, erneut anfassen und in ein neues Licht stellen. Vielleicht ist Letzteres besser. Du rettest dich in deine Skizzen von damals. Weil du spürst, dass das, was du aktuell sagst, ausdrückst oder produzierst, nicht funktioniert. Die alten Tracks waren einfach besser als alles, was ich nach der Tour hätte produzieren können.

Das ist eine Erkenntnis, die nicht ohne Spuren an einem vorbeigeht, nehme ich an.
Ja, das war schon schwierig. Aber auch günstig. Wenn du selbst spürst, dass du kreativ am Boden liegst, kann es ja eigentlich nur noch besser werden, also bergauf gehen. Ich kannte dieses Phänomen ja auch bereits aus anderen Phasen. Kreativität kommt in Wellen, das habe ich mittlerweile gelernt. So lapidar das klingt: Ich habe die ersten Monate der Pandemie damit verbracht, meine Festplatte aufzuräumen. Ich habe bestimmte Dinge abgeschlossen, die noch nicht ganz fertig waren, frühe Releases neu gemastert, wieder veröffentlicht, so sie denn vergriffen waren. Das hatte schon etwas von Nachlassverwaltung. Aber mir war es wichtig, diese Phase meines Lebens als Musiker abzuschließen und in eine Schublade packen zu können. Nach dem Motto: Da muss ich nicht mehr ran. Und sollte mir mal etwas passieren, meine Frau oder mein Manager auch nicht. Diese Vorstellung trieb mich um. Waren da nicht noch ein paar gute Songs von 2011? Und welche Mixe sind jetzt die besten? Ein absoluter Albtraum für mich. Als großer Fan von Arthur Russell habe ich miterlebt, wie mit seinem Werk umgegangen und was posthum veröffentlicht wurde.
Für dich ist es Arthur Russell, für mich Jóhann Jóhannsson. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ihm recht wäre, was von ihm aktuell immer noch veröffentlicht wird.
Genau darüber habe ich auch mit Freunden und meiner Familie gesprochen. Da ist nichts mehr. Es ist alles geregelt. Die Festplatten sind abgestöpselt, ich habe 2022 frisch angefangen. Der ganze Haufen ist geklärt.
Du erzählst das alles sehr reflektiert und abgeklärt. Mich beschäftigt die Geschichte dahinter. Die klingt wie ein radikaler Bruch in deiner künstlerischen Vita.
Es ist eher ein Orientierungspunkt. Ansonsten beginnen Dinge einfach zu verschwimmen. Brüche sind wichtig. Die sind wie kleine Tattoos, an die du dich immer wieder erinnerst und einfach bleiben. Ich freue mich ja auch schon wieder darauf, mit der neuen Platte live zu spielen. Und vielleicht stelle ich trotzdem noch ein Instrument mehr auf die Bühne. Aber Dinge haben sich auch geändert. Ich sah kürzlich eine tolle Doku über Don Cherry, die ihn praktisch ausschließlich in New York zeigt und thematisiert, wie er mit dieser Stadt einfach nicht hinkommt. Die Kamera begleitet ihn, wie er mit seiner Taschentrompete durch die Stadt zieht und mit den Menschen einfach spielt und tanzt. Und sie dazu animiert, einfach mitzumachen: Ihr seid keine Roboter, schaut mal, so geht es auch. Ich habe dabei fast geweint. Ich habe das gefühlt. Der selbstverständliche Einsatz von Technologie, dieses ewige Ineinanderstecken funktioniert nicht. Das provoziert das Artifizielle, die Instabilität. Natürlich kannst du dich da reindrehen, aber letztendlich verstärkt es nur das Artifizielle.
Ich muss da reingrätschen. Interessiert dich der technische Fortschritt nicht mehr so wie früher? Oder inspiriert er dich einfach nicht mehr?
Ja, vielleicht. Aber das hat ja eine Ursache, die noch spannender ist. Vor ein paar Jahren wäre ich noch ausgerastet vor Freude, wenn plötzlich ein neues Mischpult hier gestanden hätte. Das ist eine Frage der Haltung. Heute komme ich hier ins Studio, und denke eher: Hmm, warum steht hier keine Pflanze, warum gibt es keine Fenster? Ich will gar nicht zurück in „meine Bubble“. Ich habe Rückenschmerzen und würde mir viel lieber eine Schaufel schnappen, um eine Grube auszuheben. Das ist eine Frage der Balance. Warum ist vom einen immer zu viel da und vom anderen zu wenig? Das war damals ja auch der Grund, warum ich nicht acht Stunden pro Tag Klavier gespielt habe. Meine Lehrer wollten das. Du hast Talent, jetzt mach mal. Das hätte bestimmt auch funktioniert, war für mich aber immer unvorstellbar. So ähnlich fühle ich mich aktuell. Ich schaue eine Dokumentation über mich selbst und denke: Huch, das entwickelt sich alles in die falsche Richtung. Warum genau mache ich nochmal Musik? Und da schließt sich der Kreis in gewisser Weise – zum neuen Album „Music For Animals“.

Ja, da steht ein tolles Klavier und es ist genauso toll mikrofoniert. Kling super. War gestern so, heute auch und morgen immer noch. Na und?
Inwiefern?
Für mich war das wie eine Heilung. Ich saß im Studio und meiner Frau fiel während der Pandemie zu Hause die Decke auf den Kopf. Also kam sie rum. Hier haben wir immerhin hohe Decken und einen großen Raum. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt die Glasorgel als neues Instrument. Ich zeigte ihr es, sie spielte und ich dachte: Das ist total schön. Ich habe erst ganz intensiv zugehört und dann Schritt für Schritt ganz wenig dazu zu spielen. Mich hat das wirklich mitgerissen. Meine Frau ist keine Musikerin, sie ist da ganz intuitiv rangegangen. Es war wunderbar, das zu erleben, diese Glücksmomente bei ihr. In diesen Sessions wurde mir klar, dass mich immer weniger beeindruckt. Ja, da steht ein tolles Klavier und es ist genauso toll mikrofoniert. Kling super. War gestern so, heute auch und morgen immer noch. Na und?
Standards. Die ergeben sich automatisch.
Und sich den Abstand genau dazu zu bewahren, ist schwierig. Es gibt keine Musik, die per se gut ist. Das entscheidest allein du. Du musst es schaffen, es toll zu finden. Die Sessions mit meiner Frau hier im Studio haben mir gezeigt, worum es mein Musikmachen eigentlich geht. Den Moment, die Kommunikation. Dass diese Sessions zu einem Album werden könnten ... darum ging es gar nicht. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass man das rausbringen könnte. Vielleicht auch sollte. Ich verstehe meine Platten eh als eine Art musikalisches Tagebuch. Und ganz ehrlich: Wir haben praktisch ein Jahr nichts anderes gemacht, als hier zu spielen.
Wann hast du zum ersten Mal auf Aufnahme gedrückt?
Von Anfang an. Ich nehme immer alles auf.
Machst du dir damit selber Druck?
Ich habe mir das irgendwann angewöhnt. Die ersten Momente am Instrument sind oft entscheidend. Wenn du dann merkst: Oh, das nehme ich jetzt auf und erst einmal aufstehst, ein Mikro holst, ein Kabel, dann funktioniert etwas nicht ... eine halbe Stunde später ist genau dieser erste Moment weg und nicht mehr reproduzierbar. Wegschmeißen kann ich hinterher ja immer. Eine Routine bei mir ist auch, abends nochmal alles durchzuhören und bestimmte Passagen farblich zu markieren. Das war auch bei „Music For Animals“ wichtig. Wir hatten gen Ende bestimmt 50 Stunden Material. Das zu sichten, war eine große Aufnahme. Die Musik lief ständig, auch zu Hause, war unser Pandemie-Soundtrack. So wurde die Platte erst zum Projekt und gleichzeitig spürte ich auch, dass es das erste Projekt seit langer Zeit war, das mich nicht innerlich zerrissen hat. Im Gegenteil: Es hat mich zusammengebaut. Projekte oder Alben haben bei mir früher eher gegensätzlich funktioniert. Da war immer eine gewisse Fliehkraft, gegen die ich ankämpfen musste. Hier hat mich nichts gestört. Ich hörte keine Fehler, keine falschen Töne.

Hattest du diese Schere im musikalischen Kopf schon immer oder hat sich das mit der Zeit herauskristallisiert? Letzteres wäre ja nur verständlich und auch verständlich, eine Konsequenz des immer größeren Erfolgs.
Ich will „Falsches“ eigentlich nicht wegschneiden. Ich habe mit den Jahren als Produzent aber gelernt, ganz genau zu benennen, welche Passagen oder Aspekte ich in einem Stück problematisch finde. Timing, Lautstärke, der Ton an sich. Das hat zunächst ja nichts mit der Musik zu tun. Du sitzt einem großen Fan von Thelonious Monk gegenüber. Es muss nur in sich passen. Dafür habe ich im Laufe des Jahre ein Gefühl entwickelt. Ich kann heute Probleme für mich klar benennen, früher fiel mir das schwer. Beim Mixing zum Beispiel: Ich merkte, dass mir die Version nicht gefällt, konnte aber nicht identifizieren, woran es lag. Bei „Music For Animals“ wollte ich praktisch nichts wegschmeißen. Und wenn, dann immer Passagen von mir, in denen ich mich verspielt hatte. Auch das war neu für mich. Ich spiele und habe oft Sessions mit anderen Musiker:innen. Und da ist dann für eine Stunde richtig viel Sound, es fühlt sich gut an, und beim Durchhören bleiben dann fünf Minuten. Für mich geht die Platte schon fast in den Bereich der Therapie. Es ist also bis zu einem gewissen Grat funktionale Musik. So entstand auch der Titel „Music For Animals“, was natürlich eine Anspielung auf die Playlisten bei Spotify und Co. ist. Musik für jede nur mögliche Gelegenheit. Also haben wir einfach unsere eigene Playlist gemacht, unser eigenes Spotify. Und wenn die drei Stunden, die jetzt veröffentlicht werden, nicht reichen: kein Problem. Gibt noch reichlich mehr. In diesem Kontext finde ich die Idee von Musik, die eher als Bild funktioniert, charmant. Sie ist immer da, du musst aber nicht ständig hingucken, dich darauf bewusst einlassen. Mir war Musik in der Vergangenheit vielleicht einfach zu intensiv.
Ich kann das wertschätzen und nachvollziehen. Musik so um sich zu haben, ist wundervoll. Ich merke aber regelmäßig in Gesprächen, dass genau diese Herangehensweise an Musik vielen nicht ausreicht. Es gibt geringe bis gar keine Reibung. Das „Plätschern“, um einen besonders despektierlichen Begriff zu droppen, disqualifiziert das Werk kategorisch. Nur in der Reibung, dem Clash von was auch immer, entsteht Kunst. Ich habe diese Haltung nie verstanden.
Das Neue macht Musik interessant. Das war schon immer so, denke ich. Musik war immer innovations- und technikgetrieben. Am Ende geht es um Kommunikation. Die eine Seite macht, die andere hört zu. Im besten Fall entsteht so ein Dialog. Beide Perspektiven sind dabei gleich wichtig, das Kollaborative ist entscheidend. Hörer:in sagt: Das ist scheiße. Da würde ich antworten: Okay, lass uns doch daran arbeiten, wie du hörst und Musik wahrnimmst. Irgendetwas Interessantes findest du immer – in jeder Musik. Offenheit ist wichtig. Ich höre mir auch aktuelle Popmusik an, besonders gern im Taxi, um ehrlich zu sein. Da sind die Höhen vollaufgedreht, der Bass ist nicht existent. Irgendwas zischelt in Richtung meiner Ohren, und ich will das durchdringen. Verstehen. Die Sounds in dieser Mischung, die Effekte, etc. Ich suche immer nach Dingen, die ich mir so noch nicht vorstellen konnte. Dafür ist schon Aufmerksamkeit und Offenheit nötig. Übersetzt auf die neue Platte heißt das: Ich habe die Hoffnung, dass die Hörer:innen das irgendwie zu Ende denken, für sich selber ausgestalten. Denn natürlich fehlt dem Album etwas. Das Offensichtliche, klare Melodien zum Beispiel. Gleichzeitig entsteht so hoffentlich auch eine Irritation, ein Suchen, ein Hinterfragen. Weil bestimmte Sounds zusammen durch das Timbre vielleicht doch den Eindruck suggerieren, dass da etwas ist, was faktisch gar nicht existiert. Das sind so gewisse Ahnungen, die entstehen können. Machst du die für dich im Kopf lauter, passiert genau dieses Zu-Ende-Denken. Für mich war der Dialog mit Musik immer wichtig. „Music For 18 Musicians“ von Steve Reich ist da immer mein Beispiel. Als ich die Platte als Kind entdeckte, war mir vollkommen egal, ob es da nun Melodien gibt oder nicht. Die Mischung der Klangfarben war viel faszinierender.
Eine Art der Synästhesie.
Und es hängt immer auch von dir selbst ab, ob die Komposition nun zündet oder nicht. Man kann das sterbenslangweilig finden, merkwürdig, gar unangenehm. Darüber lässt sich ewig streiten. Was ist Musik? Was soll und was kann Musik?
Ich möchte nochmal zum Thema Funktionsmusik zurück. Ein nicht ganz klar definiertes Genre bzw. eine Herangehensweise an Sound, die gut dokumentiert ist – Eno sei Dank. Das ist ein Gewerk im Gewerk. Eine Tradition. In welcher Tradition siehst du dich selbst?
Improvisation war immer wichtig für mich. Bis heute. Mir wurde das neulich nochmal deutlich, als ich eine Doku über Bill Evans geschaut habe. Er unterhält sich mit seinem Bruder – einem Musiklehrer. Und er sagt einen bemerkenswerten Satz: „Jazz ist kein Stil, sondern ein Ansatz.“ Das heißt: Improvisation war schon immer tragender Teil der musikalischen Entwicklung. In der Klassik galt das auch: Es konnte nur nicht aufgenommen werden. Also war die Notation die ausschließliche Handreichung, wie ein Stück zu spielen ist. Mir war das immer fremd. Warum soll ich Vivaldi ausschließlich so spielen, wie er es aufgeschrieben hat? Musik ist doch so viel mehr. Ideen sind das eine, die Interpretation etwas anderes. Es geht um das Spielen. Ich komme nochmal auf Don Cherry zurück. Ihm ging es auch immer um das Spielen und nicht um die Produktion. In einer Zeit, als immer mehr Verstärker auf die Bühnen geschoben wurden und hinter jedem Drum-Kit ein Gong hängen musste, hat er sich mit seiner Flöte in den Wald gesetzt und einfach gespielt. Spielen. Ich habe das mit den Jahren ein bisschen aus den Augen verloren. Es muss nicht immer alles perfekt sein, es geht um das Machen. Lass uns einfach reden.