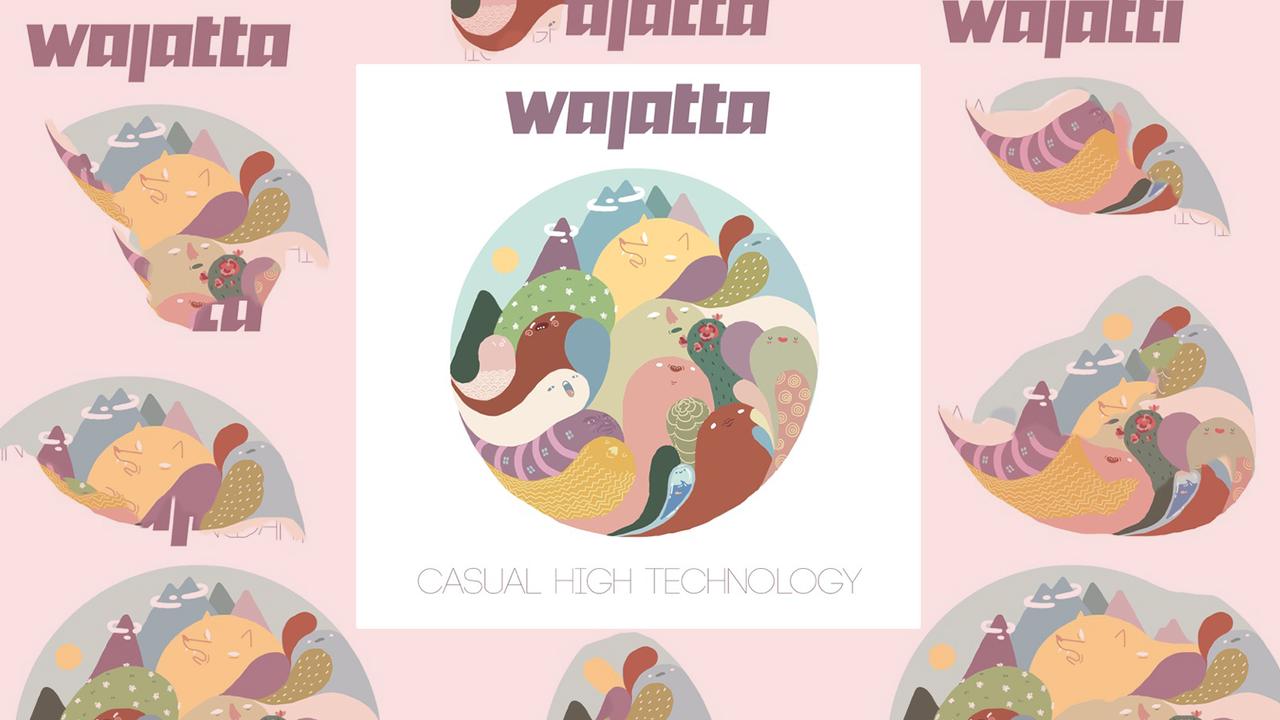Rewind: Klassiker, neu gehörtChic – C’est Chic (1978)
14.5.2018 • Sounds – Gespräch: Thaddeus Herrmann, Martin Raabenstein
Chic, das Projekt von Nile Rodgers und Bernard Edwards, steht musikhistorisch für mehr als Disko und Dancefloor. Aber auf der Tanzfläche scheiden sich die Raabenstein'schen und Herrmann'schen Geister immer wieder besonders fulminant. Unter der so wunderbar gleichmäßig gepunkteten Diskokugel des Vergessens hören die beiden „das Album mit 'Le Freak'“. Ein Gassenhauer, der der LP „C’est Chic“ nicht wirklich gerecht wird. Es kommt, wie es kommen muss: Erst kriegen die Pet Shop Boys aufs Maul, und dann verlieren sich die Spuren im Swimmingpool vor dem Berghain.
Martin Raabenstein: „C’est Chic“ war mehr als nur Disko, eher eine verruchte Änderung der Zeitform, sexualisiertes Futur II: „Wir werden viel Spaß gehabt haben“, das definitive Versprechen also. „I Want Your Love“ drückte keinen Wunsch aus, sondern eine schon im Hier und Jetzt vollzogene Zukunft. Die Babyboomer wackelten sich 70er-like in ihre unkeusche Visionen. Disko hatte 1978 zwar schon ein paar Jährchen auf der Rille, dennoch, heißer Scheiß hier, ein wirkmachtsicherer Feuchtigkeitsspender zur Dauerbespielung.
Thaddeus Herrmann: Dabei klingt es ja aus der heutigen Sicht – also der Zukunft von damals – gar nicht sonderlich aufregend oder anders. Dieses Album beschreibt für mich zunächst ein fast perfektes Cocooning. Es geht also um die Erschaffung eines Raumes, vielleicht sogar eines Paralleluniversums, in dem alles mehr als perfekt wattiert und ausgeleuchtet ist. Wer hier auf der Gästeliste steht, darf sich glücklich schätzen. Muss aber auch den Regeln folgen, sich darauf einlassen, was hier vorgegeben wird. Genau das gelingt aus der heutigen Zukunft natürlich kinderleicht, weil viele der Dinge, die auf dem Album entschieden wurden, mittlerweile Kanon sind. Schon wieder so eine Referenzmaschine. Was interessant ist, weil abseits der Tracks, die heute Gassenhauer sind, es eher die subtilen Nuancen sind, die adaptiert wurden. Ich meine: Wo wären die Pet Shop Boys jemals angekommen ohne diese Streicher-Sounds?!
Martin: Ja, Violinenhimmel im zehenmarternden Streichelzoo. „Le Freak“ ist bestgeölte Zeitmaschine. Ich treibe da frei in meinem Privatpool, Chic ist gelebte, geliebte Memorabilia. Wenn der Track heute auf einer Party läuft, bin ich raus, denn das ist meine Historie, das kann ich nur noch privat hören. Zum Thema Pet Shop Boys, ehm, vergiss’ mal alle diese wundersamen und stilprägenden Videoproduktionen: Was bleibt da noch? Ein „One-Hit-West-End-Wonder“. Die Streicher erinnere ich da nicht mehr, aber von der Trompete träum ich heute noch, MTV at it’s best.
Thaddeus: Ich tippte das B von Boys und sah den Shitstorm schon kommen: Da bin ich wohl ins offene Disko-Messer gelaufen. Ich möchte das an dieser Stelle gar nicht vertiefen, die Boys fielen mir nur ganz am Anfang, schon in den allerersten Takten ein, wenn bei „Chic Cheer“ die Atmo anläuft und dann gleich im Club aufgeht. Da dachte ich erst an „West End Girls“ und dann an alles andere der beiden. Egal. Mich interessiert die Produktion. So sanft und fluffig wie die vorne raus klingt, dreht sich die Story doch vielmehr um interessante Figuren und Ideen, die eher im Unterholz des Dancefloors stattfinden, auf dem diese Platte aufgenommen wurde. Aber dazu kommen wir sicher noch. Auch dazu, wie sich diese Platte hier zum Vorgänger verhält. Nächste Haltestelle: Schlagzeug. Natürlich nur bei den Uptempo-Tracks. Darüber müssen wir reden. Wollen wir?
„Le Freak“
„I Want Your Love“
Disko hat alles in Schutt und Asche getanzt, was sich vordem durch Individualität und Größe auszeichnete.
Martin: Sagen wir mal, das wäre die übernächste Reiberei. Die fluffige Produktion hat zwei Gegenpole, slick schubbelnde „George-Benson-Soft-Soul-Jazz-Dinger“ und die beiden Megahits. Runter vom Floor, rauf auf die Matte, Poppen als Pausenfüller, die gleiche Bauart wie der Erstling „Chic“ von 1977. Musikalisch ist dieses Kuschelintermezzo nicht revolutionär, aber der Nile wäre nicht Rogers, wenn da nicht wieder dieses kleine „Darfs-ein-klein-wenig-mehr-sein“ drin wäre. Das ist Handwerk auf dem Punkt, selbst beim Plänkeln. Sitzt wie ein Nadelstreifen und zieht dann, möglicherweise auch genau deswegen, die Konsequenzen nach sich. Disko hat alles in Schutt und Asche getanzt, was sich vordem durch Individualität und Größe auszeichnete. Soul, Jazz und alle dazwischen fummelnden und forschenden Varianten waren nach diesem Move platt. Nach Disko stand von denen keiner mehr von der Tanzfläche auf, Schicht, Ende und raus.
Thaddeus: Ich weiß nicht, ob Hedonismus den Loop oder zumindest das Loopige braucht. Insofern würde ich dir hier widersprechen wollen. Nichts war danach tot. Und ich würde mich auch nicht auf die Diskussion einlassen, die du ja eigentlich führen willst. Denn wenn man über Disko spricht, ist House ja nicht weit, aber genau das findet heute nicht statt. Und ganz ehrlich: Als Aushängeschild für Disko funktioniert die Platte doch eh nicht. Da komme ich auf mein Paralleluniversum vom Anfang zurück. Joah. Ich würd’ ja immer noch gerne über die Drums und die anderen menschlichen Sequenzer reden. Jetzt Lust?
Martin: Der ist einfach, die konnten noch „tight“, das war kein Sequencing, solche À-point-Mucker hörst du heute selten. Das waren begnadete Sessionmusiker, ich weiß gar nicht auf wie vielen unbekannten Tracks diese armen Schweine ihre gottvolle Handschrift für ein paar Dollar „in time“ hinterließen. Das Studio wurde eigentlich nur zum Schlafen verlassen. Nameless heroes. Haus- und wohl auch zahnlos heute.

Thaddeus: Ja, oder auf Koks über Reling des Love Boats gefallen – okay. Ich weiß schon, dass hier Menschen am Werk sind und kein Computer. Aber gerade Session-Musiker spielen ja immer so, wie es der Chef will. Und der wollte offenbar reduzierte Präzision. Das verleiht einigen der Stücke einerseits eine gewisse Austauschbarkeit – da sind wir wieder beim sequenzierten House –, gleichzeitig aber auch eine interessante Grundstimmung. Das Minimale, auf dem die anderen Spuren erst zum Leben erwachen. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die mir ganz gut reinläuft. Auch wenn hier alles wahnsinnig glossy ausgeputzt ist. Gibt es eigentlich Edits von den Tracks? Egal. Auf dieses Album bezogen hätte ich es schön gefunden, wenn es die Flöten vom Vorgänger auch hier in die finalen Versionen geschafft hätten. Die mochte ich sehr.

Martin: Tja, glossy und ausgeputzt, die Herrschaften können gerne in Gucci oder Fiorucci auf dem Cover abgelichtet werden: Als Schwarze kommen sie trotzdem nicht ins „Studio 54“. Durch den Hintereingang schleichen die Musiker. Das ist US-amerikanische Musikgeschichte. Die Jazzer sind deswegen schon in den 50ern nach Europa gekommen. Aber zurück zu unserem heiß geliebten Lieblings-Disput. Wäre House so sanft entschlafen wie Disko im Jahre 1980, ich wäre dein Best Buddy in Inhalt und Form. Die meisten Genres haben eine Silver-Bullit-Phase von fünf Jahren. Lässt man mal die Pre-House-Disko-Mischformen weg, hätte dann Anfang der Neunziger Schluss sein können. War aber nicht so, dumm gelaufen. Warum eigentlich, was genau ist da so zäh und überlebenswillig? Die Produktionsmittel wurden erschwinglich, ok, sehe ich ein. Und darum macht man dann endlos weiter, in deinem angesprochenen Loop à la Kraftwerk?
Nur weil es eine Love Parade gab, war House nicht schlecht.
Thaddeus: House ist ja nicht gleich House. Auch wenn es immer noch so genannt wird – warum auch immer – hat eine aktuelle 12", wenn sie nicht bewusst den Sound von damals interpretiert und aufnimmt, nichts mehr mit dem Sound von damals aus den frühen 80ern zu tun. Das sind popkulturelle Wendungen, die ich mir nicht ausgedacht habe. Ich habe mir auch nicht ausgedacht, dass die musikalische Komponente der Popkultur so perfekt durchkommerzialisiert wurde. Scheißt in unserem Kontext sowieso der Hund drauf. Die diskoide Blaupause wurde aufgesogen und weiterentwickelt, mit anderen – europäischen – Einflüssen vermischt und so ist erst House und dann Techno entstanden. Den Rest kennst du. Und nur weil es eine Love Parade gab, war House nicht schlecht. Genau wie es auch bessere „Disko“-Platten gibt, als diese hier. Behaupte ich. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen?
Martin: Aus reiner, pubertärer Streitlust. Genau darum möchte ich trotzdem auf die Kommerzialisierung eingehen, obwohl da dein Hund draufmacht. Man muss nur ein paar Stunden Mixen auf welchen Plattformen auch immer lauschen, da kommen sie dann alle, die ungehörten, raren Disko-Tracks. Du sagt, „C'est Chic“ sei nichts Besonderes, hör dir mal die Sound-alikes von damals an. „Le Freak“ war und ist bis heute die best verkaufte 7" ever. Intelligentes Kopieren eines Bestsellers ist keine Erfindung der späten 70er, hier aber wurde es zum kassenkräftigen Prinzip. Mit ohrenschmalztreibenden Erzeugnissen. Eine nicht enden wollende Reihe von Rocklegenden der 70er sind ebenfalls diesem Zug hinterhergezuckelt, da sag ich nur – Kiss – my ass.
Thaddeus: Ich habe nicht gesagt, dass das Album nichts Besonderes ist, sondern dass es bessere Platten gibt. Und es ist mir auch egal, ob ein Track rar ist oder immer noch nachgepresst wird. Es geht mir eher um eine Haltung und wie man bestimmte Dinge in der Haltung wohlwollend interpretiert und reflektiert und daraus dann etwas Neues macht. À propos Neues. Ich knüpfe nochmal an das „Studio 54“ an. Die Legende geht ja so, dass Nile Rodgers genau dort damals nicht reinkam, obwohl er von Grace Jones eingeladen war. Blöder Spruch vom Türsteher, so entstand dann „Le Freak“. Ich war nun damals nicht dabei, aber das Nachtleben war immer voll solcher Hindernisse. Wenn das aber die damalige Stimmung widerspiegelt, ist es auch keine Überraschung, dass sich Dinge radikalisierten und weiter Nischen geschaffen wurden, in denen man unter sich war. Allein das überträgt sich ja auch auf die Musik, die dann an solchen Orten gespielt wird. Ein klassischer Abgrenzungsmechanismus. Und genau in solchen Momenten bilden Entwürfe wie der von Chic dann nicht mehr die Lebensrealität der Clubber ab, und Dinge verändern sich.
Martin: Das bildet dann wilde Blasen, wie die No-Disco-Bewegung, bei der die Platten in Football-Stadien verbrannt wurden. Diese erwähnten Nischen sind damals als höchst ablehnenswürdig und fremd wahrgenommen und angefeindet worden. Das Feindbild ist klar. Dieses miefige Vorgehen verfestigt die Gegenbewegung eher, statt sie mit Rockgitarre und Kreuz schwingend aufzulösen. Tür zu. Schwarze und Schwule tanzen ihre nicht enden wollende Party, blenden die traurige Realität draußen vor der Tür aus.
Thaddeus: Das klingt wie ein Vorwurf, den ich nicht unterschreibe. Der Club als geschützter Raum ist wichtig. Hier wird nicht fotografiert, hier gibt man aufeinander acht – genau dieses Verständnis ist auf dem Rückzug.
Martin: "By invitation only" kommt doch wieder. Das ist jetzt nicht wirklich New York Ende der 70er, dennoch.
Thaddeus: Wir müssen hier unterscheiden zwischen der Event-isierung und der tradierten Clubkultur. In einen geschützten Raum soll halt nicht jeder rein. Das ist einerseits hochproblematisch, weil ein Türsteher natürlich nie auf den ersten Blick wirklich einschätzen kann, wie sich die Person XY im Club verhalten wird oder könnte. Das ist keine Erfindung von Disco oder House, das war schon immer so. Dort, wo „unser Ding“ gemacht wird, muss man eben erst ein Teil dieser Gruppierung werden.
Martin: Dann liege ich doch mit meinem Privatpool gar nicht so falsch, meine Erinnerung, meine individuelle Musik. Was läuft denn so in deinem ganz persönlichen Brain-Player?
Thaddeus: Die eine Platte habe ich nicht. Eher einen – Achtung – Pool, aus dem ich immer wieder schöpfe. Den Universal-Cleanser suche ich noch immer. Aber die Shortlist ist lang. Und gut.