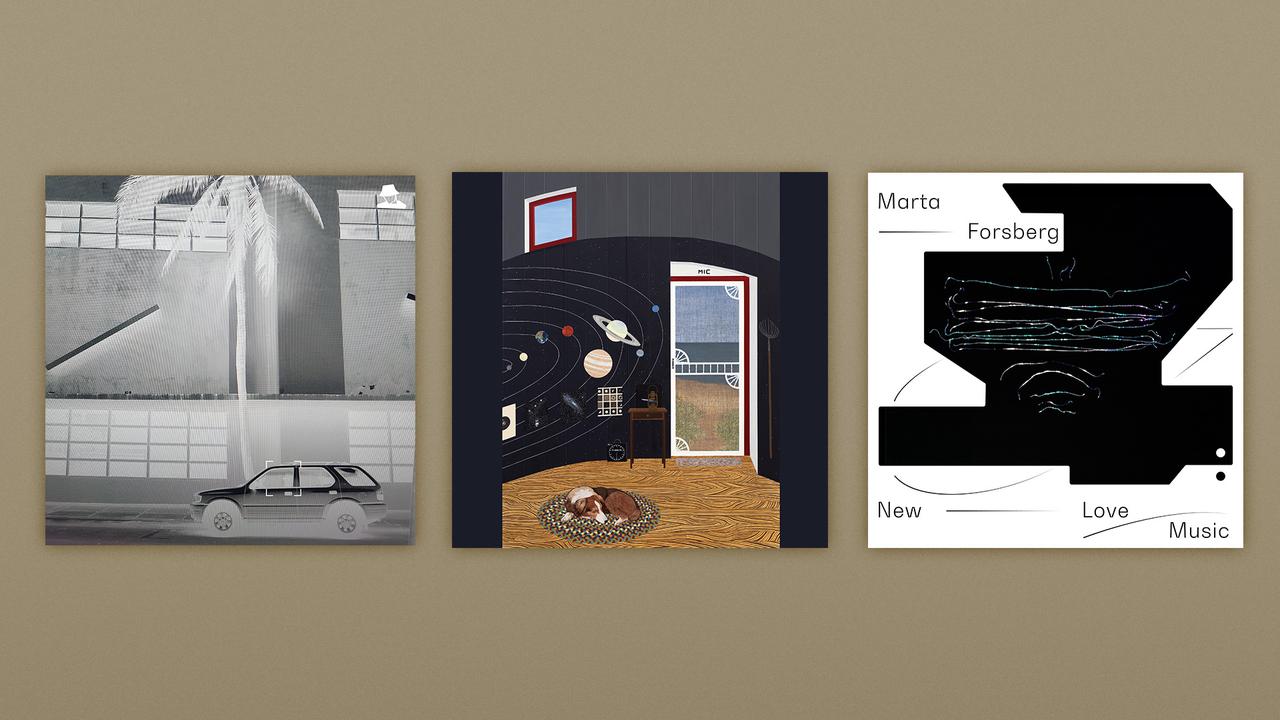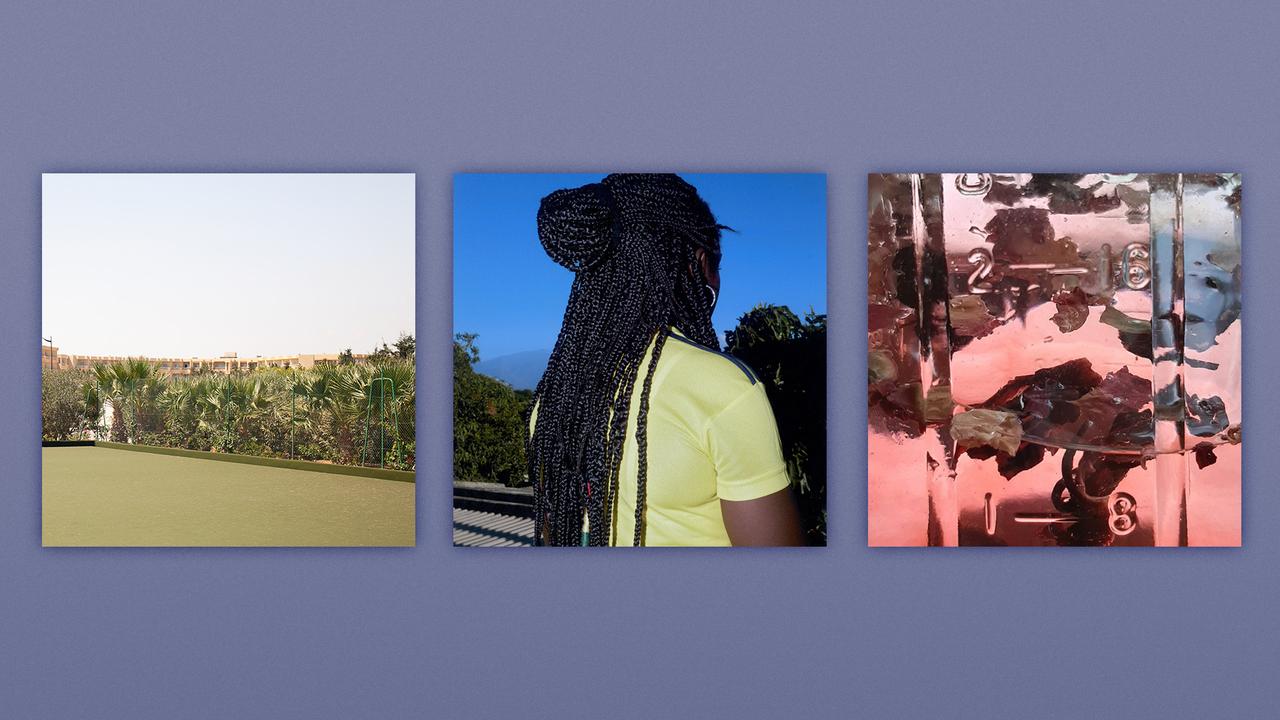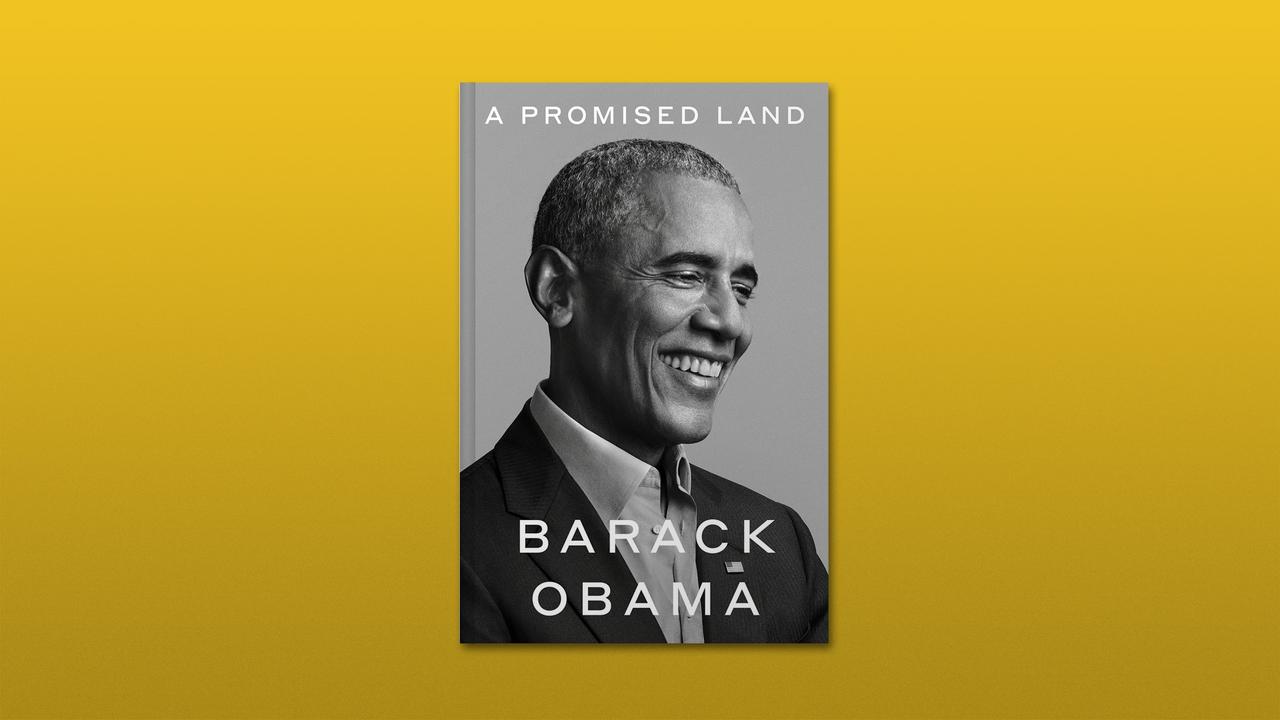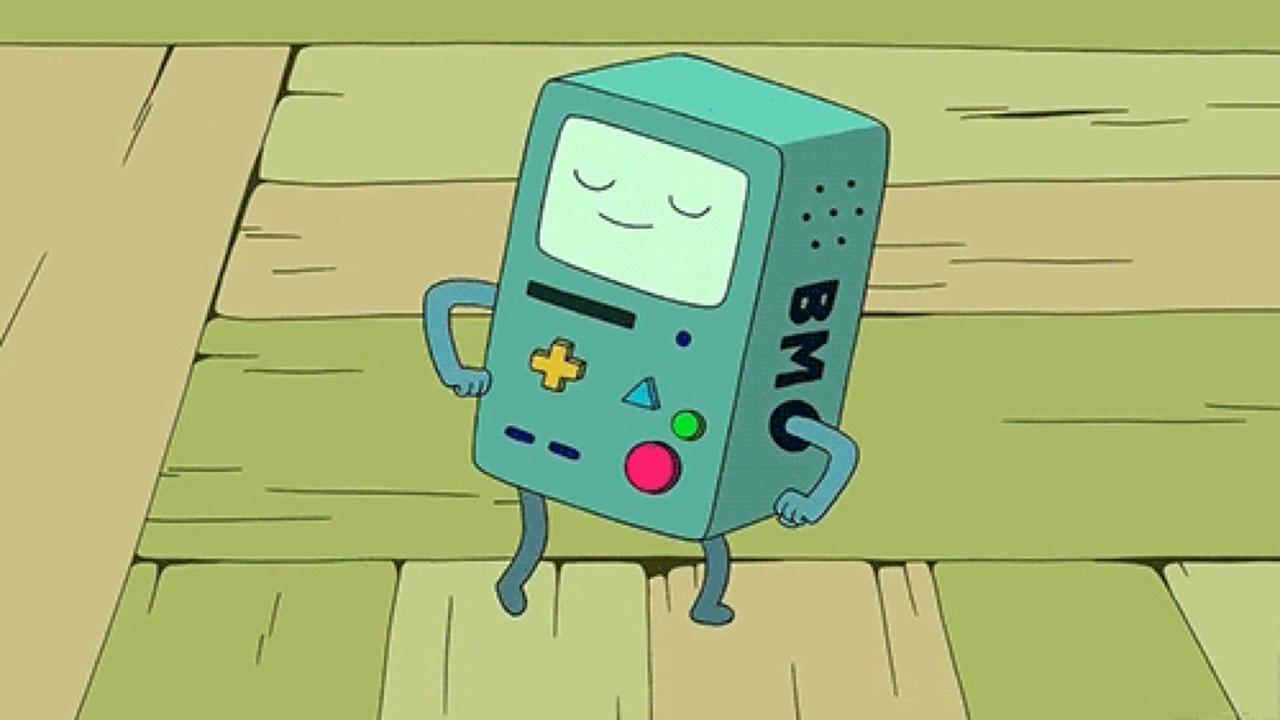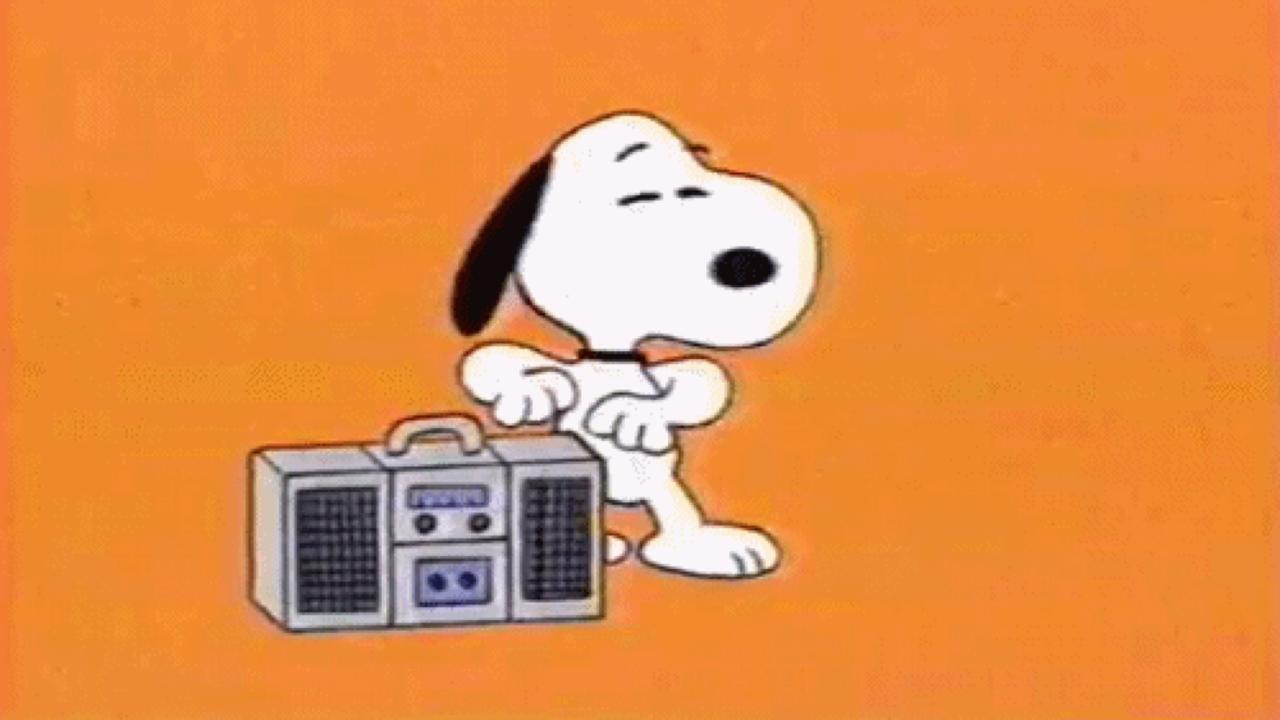Reduziert, programmiert, exaltiertLucy Railton, Dominique A, Ascendant Vierge – 3 Platten, 3 Meinungen
22.12.2020 • Sounds – Gespräch: Christian Blumberg, Kristoffer Cornils, Thaddeus Herrmann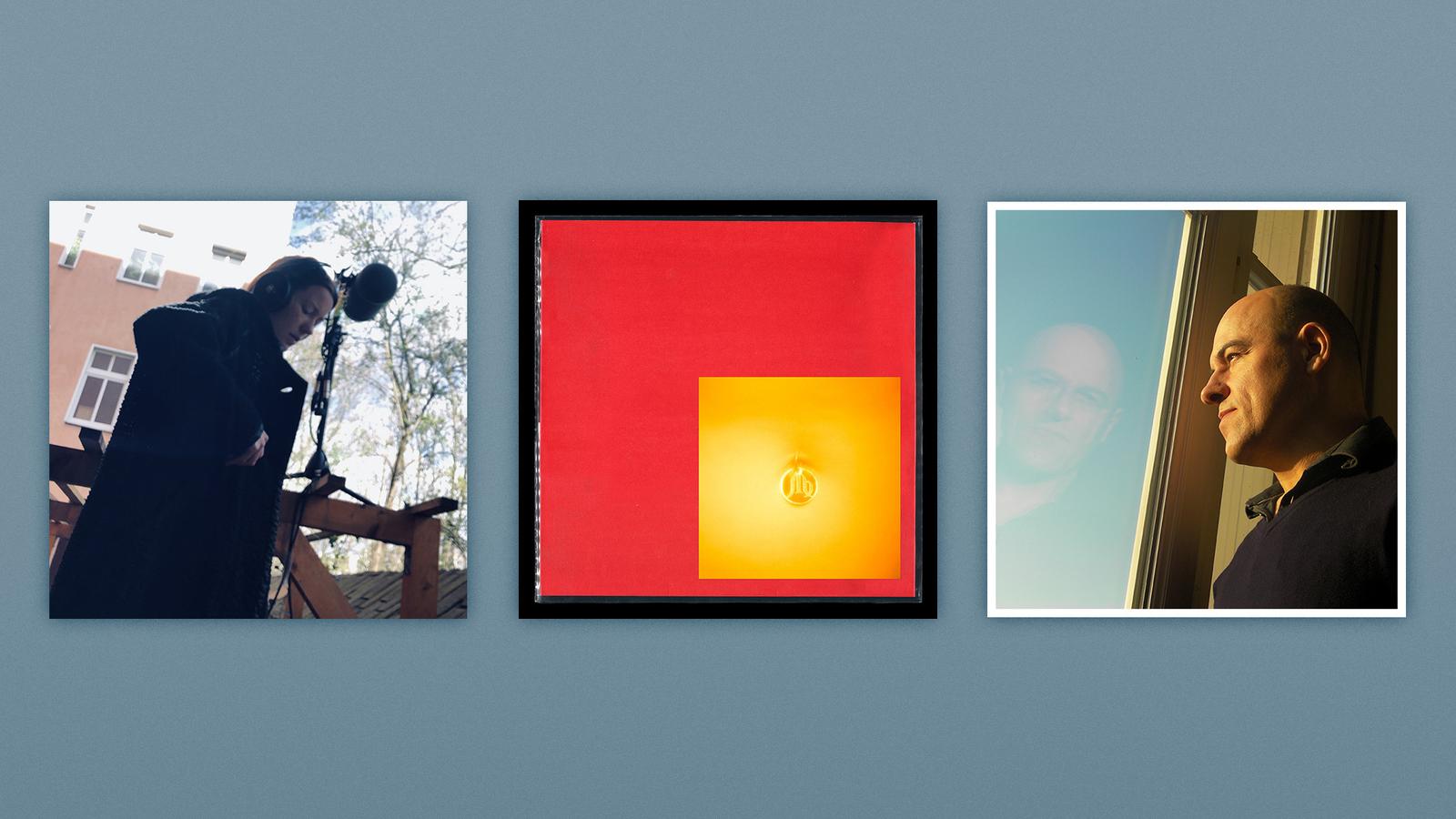
Wenn die Geräusche des Berliner Nahverkehrs auf ein leises Cello treffen, die französische Chanson-Tradition mit dem Drumcomputer einen slow dance dreht und sich Eurodance an New Wave erinnert, dürfte allen klar sein, welches Lockdown-Stündchen geschlagen hat: Musik-Roundtable! Ende 2020 brauchen Blumberg, Cornils und Herrmann dafür nicht mal mehr eine Video-Schalte, um sich remote auf die Finger zu schauen. Ein leeres Dokument in der Wolke reicht vollkommen. Die Wahlberlinerin Lucy Railton hat für „5 S-Bahn“ das Mikrofon aus ihrer Wohnung auf die Bahntrasse unter ihr gerichtet – und ein Zeitdokument geschaffen aus dem stillsten Berliner Frühling aller Zeiten. Auch der Chansonnier Dominique A war in seiner französischen Heimat situationsbedingt im Heimstudio und hat seine bislang stillste LP aufgenommen – „Vie étrange“. Große Songs für Stimme und tuckernden Drumcomputer. Von Stille wollen Ascendant Vierge gar nichts wissen. Ihre Songs reiben sich zwischen dicken Beats und operettenhaftem Gesang. Blumberg setzt France Gall in den Autoscooter, Cornils verpasst der Deutschen Bahn eine neue CI und Herrmann singt „Voyage, Voyage“ von Desireless. Jahresende halt.

Lucy Railton, 5 S-Bahn, ist bei Boomkat Editions erschienen.
Lucy Railton – 5 S-Bahn (Boomkat Editions | Documenting Sound)
Kristoffer: Innere Zustände, äußere Umstände – das waren die Pole der Dialektik, die unser Leben in den vergangenen Monaten geprägt und geführt hat. Da war Resilienz gefragt und die Boomkat-Serie „Documenting Sounds“ zeigte eben solche: Woche um Woche kamen die Sounds aus den Lockdown-Studios dieser Welt, gepresst auf schmucke Kassetten, exklusiv über den Mailorder erhältlich und vermutlich deshalb auch in Sachen Wertschöpfung etwas einträglicher für die beteiligten Musiker*innen. Manche von denen trieb es ins innere Exil, andere wiederum nach draußen. Während Kevin Drumm beispielsweise gemeinsam mit seiner Tochter die räumliche Trennung der beiden festhielt, streifte Lawrence English für seine Ausgabe durch Queensland, wo er nach den Buschfeuern am Jahresanfang Feldaufnahmen angefertigt hatte. Und Lucy Railton wurde ihrem Nachnamen gerecht und trat während der Wochen der ersten Kontaktbeschränkungen – einen tatsächlichen Lockdown haben wir hierzulande bisher immer noch nicht erlebt – im März vom Balkon aus per Cello und Stimme mit der Berliner Ringbahn (Rail-Ton, geddit!?) in Dialog. Was hat das mit euch gemacht, oder: Hat es überhaupt etwas mit euch gemacht?
Thaddi: Doch, doch, hat es. Um im Eisenbahner*innen-Sprech zu bleiben: Das Tape ist ganz vorzüglich an mir vorbeigerauscht, im positivsten Sinne. Field Recordings – egal, wie komponiert oder nicht – sind für mich ja im Idealfall eine Chance, etwas zu lernen, über Klang. Mich mit etwas auseinanderzusetzen, womit ich mich bislang noch nicht auseinandergesetzt habe. Das fällt mir hier natürlich etwas schwer(er), weil: Ihre Stadt ist ja auch unsere Stadt. Und wie die S-Bahn klingt und rauscht weiß ich seit etwa 40 Jahren. Ich bin an der Stadtbahn aufgewachsen. Und auch wenn der rolling stock damals natürlich noch ein anderer war: Der Sound ist nach wie vor vergleichbar, wenn er auch heuer viel moderner daherkommt. Das ist natürlich nur Teil der Geschichte, bzw. des Albums, bzw. des Tapes. Auch ich habe in den vergangenen Monaten ganz neue Routinen entwickelt – und ich höre hier durchaus Parallelen, auch wenn meine und ihre rein gar nichts miteinander zu tun haben. Die individuelle Umgebung ist prägend. Ob man nun am offenen Fenster der S-Bahn zuhört und dazu sanft und still das Cello spielt, oder wie in meinem Fall mehr oder weniger zur gleichen Zeit jeden Tag einen langen Spaziergang macht. Ich „traf“ dabei immer die gleichen Menschen zur gleichen Zeit, sie hört die ewig gleichen Geräusche und Klänge. Das Repetitive, das Gleichförmige, das unser aller Alltag ja ohnehin bestimmt, bekam in den vergangenen Monaten eine ganz neue Bedeutung bzw. wandelte sich. Die Stadt war still(er). Und man hörte, bzw. sah genauer hin, schmiedete neue Verbindungen, ob nun visuell oder sonisch. Wobei ich natürlich auch sagen muss: S-Bahn, Ringbahn hin oder her – nicht alles, was an ihrem Fenster vorbeifährt oder -rauscht, ist eine S-Bahn. Aber das ist ja auch vollkommen egal. Das Processing entscheidet.
Christian: Ich denke ja, dass im Titel der Serie schon eine Frage steckt: „Documenting Sounds“ – also ist es die Serie, die etwas dokumentiert, oder sind es doch eher die Aufnahmen selbst? Bei Field Recordings stellt sich ja meistens die Frage, wie sie es mit dem Dokumentarischem halten, und da gibt es durchaus verschiedene Ansätze: „Konkret“ versus „Narrative“ zum Beispiel. Und bei Lucy Railton mochte ich, dass es neben dem repräsentativen Charakter der Aufnahmen eben noch diese Inszenierung von Sounds gibt: Da wird mal zu einem Glockenton einer Kirche gesummt, dann wird das Cello ins „Feld“ gesetzt - diese Art von Klang-Staging finde ich sehr charmant. Und irgendwie auch sehr musikalisch.
Thaddi: Guter Punkt. Denn dadurch bekommt das Dokumentarische einen klaren lokalen Touch. Der sich uns als Quasi-Nachbarn vielleicht erschließt, den meisten anderen Hörer*innen aber als fremde Komponente präsentiert. Es geht ja immer um den Kontext bei Field Recordings – bzw. um die Frage, ob man eben jenen zulässt, akzeptiert oder ignoriert. Alle drei Varianten sind vollkommen okay. Ich erkläre uns hier aber alle drei für befangen. Wobei das vielleicht auch etwas mit dem „Urbanen“ zu tun hat statt mit dem Lokalen. Nur so Ideen ...
„Es ist auf seine Art extrem ergreifend, weil es das Banale so ernst nimmt.“
Kristoffer: Oha, okay! Ich habe sehr bewusst nach der Wirkung gefragt, eben weil es eine sehr spezifische Bahn ist, die da zu hören ist. Als Railton diese Aufnahmen gemacht hat, saß ich nur wenige hunderte Meter entfernt und hörte die Ringbahn überhaupt nicht, weil ich nach einer Reise nach Südostasien erstmal in sehr strikte Quarantäne gegangen bin. Die Bahn war gewissermaßen also etwas Alltägliches, das in diesem Ausnahmezustand plötzlich fehlte, obwohl ich sie sonst jeden Tag – meistens sehr unbewusst – gehört habe. Und dann poltert sie mir plötzlich wieder ins Bewusstsein. Spannend finde ich das, weil Bahnen im Field-Recordings-Setting ja üblicherweise eine gänzlich andere Konnotation haben. Meine liebste Field-Recordings-Platte aller Zeiten ist Chris Watsons „El Tren Fantasma“, auf der wird die letzte Reise eines Zugs durch Zentralamerika in Szene gesetzt. Da geht es natürlich um Bewegung, um Freiheitsgefühle, Naturerlebnisse. Hier aber: Stasis im Altbau. Das fand ich extrem beeindruckend, weil es – das hat Thaddi sehr richtig gesagt – mir natürlich die Routinen vorhielt und wie diese in Quarantänetagen plötzlich eine dezidiert andere Wertigkeit bekamen. Vor allem auch, weil es mir das Gemeinschaftliche von Sound-Erlebnissen bewusster machte als alles andere. Wenn wir plötzlich alle drin sitzen, dann fehlt uns nicht nur das Miteinander, sondern auch die Klänge, die dieses Miteinander – das Zueinanderreisen etwa – bedeuten. Railton macht hier außerdem etwas, das gerade im akademischen Diskurs wahnsinnig hip ist und doch unfassbar elegant und, na ja, menschlich gelöst wird: Sie improvisiert im Verbund mit Technik. Nicht auf die glatte „Ich hole mir eine KI-Pianistin ran“-Art, sondern auf brachial alltägliche Art und Weise. Darin wiederum drückt sich eben ein Mangel in der improvisatorischen Praxis aus: Weil der Mitmensch fehlt, ist’s eben die Mitmaschine. Mir fällt dafür wirklich kaum ein anderes Wort als stark ein. Es ist auf seine Art extrem ergreifend, weil es das Banale so ernst nimmt. Als Album oder Tape trifft es wahnsinnig wichtige oder zumindest schlagende Aussagen darüber, wie wir unser Leben normaler Weise führen, und wie wir es in einer bestimmten Zeit dann auf einen Schlag ganz anders taten. Das geht mir nicht allein geografisch nah.
Thaddi: Nein, ganz offensichtlich nicht! Die akademische Kontextualisierung muss ich dir einfach glauben und tue ich natürlich auch. Ich kenne mich da nicht aus, sage ich ganz ehrlich. Einige deiner Findings finde ich ein wenig hoch gegriffen, aber so be it. Vielleicht gerade was das Technische angeht, das ist für mich aber auch eine abstrakte Größe, die ich nicht recht einzuordnen vermag.
Kristoffer: Ich denke, dass hier schon ein Konnex zwischen Mensch und Maschine aufgebaut wird, beziehungsweise halte ich das für recht evident. Nur eben auf eine Art, die sehr emotional ist, ohne andererseits wieder den üblichen Kitsch aufzurufen. Das sind eben nicht die Ansagen aus der Yamanote, die in irgendein Ambient-Album reingekleistert werden. Sondern da wird eine geradezu intersubjektive Verbindung übers Klangmaterial hergestellt, die sehr vielschichtig ist. Gut, auch das ist sehr abstrakt ausgedrückt.
Thaddi: Für den Sound der Yamanote brauche ich gar keine Musik drumrum, der sind für sich schon so toll – reicht mir völlig. Aber dein Punkt ist vollkommen klar und wichtig.
Christian: Den Begriff der Technik müssten wir aber vielleicht nochmal schärfer kriegen. Ist damit jetzt einfach die S-Bahn gemeint? Das ist ja ein durchaus traditionsreicher Klang-Topos. Also beginnend vielleicht bei Futuristen wie den Russolo-Brüdern, wo Verkehrsgeräusche eine fast schon ideologische Komponente hatten. Solche Sachen laufen ja irgendwie mit, wenn man einen Zug recorded. Aber Kristoffer, du willst eher auf etwas Subjektives raus?
Kristoffer: Das ist es doch: Ich denke, da steckt alles mit drin! Die Bahn als Symbol für den großen Aufbruch, der hier aber radikal vom Balkon aus umgedeutet wird. Und aber auch die Bahn als so gesehen kulturelle Technik – das, was ich vorhin als Zueinanderreisen bezeichnet habe. Die Bahn als Repräsentant für die Routinen, die sich mehr oder minder über Nacht verändert haben. Die reine Technologie der Bahn spielt natürlich klanglich mit rein. Das Rattern, das Rauschen, das so eben nur von Fortbewegungsmitteln wie diesem kommt. Aber jedoch genauso das, was die Bahn ermöglicht: Soziales, Arbeit, diesdas. Und das wäre eine Technik auf einer metaphorischeren Ebene. Aber womöglich müssen wir uns gar nicht so sehr an diesem Begriff aufhalten, oder? Ich jedenfalls bin zwischenzeitlich umgezogen und schaue nun aus dem 14. Stock auf immer noch genau jenen Bahnabschnitt und höre mittlerweile auch die Kirchenglocken, die bei Railton ebenfalls zu hören sind – es ist, glaube ich, die Gethsemanekirche. Und hin und wieder dann muss ich dann an dieses Tape denken. Was wieder für mich einer schöner Beweis dafür ist, wie sich eine künstlerische Auseinandersetzung mit dieser Welt meine eigene Erfahrung von ihr prägt.
„Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so wirklich die Absicht der Künstlerin widerspiegelt. Aber das macht auch nichts.“
Thaddi: Ich sage ja, wir sind da alle ein bisschen befangen. Denn egal wie nun von der Ringbahn entfernt wohnen, wir können dazu alle irgendwie relaten. Mir geht das trotz allem ein bisschen zu sehr durch die Decke hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so wirklich die Absicht der Künstlerin widerspiegelt. Aber das macht auch nichts. Es geht ja letztendlich um die ganz eigene Interpretation und die Einordnung in den eigenen Erfahrungs-Kosmos.
Kristoffer: Ja, und da funktioniert es. Vielleicht würden Nicht-Berliner*innen das anders hören und vielleicht hört es jemand selbst in Kreuzberg ganz anders. Aber bei mir schlagen die Synapsen Funken. Und es gefällt mir als Musik, als Sound auch einfach extrem gut, nicht nur, weil es mich persönlich extrem gut abholt.
Thaddi: Darüber sind wir uns einig, oder? Ich würde dann mal zum nächsten Thema schwenken, wo wir mit Sicherheit mehr Differenzen haben ...

Dominique A, Vie étrange, ist bei Cinq7/Wagram erschienen.
Dominique A – Vie étrange (Cinq7)
Kristoffer: Das nächste Thema ist Dominique As “Vie étrange” und passt also dem Titel nach thematisch ebenso bestens in dieses Jahr. Du hast uns die Platte mit den Worten „Ihr werdet mich dafür hassen, aber” gepitcht. Hattest du Unrecht mit. Als könnte ich dich hassen! Ich hasse nicht einmal diese Platte. Ich mag sie ganz gerne, um ehrlich zu sein, auch wenn sie ohne den Impuls von dir vermutlich niemals angehört hätte. Wie ging’s Christian damit?
Christian: Nach Thaddis Anmoderation war ich aufs Schlimmste gefasst, aber dann kam ich damit erstmal ganz gut klar: Diese leichte Monotonie, das Repetitive gerade in der ersten Hälfte des Albums, das habe ich schon irgendwie kapiert, auch aus welchen musikalischen Traditionen das kommt, schien mir erstmal schlüssig. Aber vielleicht erzählt Thaddi erstmal seine Geschichte zu Dominique A?
Thaddi: Ich will zunächst berichten, wie ich auf Herrn A überhaupt aufmerksam wurde. Es ist über 20 Jahre her, da saß ich eines Sonntags Morgens in Leipzig in einem Café. Leicht verschallert von der Nacht zuvor, einem De:Bug-Abend in der Distillery, wo ich im Techno-Keller HipHop aufgelegt bzw. es zumindest versucht hatte. Ihr merkt schon, wie absurd das war. Ich. DJ. Techno. HipHop. Wir saßen da also und schlugen die Zeit tot, bis der Zug zurück nach Berlin fuhr. Es lief eine wundervolle Platte und ich fragte nach, was das denn sei. Die nette Bedienung brachte das Jewelcase an den Tisch: „Vingt À Trente Mille Jours“ von Françoiz Breut. Eine großartige Chanson-Platte mit großen Songs, gesungen von einer großen Stimme. Zurück in Berlin besorgte ich mir das Album und wie ich es eigentlich immer mache, wenn mich etwas wirklich mitreißt, was ich bis dato noch nicht kannte, studierte ich die Liner Notes. Dominique Ané hatte für Françoiz Texte geschrieben und auch an der Musik mitgearbeitet. Ich hörte mich also durch seinen Backkatalog und war so fasziniert wie irritiert. Las ein bisschen, recherchierte weiter, liebte seine Stimme und arbeitete mich am Frühwerk ab. Ich behielt den Sänger irgendwie auf dem Radar und bin seit spätestens 2015 absoluter Hardcore-Fan. Sein Album aus diesem Jahr – „Éléor“ – und die folgenden „La Fragilité“ und „Toute Lattitude“ wurden Schritt für Schritt immer stiller und auch elektronischer. Der Pop scheint hell und ist doch leise. Ich kann gar nicht genau beschreiben oder eingrenzen, was genau mich an seiner Musik so fasziniert – die Art und Weise wie er seine traditionellen Songs, pardon Chansons, aber in der Produktion immer weiter reduziert, finde ich faszinierend. Und: Die eigentlichen Songs werden dabei mit den Jahren immer besser. Und „Vie étrange“ treibt das für mich auf die Spitze. Danke für die Aufmerksamkeit.
Kristoffer: Ha! Heute wird’s bei allen emotional. Das ist super. Ich habe zu Herrn A überhaupt null und gar nichts recherchiert, mein erster Gedanke allerdings war: Ohne Stereolab, Air und die Quotenregelung für französischsprachige Musik im Radio gäbe es solche Platten wohl nicht, oder nur selten. Was jetzt despektierlich klingt, aber überhaupt nicht so gemeint ist. Denn es ist ein schönes Album und dass es auf Französisch eingesungen ist, trägt musikalisch auch extrem viel bei. Bei Zeilen wie „nous sommes des papiers froissés” schmelze ich dann doch ein bisschen vor der Schönheit der Schlichtheit dieser Metaphorik dahin. Kurzum: I like it! Was hat dich denn daran aber so dermaßen auf die Spitze getrieben?
„Jedes Mal, wenn er eine neue Platte droppt, fühle ich mich einerseits abgeholt und bin andererseits irritiert.“
Thaddi: Ich schmiede im Herzen ja immer so Allianzen. Und mit Herrn Ané habe ich auch so eine geschmiedet. Ich kann es tatsächlich nur schwer in Worte fassen, was mit an seiner Musik langfristig so fasziniert und/oder begeistert. Er ist eine Art sichere Bank für mich. Natürlich rückblickend, weil die Alben mit der Zeit für mich immer größer und wichtiger werden, aber auch in Echtzeit. Jedes Mal, wenn er eine neue Platte droppt, fühle ich mich einerseits abgeholt und bin andererseits irritiert. Weil es eben wieder anders ist und ich auch sein Verhältnis zur Elektronik nicht auf die Kette bekomme. Er schreibt im Info zu diesem Album eigentlich die übliche Geschichte auf, die man 2020 eben so erzählt. Pandemie, allein, dann hab ich mal gemacht und konnte nicht mehr aufhören. Das ist für mich als Fan aber nur die halbe Wahrheit. Weil er eben die Elektronik schon vorher vermehrt genutzt hat. Was man kaum glauben kann, wenn man sich seine frühen Tracks anhört.
Kristoffer: Ich finde beispielsweise den Titeltrack schon extrem … „avantgardistisch” wäre zu hoch gegriffen, aber das ist ein recht ungewöhnliches Stück Musik auf einem Album, das sich sonst recht streng an die Konventionen von … eben, Pop hält. Sehr ahnungsvoll, ein spartanisches Klangbett, die Stimme fast abbrechend. Das hat sehr viel Durchschlagskraft. Im selben Moment allerdings ist es nur ein Baustein in einem Album, das sehr nahtlos gestrickt ist und kaum merken lässt, dass dazwischen solch ungemein verletzliche Momente eingebaut sind. Wie gesagt, ich mag es sehr, diese merkwürdige Leben des Herrn A.
Thaddi: Ich bin da total bei dir. Der Titeltrack ist außergewöhnlich. In seiner bisherigen Laufbahn, mit den – siehe oben – Field Recordings, die untenrum rattern, aber eben doch in das große Ganze passen. Sind wir mal ehrlich: Den Dominique kennt in Deutschland keine Sau. Und mein Französisch ist zu schlecht, um einzuschätzen, wie er in seiner Heimat wahrgenommen wird. Aber ich hoffe, dass er gegen den Scheiß auf Radio NRJ immer noch einen Akkord im Anschlag hat. Und: Wie cool ist es eigentlich, dass so ein Chansonnier mit einem Drumcomputer drei Viertel eines Albums aufnimmt und dabei nicht wie der letzte Kerl rüberkommt. Auch das ist eine Frage, die man Ende 2020 immer noch stellen darf und muss.
„Ich kann dir, Thaddi, den Kommentar nicht ersparen, dass der fragile Intimgesang und die von mir wegen mäßiger Französischkenntnisse eher vermutete Poesie der Texte schon so etwas sehr Anfassendes haben.“
Christian: Vielleicht eine komische Assoziation, aber meine erste war lustigerweise Suicide. Also deren sanften Momente. Da läuft so etwas New Waviges mit: ein seinen Dienst verrichtender Drumcomputer zum Beispiel, der an den Gesamtkompositionen fast ein bisschen uninteressiert scheint und etwas verloren daran vorbeiläuft. Das fand ich sehr schön. Das spielt hier aber nicht die Hauptrolle, ist ja auch schon 40 Jahre nach New Wave. Trotzdem kann ich Thaddi den Kommentar nicht ersparen, dass der fragile Intimgesang und die von mir wegen mäßiger Französischkenntnisse eher vermutete Poesie der Texte schon so etwas sehr Anfassendes haben. Was mir nach ein paar Songs dann doch auf den Zeiger ging, gerade bei den Songs, in denen minimal gehaltenen Arrangements und Melodien nicht als Kontrast dagegenhalten.
Thaddi: Jungs, ich bin ganz ehrlich: Ich hatte damit gerechnet, dass Kristoffer das egal findet und Christian übergriffig. Da sitzen wir nun.
Kristoffer: Ha! Dazu und zum Suicide-Vergleich. François Teardrop also, mais oui. Das ergibt – zumindest bei den Drumcomputer-unterfütterten Stücken – doch tatsächlich sehr viel Sinn für meine Ohren. Wäre ich aber nicht drauf gekommen. Ich würde den ja stattdessen gerne mit Pink Shabab eine Bühne teilen sehen. Und vielleicht finde ich es … na, für mich persönlich braucht es dieses Album womöglich nicht unbedingt. Aber ich kann mir allerallerbestens vorstellen, dass manche Menschen dieses Album brauchen und damit etwas sehr, sehr Schönes bekommen. Und zwischendurch kann ich’s in jedem Fall sehr gut genießen.

Ascendant Vierge, Vierge, ist bei Live From Earth Klub erschienen.
Ascendant Vierge – Vierge (Live From Earth Klub)
Christian: So was wie das Gegengift: Maximal exaltiert, beizeiten sogar mit Nähe zum Chanson oder zumindest zum Kunstlied. Vokal recht eindringlich performt von Mathilde Fernandez, begleitet von Quasi-Gabber, den Paul Seul von Casual Gabberz produziert hat. Wir sind Late Adopters, denn die beiden Hits des Albums wurden schon 2019 veröffentlicht. Und weil wir ja um die Pandemie-Verortung nicht drumrum kommen: Das ist die Art von Kirmes, die 2020 gefehlt hat. Und auch ein Hinweis darauf, wo es mit dem Gabber-Revival vielleicht hingegangen wäre, wäre es 2020 denn weitergegangen: mitten rein in den Pop.
Kristoffer: Darauf haben Live From Earth mit ihrem Club-Label schon eine Weile hingearbeitet und genau deswegen habe ich komplett aufgehört, dem Ganzen zu folgen. Nicht, weil Pop ein schlimmes Ziel wäre, sondern weil ich bei jedem Track das Gefühl hatte, ich müsste mich erstmal durch x Lagen Ironie wühlen, um zum Kern der Sache zu kommen und dann doch nur einen Business-Plan vorzufinden. Und ich will ehrlich sein: Als du den Bandcamp-Link zu „Vierge” herumgeschickt hast und ich kurz durchskippte, rollten meine Augen von selbst, und zwar im Takt, bei 150+ BPM. Aber dann: Fand’ ich auch dieses Album sehr schön, auf seine Art. Weil es anders als so viel aus dem Live-From-Earth-Umfeld doch aufrichtig, unbemüht, irgendwie greifbar schien. Natürlich musste ich an meine Kindheit denken, an Bravo-Hits-Compilations – Eurodance. Das ist noch mehr als Gabber das prägende Stichwort hier. Breaks werden ebenfalls viele reingeschmissen, das ist eine sehr zeitgeistige Retro-Beigabe. Aber sonst? Ey, das ist gutes Songwriting und dieser operettenhaft Gesang passt da wunderbar drauf!
Thaddi: Ich habe eher andere Fragen.
Kristoffer: Und zwar: Wer ist das?
Thaddi: Das auch. Aber: Was hat Desireless mit Happy Hardcore zu tun? Und warum vertragen sich New Wave und Gabber eigentlich nicht? Christian: Bitte erleuchte mich.
Christian Das ist eine unzulässige Suggestivfrage!
Thaddi: Akzeptiere ich!
„Vielleicht hätte ich mehr Taylor Swift hören sollen dieses Jahr, stattdessen war aber das hier ein Album, das ich oft gehört habe, wenn ich eben Lust auf Songs hatte.“
Christian: Das Stichwort Eurodance trifft es natürlich schon, aber dem bin ich aus biografischen Gründen auch sehr zugeneigt. Für mich geht das alles ganz wunderbar zusammen, gerade weil die Musik den Drop meistens nur andeutet. Das ist ja nur selten echtes Geballer, sondern beschränkt sich zumeist auf das Sound Design klassischen Geballers. Und tatsächlich gehen die Stücke für mich einfach als Pop-Songs wahnsinnig gut auf. Vielleicht hätte ich mehr Taylor Swift hören sollen dieses Jahr, stattdessen war aber das hier ein Album, das ich oft gehört habe, wenn ich eben Lust auf Songs hatte.
Thaddi: Krass, ich höre das vollkommen anders. Nicht schlecht oder blöd, aber kontextuell in eine vollkommen andere Richtung. Trotz aller cheesiness – ja, die höre ich, und die ist ja auch intendiert, würde ich denken – sehe ich mich hier mit einem grundlegenden Missverständnis der Popkultur konfrontiert. Das zeigt sich vor allem in nicht enden wollenden Überzeichnungen eben jener Kultur. Wie grell geht es denn noch? Ich mag ja das Sound Design durchaus. Weil hier eben keinerlei Kompromisse gemacht und auch Samples verwendet werden, die legendär sind – und damit meine ich nicht nur die Bassdrums. Die Details sind entscheidend. Die Referenzen. Letztendlich komme ich aber nicht über meinen Vergleich hinweg: Was macht ein Dead-Can-Dance-Lookalike anno 2020 im Linientreu? Das ist in sich schon weder logisch noch cool. Aber egal. You heard it here first.
Christian: Du beklagst Referenzenhölle statt Hardcore-Realness? Ist das jetzt ein grundlegender Diss von so postmodernen Logiken? Ich verstehe ja total, dass man auf diese spezielle Mischung nicht klarkommt, aber kann jetzt auch erstmal nichts daran erkennen, das man so kategorisch ablehnen müsste.
Kristoffer: Tatsächlich verstehe ich die Desireless-Referenz, die Thaddi noch eingangs gedroppt hat. Ich denke aber genauso an Sapho, eine eher unbekannte französische New-Wave-Sängerin, die zum Beispiel in ihrer Rimbaud-Vertonung die volle emotionale Verausgabung vertont hat. Ich habe durchaus das Gefühl, dass das Dramatische hier nicht inszeniert wird, nicht als Artifizielles und l’art pour l’art im Raum steht, sondern durchaus sehr … gemeint ist. Da will sich etwas ausdrücken, und das mit aller Macht. Das mag ich daran sehr. Und da spielt natürlich auch die Sprache erneut herein. Abgesehen von einem auf Spanisch eingesungenen Stück ist das Französische ja nun nicht unbedingt das Medium, das sich solcherlei Projekte unbedingt wählen würden – zu melodisch vielleicht, zu theatralisch, zu unskalierbar auf dem Pop-Markt. Hier werden diese Eigenschaften – oder zumindest der Eindruck, den diese Sprache bei Nicht-Erstsprachler*innen gerne mal hinterlässt – aber voll ausgekostet und ausgenutzt. Und am Ende steht Musik, die recht sinnvoll Dinge miteinander integriert, die mir auf den ersten Blick komplett disparat scheinen. Das finde ich beeindruckend.
Christian: Ja, theatralisch ist die Musik natürlich komplett. France Gall im Autoscooter. Cool ist das tatsächlich nicht, im Gegenteil. Es hat fast schon etwas Musical-haftes, aber darin liegt ja irgendwie gerade der Spaß. Es wird vielleicht am Drop gespart, aber ansonsten ist „Vierge” ja geradezu verschwenderisch in seinen Mitteln. Das macht es auch sehr angreifbar. Artifiziell, vielleicht auch im Sinne von kalkuliert – das sind ja zwei Begriffe die Kristoffer ins Spiel brachte. Ist es sicher, aber das ist für mich erstmal kein Manko.
Kristoffer: Es klingt eben glatt, aber da sind Ecken und Kanten. Nur eben innerliche. Zustände, ich sagte es ja schon! Wegen der Umstände, schon klar. Mir scheint da sehr viel Gefühl hinterzustecken, das sich brachial seinen Weg nach draußen bahnt. Die Musik, auf und durch die hindurch das passiert, ist vermutlich schlicht Nebensache. Weswegen sie mich auch überhaupt nicht stört; anders, als die meisten dieser Wiederbelebungsversuche von Neunziger-Subgenre XY, welche in den letzten sechs, sieben Jahren den Techno-Zirkus so dominiert haben. Wichtig ist die Stimme und das, was sie trägt. Musik ist reines Medium. Und immerhin: Singen kann Fernandez exzellent, soviel ist sicher. Und das ist schon ein immenser Bonus.
Thaddi: Chers amis, je vous aime. Bis zum nächsten Mal!