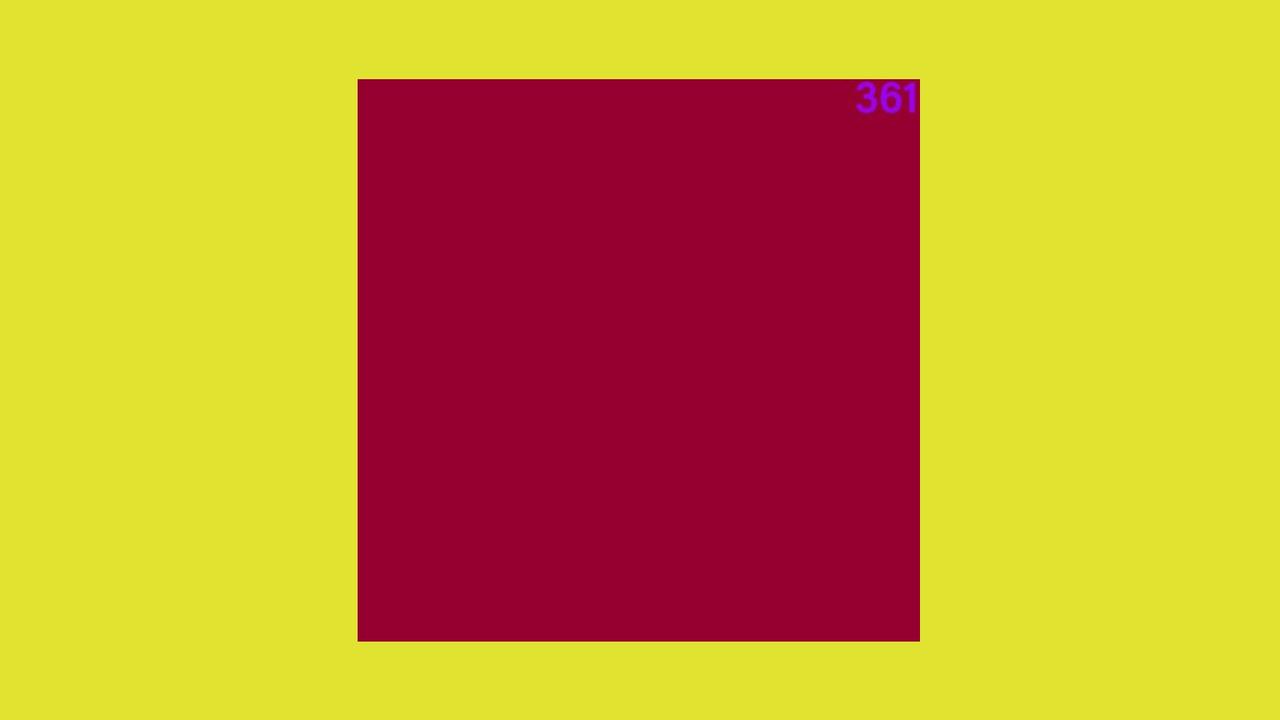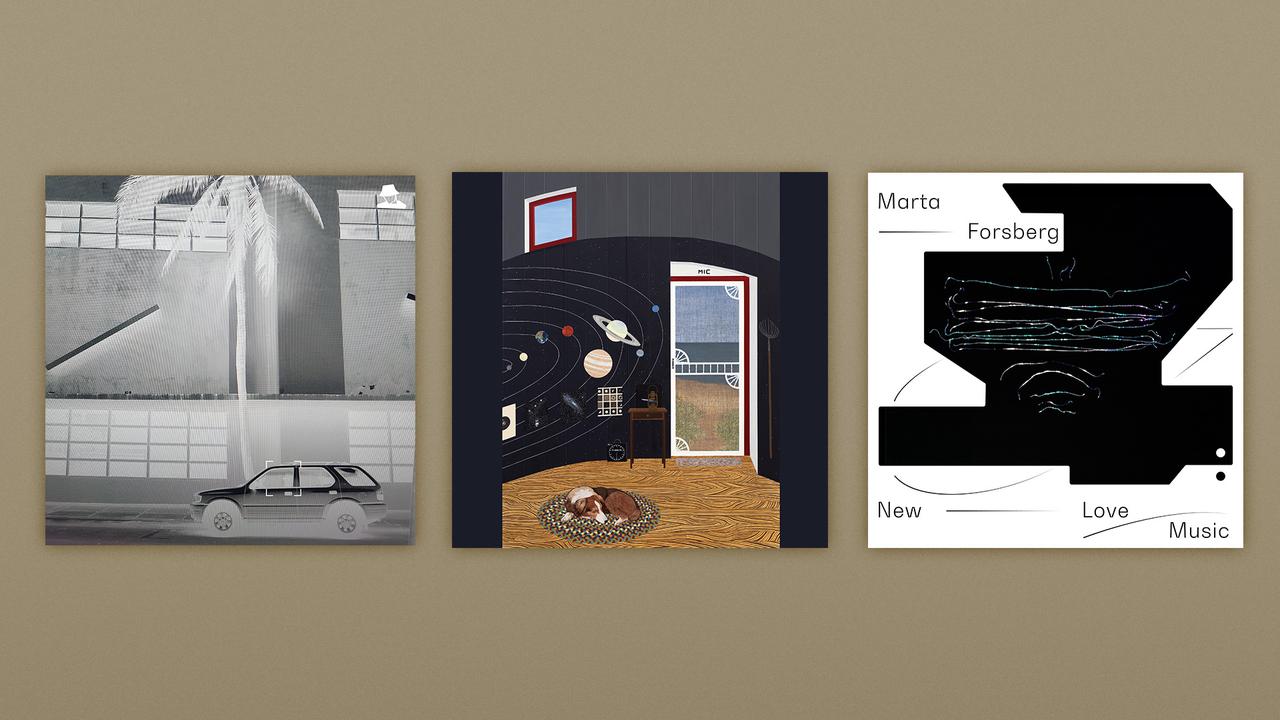Pole: „Vielleicht ist das Vergessen manchmal genau das Richtige“Auf ein Bier mit Stefan Betke
4.11.2020 • Sounds – Interview: Thaddeus Herrmann
Foto: Ben de Biel
Fünf Jahre hat sich Pole aka Stefan Betke Zeit gelassen für sein neues Album. Nach „Wald“, einem verführerisch-vertrackten Entwurf, zeigt „Fading“ den Berliner Produzenten in einem völlig neuen musikalischen Licht. Die programmatische Sperrigkeit seiner vorherigen Alben weicht einer neuen Gelassenheit, die rein gar nichts mit dem dubbigen Laisser-faire seines Frühwerks zu tun hat. 20 Jahre nach dem Abschluss dieser Trilogie sucht Betke nach neuen Wegen des Ausdrucks. Mal wieder. Denn genau diese Suche hat ihn immer angetrieben. Filter-Redakteur Thaddeus Herrmann hält „Fading“ für das bislang beste Album von Pole – und war mit Stefan Betke ein Bier trinken.
Das Interview findet am 19. Oktober 2020 statt. Musiker und Autor wohnen nicht allzu weit voneinander entfernt und verabreden sich im Berliner Volkspark Friedrichshain, auf der Terrasse des Café Schönbrunn. Es ist ein dunkler und windiger Montagnachmittag. Die Temperaturen lassen es aber gerade noch zu, sich draußen niederzulassen. Alles andere wäre zwar noch möglich, aber eigentlich nicht mehr vorstellbar. Das wievielte Gespräch es ist, das die beiden führen, lässt sich nicht genau rekonstruieren. Fest steht: Man kennt sich seit den späten 1990er-Jahren. Damals legte Betke mit „1“, seinem blauen Album auf Kiff SM, eine Dub-Abstraktion vor, die perfekt in das Berliner Zeitgeschehen passte. Seitdem ist viel passiert. Im April 2020 wurde seine Trilogie – bestehend aus „1“, „2“ und „3“, bekannt als das blaue, rote und gelbe Album neu veröffentlicht. Nach diesen Platten wurde Betke mit seiner Musik zunehmend unberechenbar, experimentierte in die unterschiedlichsten Richtungen. „Fading“ zeigt den Musiker in fast schon unerwartetem Einklang mit sich selbst – melancholisch und sehr geradeaus, einfach und fesselnd. Es geht um Erinnerungen – ein passendes Thema zum mehr oder weniger runden Geburtstag des Projekts Pole.
Wir haben uns das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen und gesprochen – zu deinem damaligen Album „Wald“. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Viele Wälder sind abgeholzt worden. Dinge sind verschwunden, andere aufgetaucht. Im Ernst: Ich habe viel Musik gemacht, fand die als Ganzes aber nicht so richtig toll. Da waren schon gute Tracks dabei, es passte aber alles nicht so richtig zusammen. Und ich bin nun mal eher ein Album-Künstler und kein 12"-Verfasser. Es dauerte also, bis ich eine neue Richtung gefunden hatte.
Wie würdest du die beschreiben?
Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, zu versuchen, die besten Elemente eines abgeschlossenen Albums im Kopf zu behalten und die als Basis-Vokabular für das folgende zu verwenden. Als Grundlage, auf der ich dann aufbaue und einen Schritt weiter gehe. Ob das nun die Strukturen des Sound Designs sind, die Atmosphären oder die Basslines. Die Prämisse ist dabei immer die gleiche: Was kann ich weiter verwenden, womit Struktur aufbauen und verfeinern? Das gilt auch für die Technik – nicht die Instrumente, sondern das Kompositorische. Daran bin ich eine Weile gescheitert. Es klang für mich zu sehr nach „Steingarten“ oder „Wald“. In dieser Zeit steuerte ich ja auch in großen Schritten auf das 20-jährige Jubiläum von Pole zu. Ich wollte versuchen, einen Bogen zu spannen – von Tag eins bis heute. Also das für mich Beste aus der Trilogie und den folgenden Platten aufgreifen. Das hat gedauert. Eine Platte wie „3“, also das gelbe Album, könnte ich immer wieder schreiben. Aber will ich das? Und braucht es das noch? Anfang 2018 platzte der Knoten und ich fing an, konzentrierter an diesem Album zu arbeiten. Damals wusste ich ja noch nicht, dass die Trilogie wiederveröffentlicht werden würde. Ich hätte das sowieso nicht gemacht – ich empfand das als nicht wirklich wichtig.
„So formte sich die Idee, dass ich das neue Album dazu nutzen wollte, mich selbst an die vergangenen Jahre zu erinnern.“
Warum?
Zu einem natürlich, weil sie für mich schon lange fertig ist. Ich bin mittlerweile woanders. Ich dachte auch, dass sich vielleicht niemand mehr dafür interessieren würde. Dass die Platten einen gewissen Stellenwert haben in der elektronischen Musik, weiß ich schon, aber man soll das bitte nicht überbewerten. Das sind drei gute Platten – es gibt aber noch andere drei gute Platten. Ist doch so! (lacht) Während ich also produzierte, erkrankte meine Mutter an Demenz. Das spielt für das Album selbst keine Rolle, ich verarbeitete hier nichts. Aber mich interessierte der Aspekt der Erinnerung. Dass jemand 91 Jahre lang Wissen und Erfahrungen sammelt, sich Verhaltensweisen aneignet und all das dann plötzlich wieder verschwindet – die eigene Geschichte aus deinem eigenen Kopf. Du selbst wirst zwar weiterhin in Erinnerung behalten, hast dem aber nichts zu entgegnen. So formte sich die Idee, das neue Album dazu zu nutzen, mich selbst an die vergangenen Jahre zu erinnern.
Erinnerungen also in den unterschiedlichsten Kontexten. Wenn du an die 20 Jahre Pole zurückdenkst: Was waren prägende Momente?
Musikalisch auf jeden Fall die Lernkurve, die ich absolviert habe. Von diesem komischen Musiker, der in den späten 1990er-Jahren nach Berlin zieht und auf einmal erklärt bekommt, dass seine Musik mehr Dub und Reggae ist, als er es selbst je vermutet hätte. Mein Background ist ja eigentlich HipHop und Jazz. Bis zu der Erkenntnis, dass viel, viel weniger in einem Track oft einfach viel, viel mehr bedeutet. Das hat mir Berlin beigebracht – ohne dabei minimal zu sein. Das ist das eigentlich Interessante, denn gerade den Minimal Techno fand ich nie besonders spannend. Aber Dinge wegzulassen und dafür einfach den Hall aufzumachen, war befreiend. Da dachte ich bei mir: Gott sei Dank, ich habe es verstanden. Diese Arbeitsweise macht einfach viel mehr Spaß, als im Umkehrschluss immer noch eine Melodie drauf zu setzen. Das hat auch seine Berechtigung, es war nur einfach nicht mein Weg.
„Solche künstlerischen Charaktere waren immer meine Vorbilder. Musiker*innen, die sich weiterentwickeln wollen.“
Du hast in den folgenden Jahren – nach der Trilogie – deinen Sound nicht nur konstant weiterentwickelt, sondern auch in unterschiedliche Richtungen getrieben. Der Kern war jedoch immer erkennbar.
Die Frage, die ich mir von Beginn an immer wieder gestellt habe: Was sind die Möglichkeiten für mich als Künstler? Zwei Dinge: Entweder arbeite ich mich an ein und demselben Thema immer weiter ab. Dann ist das Ergebnis inhaltlich bestimmt und nicht formal. Ich denke dabei an Gerhard Richter, der das in bestimmten Reihen seiner Bilder genau so umgesetzt hat. In der Musik funktioniert das ganz ähnlich. Man kann ein bestimmtes Projekt so lange ausreizen, bis man einfach nichts mehr zu sagen hat. Formal ändert sich auch nichts, nur vielleicht die Länge der Stücke. Total okay. Aber irgendwann ist halt Schluss, und man startet ein neues Projekt – mit neuem Namen und anderem Fokus. Die andere Möglichkeit ist, unter deinem Namen zu versuchen, über einen langen Zeitraum wirklich weiterzukommen. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als irgendwann die Form zu verändern und den Kopf zu öffnen. Sonst fühlt sich das an, als gäbe es jeden Abend Nudeln mit Tomatensoße. Einigen gelingt das gut. Depeche Mode zum Beispiel – was haben die für eine Entwicklung durchgemacht. Man muss dann ja nicht mal jedes Album gut finden. Solche künstlerischen Charaktere waren immer meine Vorbilder. Musiker*innen, die sich weiterentwickeln wollen.

Stefan Betke vor langer, langer Zeit. Foto: Tina Winckhaus
Pole war also von Anfang an als langfristiges Projekt angelegt.
Ja. Und um den Horizont zu erweitern, habe ich die unterschiedlichsten Dinge versucht. Mal mit Band, dann wieder mit Fat Jon als Vocalist – meine HipHop-Wurzeln eben. Ich bin nicht mit allem aus diesen Zeiten zufrieden. Vieles hätte ich besser ausarbeiten können oder es vielleicht auch gar nicht erst machen müssen. Aber das Scheitern gehört dazu, ich empfinde das nicht als schlimm. Schon eher, als dann Hardcore-Fans der ersten Platten leicht vorwurfsvoll fragten, warum ich denn nicht mehr knacken würde. Anfangs war ich tatsächlich persönlich beleidigt. Es dauerte eine Zeit, bis ich begriff, dass das alle für sich selbst entscheiden müssen. Ich wollte nicht „1“, „2“ oder „3“ nochmal machen. Nie. Ich hätte es mir einfach machen können – die immer selbe Platte in einem andersfarbigen Cover nochmal zu verkaufen.
„Egal ob du an der Bar stehst, auf dem Klo, im Garten oder auf dem Mainfloor bist: Überall läuft der gleiche Track.“
Im Streaming würde das bestimmt funktionieren. Die Aufmerksamkeit ist schlichtweg nicht mehr da.
Und das betrifft nicht nur die Musik – Film und Literatur genauso. Gerade erst habe ich den Film „I’m thinking of ending things“ von Charlie Kaufman auf Netflix gesehen. Der ist so unfassbar langsam. Endlose Einstellungen. Ich dachte, solche Filme gibt es gar nicht mehr. Wenn nicht alle zwei Sekunden ein Schwert über die Leinwand fliegt. In der Musik ist das ja das Gleiche. Was ich nie verstanden habe: Die Aufmerksamkeitsspanne bei Musik ist geschwunden – wenn Menschen aber in den Club gehen, können sie sich den gleichen Track fünf Stunden lang anhören. Warum hat sich das dort nicht verschoben? Egal ob du an der Bar stehst, auf dem Klo, im Garten oder auf dem Mainfloor bist: Überall läuft der gleiche Track. Und da wird keiner müde, ganz egal, wie wenig passiert. Es scheint also einen großen Unterschied zu geben zwischen dem, was man zu Hause hören möchte und im Club. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu alt.
Ich habe darüber vorhin tatsächlich nachgedacht. Ist die Erinnerung im Kontext der elektronischen Musik eigentlich Segen oder Fluch? Ich bin mir nicht sicher, denke aber manchmal: Vergessen wäre eine gute Strategie für die Zukunft.
Weiß ich nicht. Im Club ist es wahrscheinlich komplett egal, ob man nun weiß, was Carl Craig Anfang der 90er-Jahre gemacht hat. Ich finde es total okay, wenn junge Leute heutzutage mit Breakbeats arbeiten, ohne sich en detail in der UK-Geschichte auszukennen. Das interessiert die auch gar nicht. Ich stimme dir also schon zu: Vielleicht ist das Vergessen manchmal genau das Richtige. So kann man frisch und unbelastet an etwas herangehen. Es ist doch auch scheißegal, ob Basic Channel den Dub-Chord XY nun geschrieben haben oder nicht. Hauptsache, es begeistert die Leute noch immer – in welchen Variationen auch immer. Wenn ich aber über Musik als großes Ganze spreche, über Dinge, die ich mir auch ganz bewusst zu Hause anhöre, glaube ich, es ist durchaus hilfreich zu wissen, warum Komponist*innen sich so und eben nicht anders entschieden haben. Warum sie Dinge weggelassen haben zum Beispiel. Was mit hingegen total egal ist, sind Begriffe wie Originalität oder Authentizität. Daran glaube ich nicht. Das Gleiche gilt für Referenzen. Wenn ich zufällig eine aufmache, muss ich sie nicht zwanghaft wieder rausschmeißen. Das spielt im Kontext des Stücks einfach keine Rolle. Aber ich habe ja eh einen komischen Ansatz im Umgang mit der Musik.
Kannst du den beschreiben?
Ich glaube tatsächlich: Ich bin ein wahnsinnig schlechter Komponist.

Pole, Fading, ist Mute erschienen.
Äh, okay?
Ich meine das durchweg positiv. Ich mache Sachen einfach so, wie ich sie mache. Und allein deshalb sind sie anders. Immer, wenn ich ein Album fertig habe, stelle ich mir die gleichen Fragen: In welchem Kontext kann das funktionieren, wo könnte ich die spielen? Ich habe auch immer wieder die Diskussionen mit Veranstalter*innen von Festivals. Ich höre dann: Ich finde die Platte super, an welchem Tag soll ich dich denn buchen? Du passt nicht dazu, nicht dazu, nicht dazu. Das heißt: Ich komponiere nicht zweckgebunden. Und da gibt es auch keine Anpassungsmöglichkeiten.
Dann reden wir doch mal ganz konkret über „Fading“. Ich empfinde das Album als zickiger als sonst. Was vielleicht mit den Beats zu tun hat, die viel lebendiger klingen, als bei deinen vorherigen Alben. Die Rhythmus-Sektion ist für mich bestimmt von einer frei-programmierten 808 – ganz egal, ob du nun das Original oder Samples verwendest.
Perfekt erkannt.
„Ich weiß nicht, warum das nun passiert ist, ich bin darüber aber sehr glücklich. Geplant war das nicht.“
Gleichzeitig finde ich die Platte auch extrem „moody“. Was mit einem Thema bzw. mit einem Twist zu tun hat, den ich zu erkennen glaube. Stehende Töne, die ich sofort als Melodie wahrnehme, was anderen jedoch bestimmt anders geht. Das ist eine Stimmung, die ich in dieser Ausprägung so von dir bislang nicht kannte, die mich aber extrem anfasst. Bei dir ist emotional also offenbar in den vergangenen Jahren etwas passiert. Magst du darüber sprechen?
Vielleicht ist es so, dass mir beim Spielen und Programmieren dieses Mal etwas gelungen ist, woran ich in der Vergangenheit immer wieder gescheitert bin. Ich habe das Narrativ bei Alben durchaus immer im Blick. „Wald“ war so – wenn auch sehr vertrackt und schwer zugänglich. Bei „Fading“ wollte ich diese Wärme, die du beschreibst, in den Vordergrund stellen. Auch als eine Art Schutzhülle gegen das Vergessen. Die Tiefe war wichtig, unterstützt von meinen bekannten Dub-Referenzen. Die Entscheidung, Töne einfach mal stehen zu lassen – im Unterschied zu vorherigen Alben, bei denen ich perkussive Akkorde in A-Moll eher kurz akzentuiert und dann im Echo habe untergehen lassen ... Ich weiß nicht, warum das nun passiert ist, ich bin darüber aber sehr glücklich. Geplant war das nicht. Ich wollte immer Musik machen, die einen in ihren Bann zieht. Das ist mir, glaube ich, mit der neuen Platte zum ersten Mal wirklich geglückt. Als das Album fertig war, gab es natürlich viel mehr Tracks, als nun veröffentlicht werden. Rausgeschmissen habe ich letztendlich dann die, die zu nah an „Wald“ oder „Steingarten“ waren – einfach zu perkussiv. Ein Beispiel ist „Tangente“. Der Track besteht eigentlich ja aus nichts außer einem Beat, einem Basston und einem stehenden Ton. Und alle drei Minuten kommt da diese Melodie rein. Ich war so glücklich, als ich dieses Stück im Album-Verbund gehört habe – weil es einerseits diese Unterbrechung zum düsteren Grund-Duktus der LP zeigt … es ist ja eigentlich ein funky Stück. Das aber gleichzeitig mit den gleichen, reduzierten Methoden funktioniert.
Für mich ist „Moodyness“ eigentlich immer der kleinste gemeinsame Nenner. Daraus können sich die unterschiedlichsten Entwürfe entwickeln, ich fühle mich aber von vornherein als Teil dessen, was auch immer hier gerade entsteht. Das hat für mich auch eine andere Qualität als der klassische A-Moll-Akkord. Das ist eine neue Qualität in deiner Musik.
Das können nur die Hörer*innen entscheiden. Ich schaue natürlich anders auf meine Musik. Wenn das so ist, nehme ich das dankbar an. Das heißt ja: Ich habe mit diesem Album mein Ziel erreicht – und etwas in meine Sprache aufgenommen, was ich hoffentlich beibehalten und woran ich bei der nächsten Platte wieder anknüpfen kann. Ich brauche immer ein, zwei Jahre, um das zu reflektieren. Aber: Gut Ding will Weile haben. Hat ja auch acht Alben gebraucht.
Erinnerung hat immer etwas mit Zeit zu tun – und die spielt in deiner Musik von jeher eine große Rolle. Auch wenn es nur um das Arrangement der Rhythmen geht und die Verschiebungen, dir dort stattfinden. Ich hatte es schon erwähnt: Ich empfinde „Fading“ als sehr lebendig auf dieser Ebene. Sehr frei und fließend. Was fasziniert dich generell an diesem Flow?
Flow ist ja immer nur dann Flow, wenn es über einen längeren Zeitraum tatsächlich schließt. Sonst hat man immer nur eine sequenzielle Wiederholung.
Das kann ja schon gut sein.
Unbedingt. In diesem Fall war es so, dass die Einfachheit in den Stücken – bis auf „Nebelkrähe“, was eher komplex ist – die Möglichkeit für rhythmische Verschiebungen überhaupt erst aufmacht. Nur so kann man sie wirklich wahrnehmen. Etwas Komplexes lässt sich heute am Computer ohne Probleme programmieren. Es aber so zu gestalten, dass es auch erkennbar ist, Lebendigkeit und ein Atmen verursacht – das ist nicht ganz so einfach. Dass mir das gelungen ist, hat vielleicht zwei Gründe. Ich habe heuer zum ersten Mal ein Studio, in dem ich aus dem Fenster in die Weite schauen kann – es liegt im Dachgeschoss. Das schafft Freiraum im Kopf. Ich verstehe jetzt auch, warum Maler*innen große Ateliers brauchen. Der andere Grund ist, dass ich mich für die Produktion auf minimales Equipment geeinigt habe. 808, den MiniMoog für den Bass und die TR-8 für die stehenden Töne – that’s it. Zwei Effektgeräte kamen noch dazu. Dann ging es nur darum, die Beats mit Leben zu erfüllen, morphen zu lassen, auch gegen den Strich zu bürsten.

Noch ein junger Pole. Foto: Tina Winckhaus
Guter Punkt: Weil seit einiger Zeit ja genau das das das Alleinstellungsmerkmal junger Künstler*innen ist – gerade auch aus UK. Beats werden immer komplexer und schwerer nachzuvollziehen. Aber wenn man sich diese Ebene wegdenkt, ist es halt oft nur langweilig und eindimensional. Es ist immer mehr von den Extremen bestimmt.
Das ist ganz komplex. Ich höre als Mastering-Engineer ja sehr viel Musik sehr früh. Nicht nur aus UK, auch aus Südafrika oder Vietnam zum Beispiel. Die sind Typen, die gerade dabei sind, sich Virtuosität anzueignen. Früher hätten wir das angeprangert. Beim Schlagzeuger zum Beispiel, der zwar komplex spielt, bei dem man aber genau hört, dass ihm irgendwie die Basis fehlt. Das nannte man Muckertum. Jetzt befinden wir uns mitten im Computer-Muckertum. Wenn etwas geht, dann mach ich das.
Richard Divine, 2.0.
So ungefähr. Aber er war auch einfach der erste und dabei extrem radikal. Viele eignen sich sich diese Virtuosität einfach gerade an – ohne das ebenso wichtige Grounding zu haben. Ich wünsche mir dann manchmal beim Mastering, dass sie nochmal ins Studio gehen würden, um das wirklich zu finalisieren. Aber das geht ja eigentlich nur mit einem wie auch immer gearteten historischen Bewusstsein. Im direkten Bezug zu mir: Ich hätte damals das erste Album schon fertig gemacht. Aber erst der Kontakt mit bestimmten Leuten in Berlin hat mir die richtigen Bezüge eröffnet. Sonst wäre ich wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich kann das jetzt nicht mehr überprüfen, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Heute ist das Lose und das Virtuose oft ganz eng miteinander verknüpft. Ich finde das total spannend, auch wenn es oft einfach nur zu Langeweile führt. Nochmal einen anderen Beat, den Break nochmal komplizierter machen: Das hat bestimmt seine Berechtigung. Ob es aber immer irgendwo hinführt, weiß ich nicht.
An diesen Punkt komme ich immer wieder. Ich kann die technische Cleverness und Brillanz einer Produktion wertschätzen. Die eigentliche Frage ist doch aber, was das mit einem macht oder ob es überhaupt noch etwas mit einem macht.
Klar. Ich habe aber zwei unterschiedliche Sichtweisen. Als Produzent würde ich mich freuen wie Bolle, wenn ich diesen Beat so hinbekomme, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Die Frage nach der Zugänglichkeit stellt sich da gar nicht. Als Hörer aber muss ich einfach entscheiden: Ist das nun meins oder nicht? Das ist doch das Schöne an Kunst: Sie lebt zunächst nur für sich selbst, muss weder gehört noch gesehen werden. Sie hat immer ihre Berechtigung – auch dann, wenn du 1.000 Bilder malst und sie nur in den Schrank packst. Wenn du dich aber dazu entscheidest, deine Kunst öffentlich zu machen, wird sie Teil des Diskurses. Dann gelten andere Spielregeln, mit denen du leben musst. Aber genau das tun die jungen Leute ja auch. Die sagen klipp und klar: Weißt du was, alter Mann? Ob du das jetzt gut findest oder nicht, ist mir total egal. Ich finde das gut. Sie sollen sich abkämpfen an dem ganzen Quatsch und ihre Fehler machen. Wenn von 500 dieser Kids nur drei übrig bleiben, die ihren Weg finden: Dann haben wir alle gewonnen.