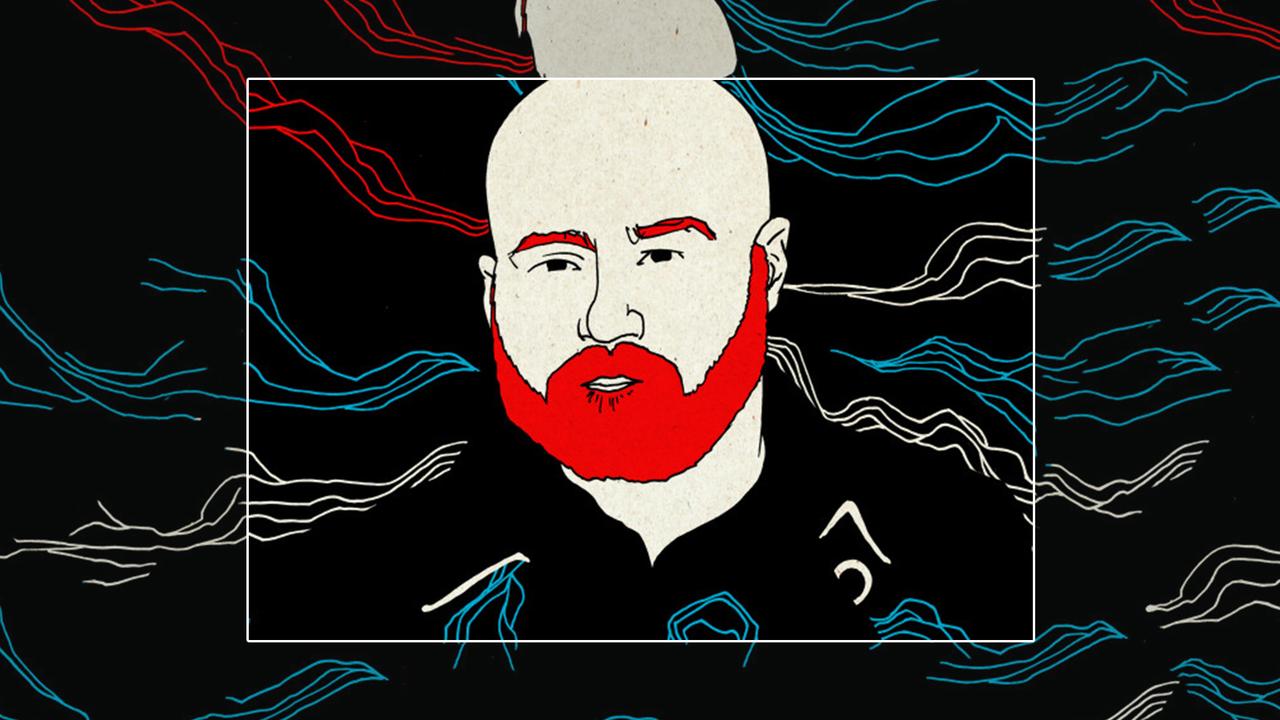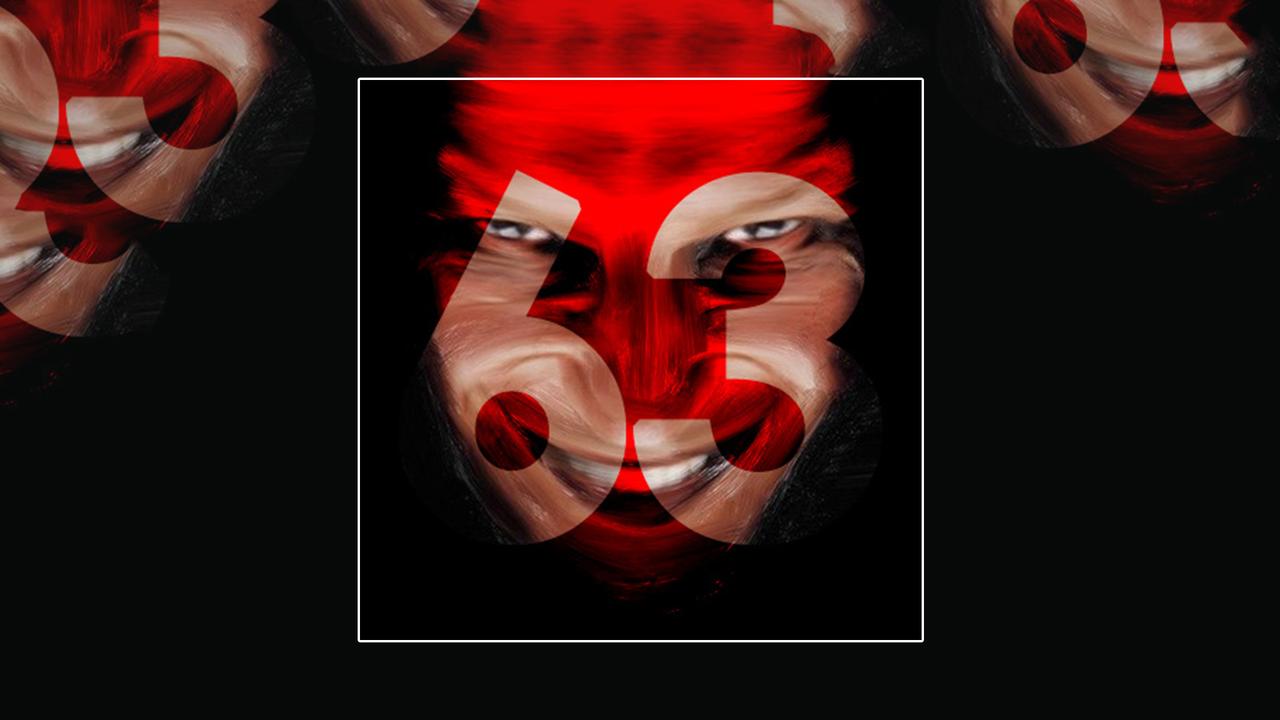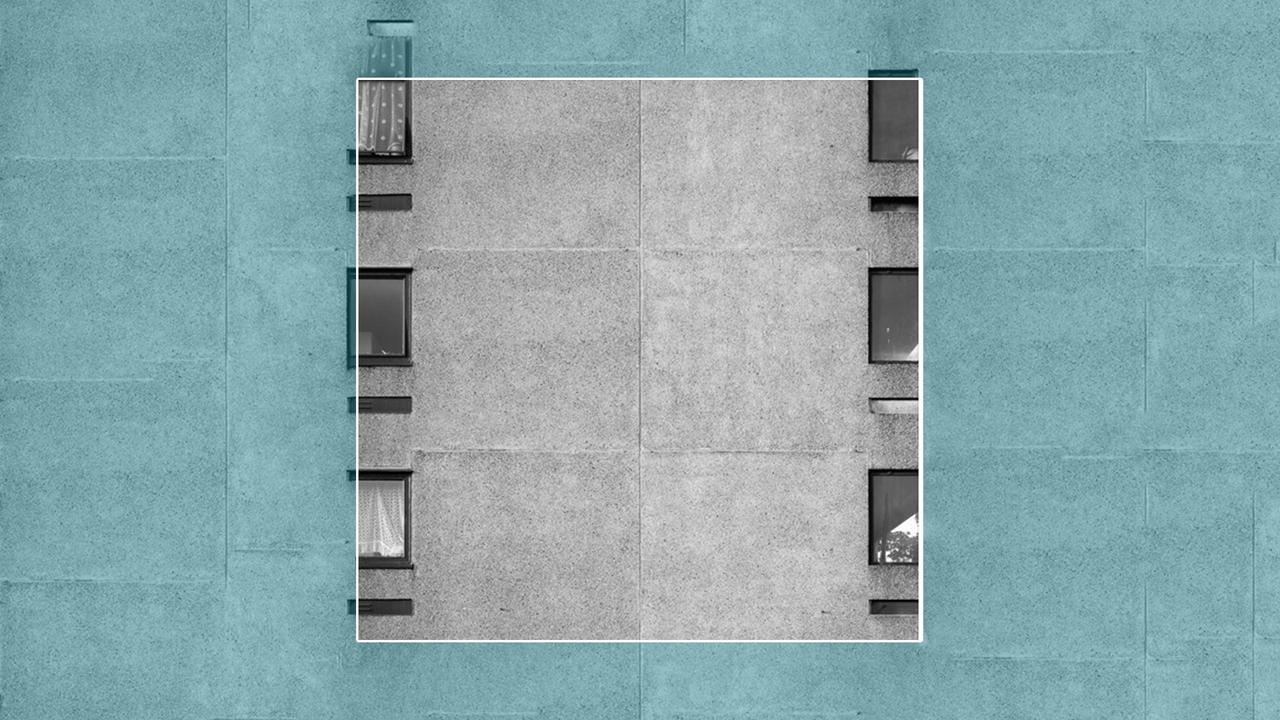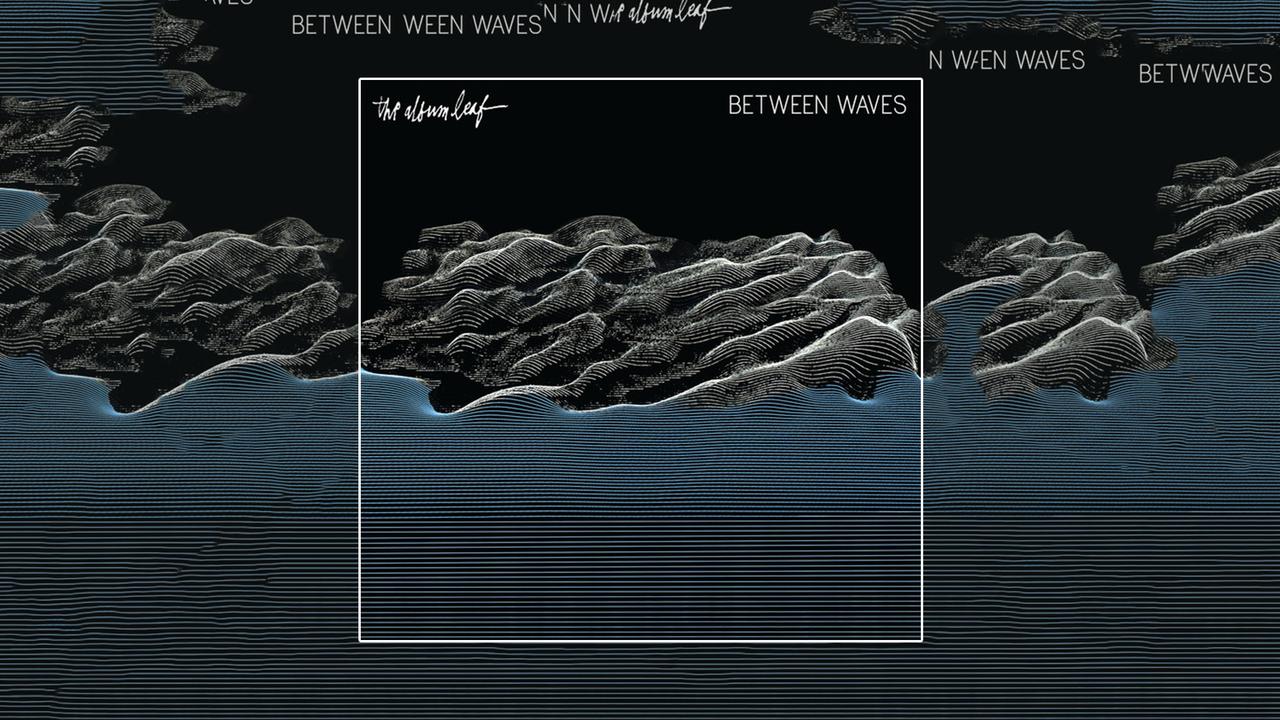Plattenkritik: Jóhann Jóhannsson – OrphéeKatharsis in Moll
16.9.2016 • Sounds – Text: Thaddeus Herrmann
Nach sechs Jahren Arbeit in Hollywood legt der isländische Komponist und Wahl-Berliner endlich sein neues Album vor.
Ich kann mich nur an wenige Platten erinnern, mit denen ich im Vorfeld ihrer Veröffentlichung so viel Zeit verbracht habe wie mit „Orphée“, dem neuen Album von Jóhann Jóhannsson. In den vergangenen vier Wochen lief es mindestens einmal pro Tag durch meine Ohren, meistens von A bis Z. Eine wirklich aussagekräftige Meinung habe ich jedoch immer noch nicht, gerade im A-bis-Z-Kontext.
Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass es Musikerinnen und Musiker gibt, bei denen ich keinen Widerspruch dulde. Jóhannsson ist einer davon. Seine Musik hat mich über die Jahre geprägt wie kaum etwas anderes. Entsprechend groß war die Vorfreude, dass sich der in Berlin lebende Isländer nach zahlreichen Soundtracks, mit denen er in Hollywood praktisch über Nacht zum gefragten Komponisten wurde, nun wieder auf etwas „eigenes“ konzentrieren würde. Auch wenn im persönlichen Gespräch schnell klar wurde, dass Jóhannsson jemand ist, der sich gerne den Geschichten und Vorgaben anderer unterwirft und mit seiner Musik dann orchestriert. Jóhannsson erzählt Geschichten. Ob das seine eigenen sind oder nicht, macht für ihn keinen großen Unterschied.
Natürlich hat auch dieses Album eine Geschichte. Eine Geschichte, einen Aufhänger, den Jóhannsson aber erst finden musste. Schon 2009 entstanden die ersten Skizzen für die Platte, von der er noch gar nicht wusste, ob sie sich jemals tatsächlich so manifestieren würde. Es scheint eine Art künstlerischer Ausgleich gewesen zu sein zu seinem sonst randvollen Termin- und Projektkalender. Kleine Miniaturen, kurz und unauffällig, noch ohne Kontext und ohne Ziel, bestimmt aber schon mit Wirkung. Doch schließlich klickte es. Es geht um Orpheus, den von Eurydike, also den von Ovid. Den Rest kann man nachlesen im kleinen Büchlein, das dem Album beiliegt. Jóhannsson projiziert die Geschichte auf sich selbst, darauf, wie er sich selbst von seiner Heimat Island trennt, Menschen und Beziehungen zurücklässt und in Berlin den Neuanfang sucht. Jóhannssons Blick auf die Stadt ist mindestens so romantisch wie der Klang von „Orphée“. Denn natürlich hat er nicht das Berlin vor Augen, in das er umzieht, sondern das, was die Stadt einst repräsentierte, diese vage Dunkelheit, eine Stadt, in der nichts wirklich klar formuliert ist außer der Trennlinie aus Beton, die sie durchzieht.

Das Skizzenhafte an „Orphée“ ist es dann auch, was beim Rezensenten emotionale Unruhe stiftet. Jóhannssons frühe Alben waren bestimmt von langen und sehr ausdeklinierten Kompositionen, lediglich angereichert von kleineren Versatzstücken. Hier ist es andersherum: „Flight From The City“, das Eröffnungsstück und einer der besten Tracks auf der Platte, aber auch einer seiner besten überhaupt, nimmt einen mit auf eine Zeitreise in Richtung „Jóhannsson 1.0“. Es folgen kurze Entwürfe, Motive wiederholen sich, immer auf den Punkt, aber eben auch immer kurz und episodisch, fast wie vorbereitet für einen Film, dessen Drehbuch erst noch geschrieben werden muss. Es ist nicht alles süßlich, nicht alles Hollywood-gerecht weichgespült, an einigen Stellen wird man jedoch das Gefühl nicht los, dass dort, wo früher ein Ozean wogte, man heute bis auf den Grund in nur geringer Tiefe schauen kann. Es ist ein Wechselspiel im getragenen Tempo. Tief und flach, flach und tief.
Das alte Berlin mit der nicht enden wollenden Konfrontation zwischen Ost und West ist vielleicht auch der Grund dafür, warum Jóhannsson einige der Kompositionen mit Samples der so genannten „Number Stations“ anreichert. Er selbst referenziert Jean Cocteaus Film „Orphée“, in dem Schauspieler Jean Marais wie besessen immer wieder diesen Radiostationen unbekannten Ursprungs zuhört, diesen Sendern, auf denen Frauen und Männer offenbar zusammenhangslose Zahlen vorlesen. Ein Code, ganz offensichtlich, nur zu dechiffrieren, wenn man das dafür benötigte Alphabet kennt. Mit Hilfe der Number Stations kommunizierten Geheimdienste weltweit mindestens bis in die 1990er-Jahre mit ihren Agentinnen und Agenten weltweit. Nicht zu knacken, dieser Code. Und so clever aufgezogen, dass man manchmal glauben konnte, hier funke nicht der MI6 nach Panama, sondern es sei ein experimentelles Pausenprogramm von Radio Bukarest. Erst Musik, dann Zahlen, dann Rauschen, dann wieder Musik. Heute wissen wir das, weil das Phänomen gut dokumentiert ist. Nicht zuletzt mit der üppigen CD-Box The Conet Project, erschienen 1997 auf dem großartigen Londoner Label Irdial. The Conet Project ist immer noch eines der verstörendsten und längsten Dokumentar-Hörspiele aller Zeiten. Aber gleichzeitig auch bis in alle Ewigkeit ausgeschlachtet als Quelle für Samples und rauschende Field Recordings. Dass Jóhannsson sich hier bedient, hinterlässt ein wenig Ratlosigkeit. Es ist kein Fettnäpfchen, das dissonante Gegenüber für Jóhannssons Musik hätte er aber auch anders umsetzen können.
Das alles ist nicht weiter wichtig, „Orphée“ ist dennoch ein brillantes Album, mein Hadern mit den Number Stations vielleicht auch nur darin begründet, dass eben jene CD-Box bei mir damals nachhaltig – kurz unter Jóhannsson-Niveau – Eindruck hinterließ. Das Album ist eine sichere Bank und gewiss ein gelungener Startschuss für den Isländer auf der Deutschen Grammophon, wo dieses Album erscheint. Eine sichere und ausgesprochen versöhnliche Bank. Spätestens beim letzten Stück, der „Orphic Hymn“, brechen alle Dämme. Wenn das Vocal-Ensemble Theater Of Voices unter der Leitung von Paul Hillier eine kurze Passage von Ovids Metamorphosen vorträgt, spätestens dann verzeiht man Jóhannsson wieder mindestens alles. Auch diese Zusammenarbeit werden einige als Klischee abtun. Einen Unterschied macht das nicht.
Jóhann Jóhannsson, Orphée, ist bei Deutsche Grammophon erschienen. Jóhannsson spielt zwei Konzerte in Deutschland: 1. Dezember, Berlin – Funkhaus / 10. Februar 2017, Hamburg – Elbphilharmonie