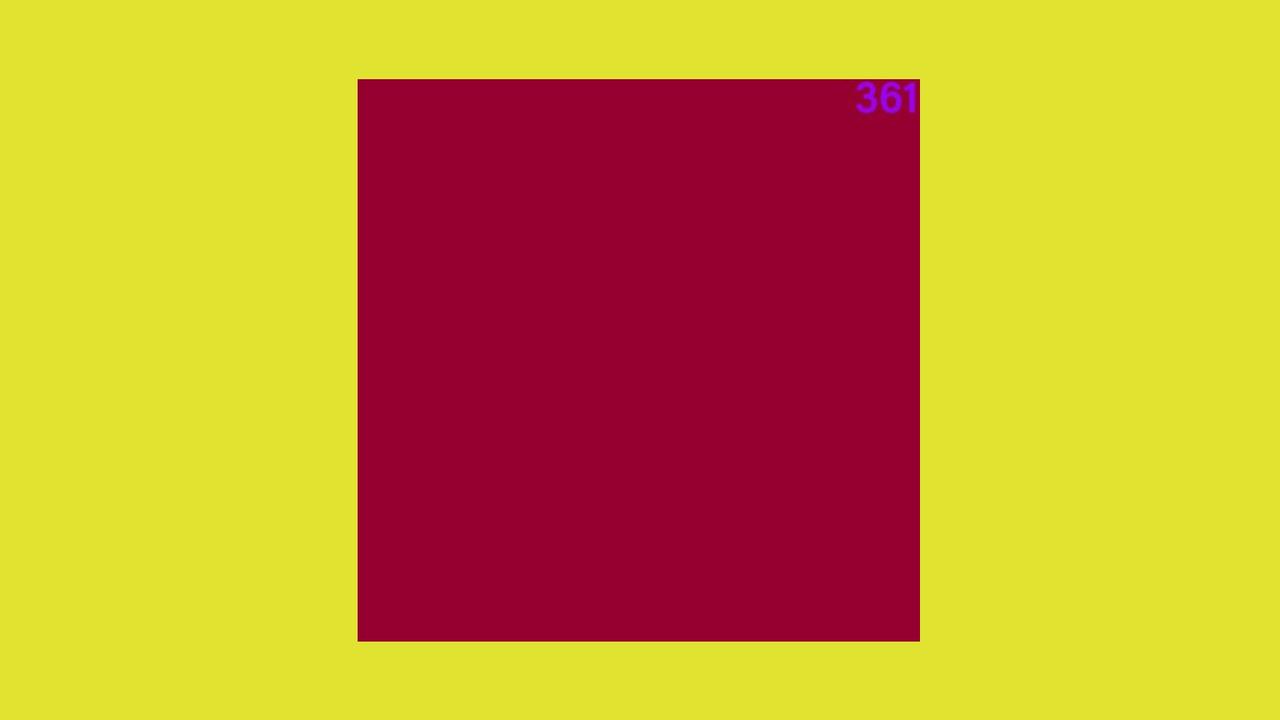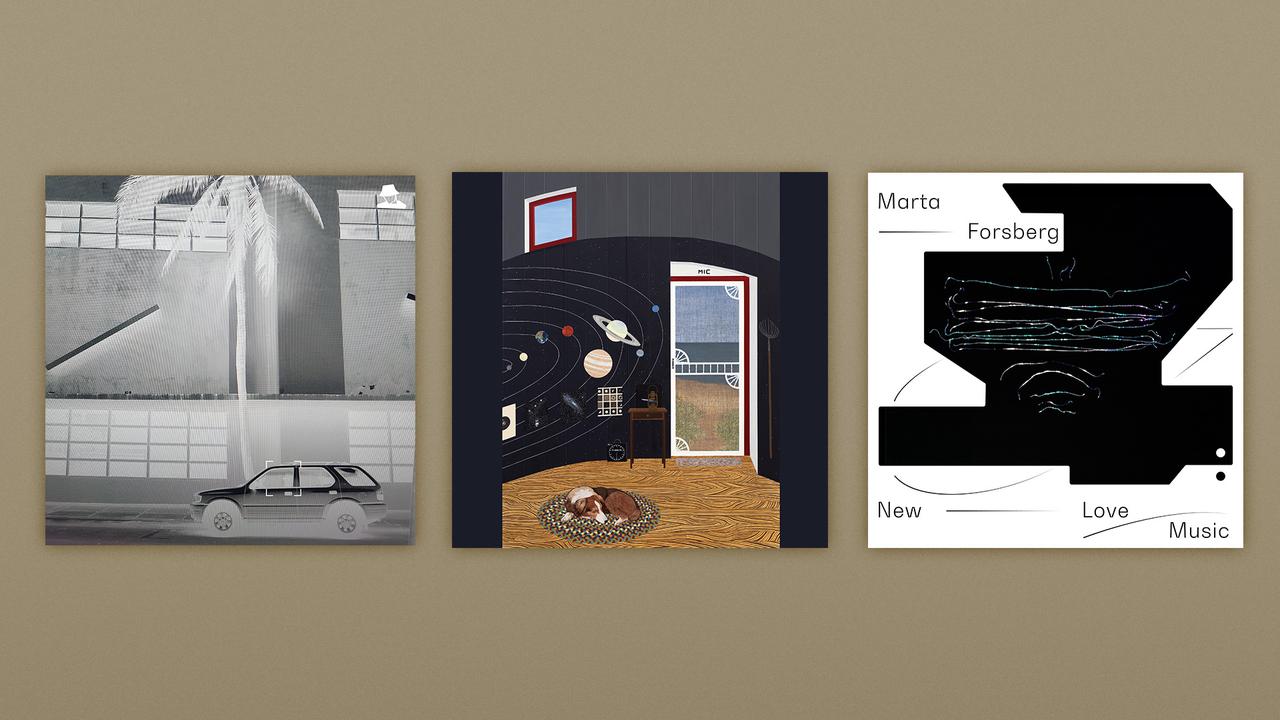Jeden Freitag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Nicht immer neu, doch immer die Erwähnung wert. Heute mit: Martyn Heyne, Sarah Davachi und Oneohtrix Point Never.
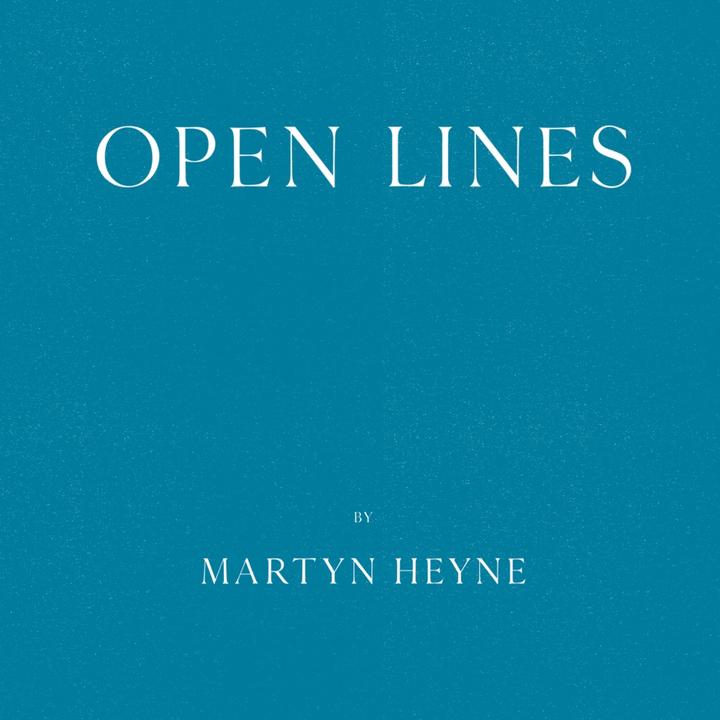
Martyn Heyne – Open Lines
Thaddi: „Electric Intervals“, das letzte Album von Martyn Heyne, fand ich vom ersten Tag an großartig und ist mir seitdem eigentlich nur noch mehr ans Herz gewachsen. Umso erfreuter war ich, als sich Heyne im Spätsommer meldete und sein neues Album schickte. Wie das bei ihm funktioniert mit der Musik hatten wir uns ja schon vor einer ganzen Weile angeschaut. Natürlich ist „Open Lines“ wieder großartig. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Heyne ist an der Gitarre, an allen anderen Instrumenten und vor allem im Studio so brillant-einzigartig, dass jeder Ton, jeder Akkord, jede Drumroll und jeder Rhodes-Tupfer auf eine ganz besondere Art zu mir spricht. Mir macht das Flügel.
Den Begriff der Deepness habe ich im House gelernt. Das war für mich eine Revolution, weil mir dieses gleichzeitig abstrakte und doch gemeinschaftliche Eintauchen in Musik bis dahin eher fremd war. Danach habe ich den Begriff rückwärts auf meine damalige Lieblings-Musik angewendet und oft einen ganz neuen Zugang zu ihr gefunden. Egal ob elektronisch oder akustisch, Vocals oder instrumental, Track oder Song. Deepness hat für mich etwas mit Fokus zu tun. Und Heyne ist jemand, der sich in jeder Komposition ganz enorm fokussiert. Ob nun ausschließlich auf sein Gitarrenspiel mit perfekt abgestimmten Stereo-Delay dahinter oder im selbst erschaffenen „Band“-Kontext. Sein Songwriting sticht heraus, ist einzigartig und lässt keinen Zweifel daran, dass hier gerade etwas Außergewöhnliches geschieht. „The Hall“ ist natürlich das perfekte Beispiel dafür: eine endlos anmutende Gitarren-Miniatur, hoch komplex und dabei doch so wunderbar umarmend. Mir fehlen in diesen Zeiten ja ohnehin ständig die Worte, bei dieser Musik jedoch bleibt mein Mund einfach nur offen. Das hat etwas Aquatisches, in das man untertauchen, sich geborgen fühlen will. Und wenn ich mich heuer, Anfang November, für ein Stück des Jahres entscheiden müsste, dann wäre es „The Hall Reprise“, in dem die Hektik der Gitarre des Originals von einem Cello aufgenommen und rekontextualisiert wird – in ein ätherisches Lullaby für 2020. Es ist eines der wichtigsten Alben unsere Zeit. Nicht mehr, nicht weniger.

Sarah Davachi – Figures In Open Air
Ji-Hun: Die kanadische Komponistin Sarah Davachi hat im Laufe ihrer Karriere einen einzigartigen Sound entwickelt. Davachi studierte neben Philosophie elektronische Musik in Calgary und arbeitet mit modularen Synthesizern und analogen Instrumenten wie Orgeln und Saiteninstrumenten. Die Presse ordnete Sarah Davachi irgendwo zwischen Terry Riley und Eliane Radigue ein und mit so einem Referenzrahmen lässt es sich gut leben. „Figures In Open Air“ basiert auf Konzertaufnahmen, die in Berlin, Chicago und San Francisco produziert wurden. Ausufernde Drones, die vor allem auch durch ihre Räumlichkeit atmen. Zumal wir kaum wissen, wann die musikalischen Räume wieder die soziale Wirkung haben werden wie noch im letzten Jahr. Im gleichen Zug lohnt es sich, Davachis Album „Cantus, Descant“, das ebenfalls dieses Jahr erschien, noch einmal zu hören. „Figures in Open Air“ versteht sich als komplementäres Stück, auch weil Werke des Albums im Livekontext nochmal völlig anders erscheinen und die Bedeutung von kollektiver Musikerfahrung in realen Räumen untermauert.

Magic Oneohtrix Point Never
Benedikt: Uff. So ungefähr lässt sich mein Gefühl beim Gedanken an Oneohtrix Point Never wohl am besten ausdrücken. Mal klingt mir das alles ein bisschen zu gewollt, andere Sachen sind dann wiederum großartig – nur schwierig scheint's mir immer, auch eine Live-Show im Berghain konnte mich nicht so richtig einfangen. Dementsprechend: Ich war skeptisch. Und die Skepsis sollte auch nicht sofort vergehen, nach den ersten zweieinhalb Tracks wollte ich die Sache schon abhaken. Aber dann kommen kurz mal Drums zu den Streichern und schleiernd hohen Vocals auf der dann lang ausklingenden Ballade „Long Road Home“. Spontane Begeisterung stellt sich ein, die spätestens mit „I Don't Love Me Anymore“ kein Trugschluss mehr sein kann. Wieder diese Vocals, der programmierte Klang echter Drums, denen man Tanzbarkeit unterstellen darf. Das hier sind richtige Songs, eine zweite „Taylor-Swift-Platte“ ist „Magic“ zum Glück aber nicht geworden. Eingebettet ist „Magic“ in ein Radio-Setting, das von verfremdeten Radiosprecher-Samples („Cross Talk“) zusammengehalten wird. Müsste dem Programm nach ein Softrock-Electronica-Sender sein. Dass Daniel Lapotin auch letzteres noch beherrscht, wird dann in der zweiten Hälfte des Albums klar. Da ist sie wieder, diese intellektuelle Auseinandersetzung mit Sound, die aber zugänglich bleibt, was gerade noch ein „Uff“ verhindert. Der nächsten Liveshow würde ich eine neue Chance geben.