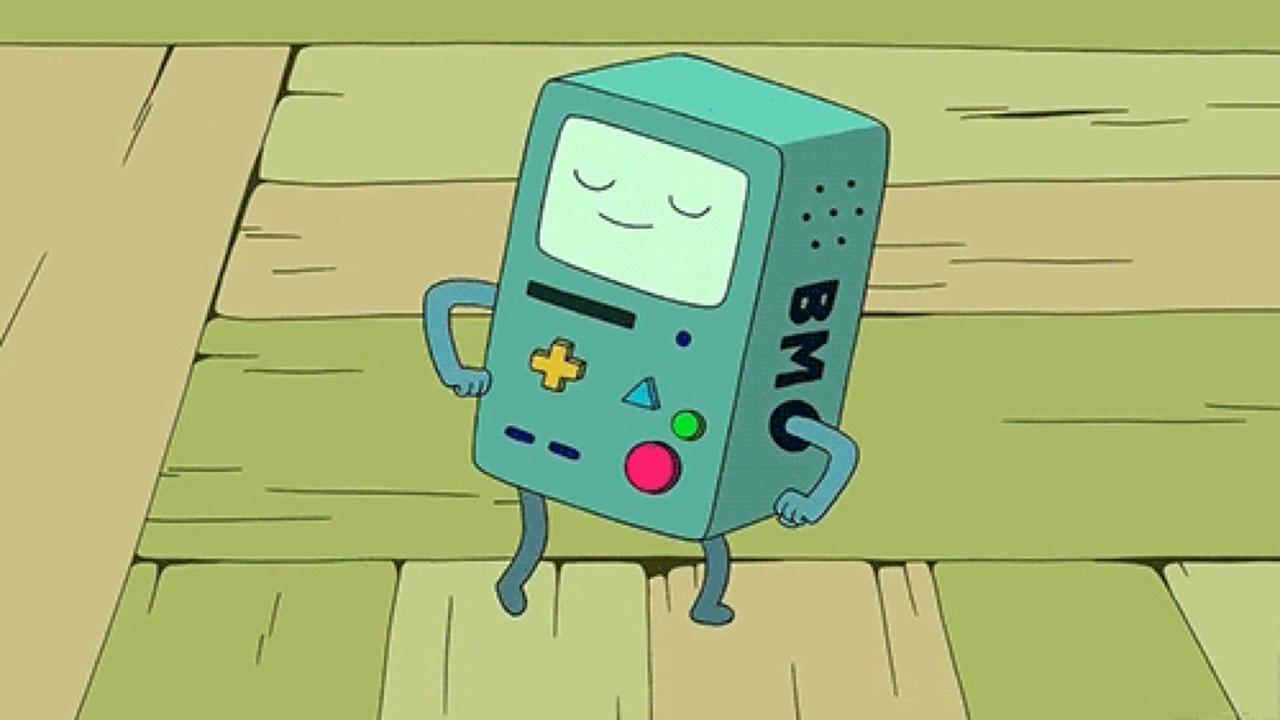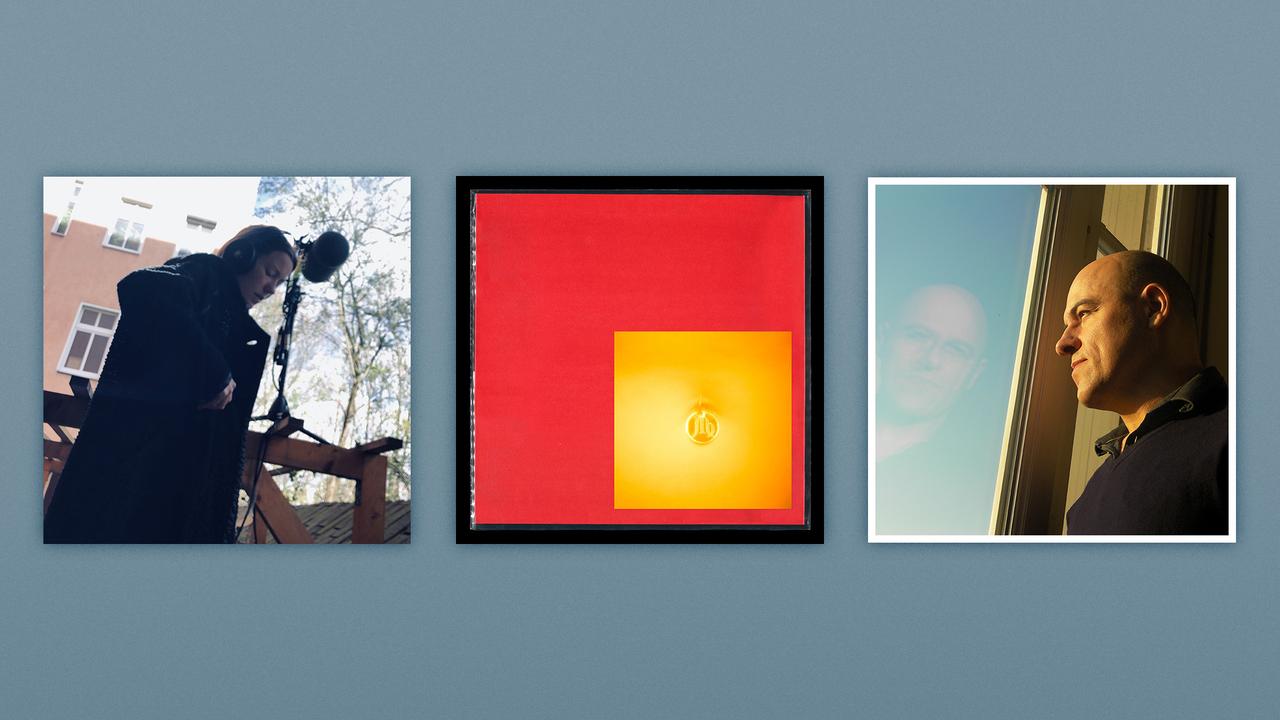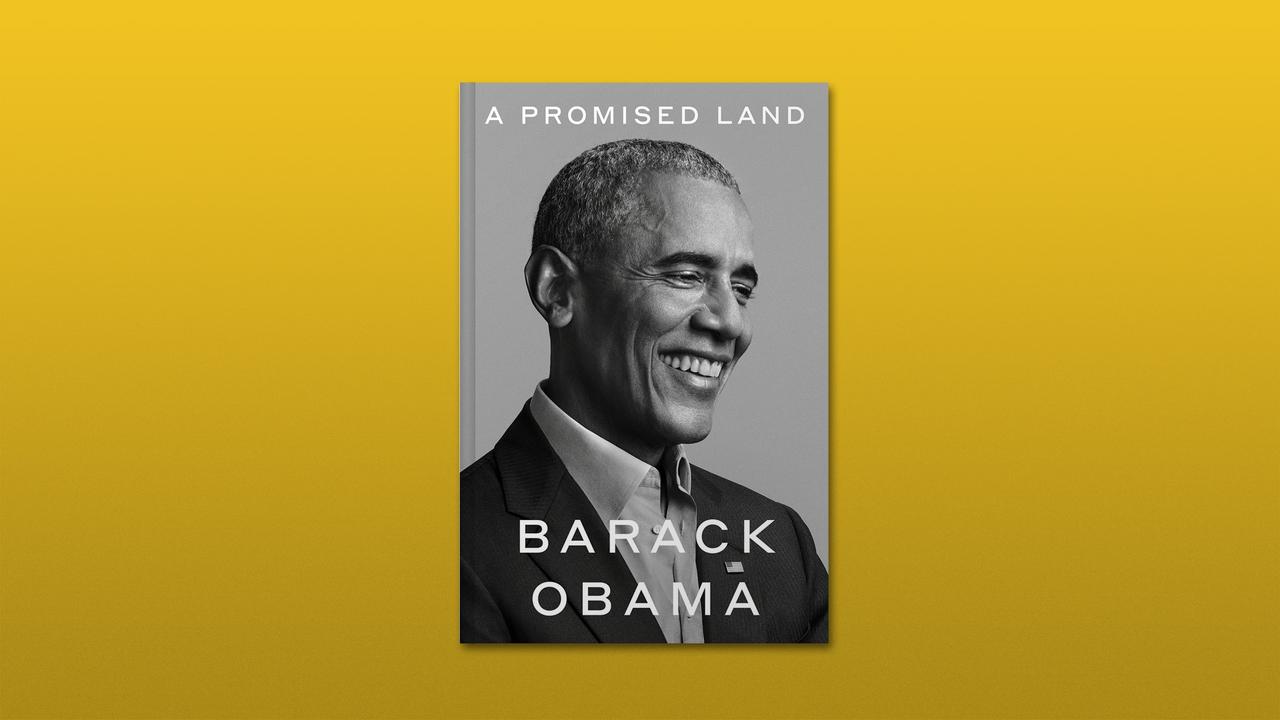„Manchmal denke ich: Lass das Politische doch einfach weg“Interview: Alex Stolze über sein neues Album „Kinship Stories“
4.1.2021 • Sounds – Interview: Thaddeus Herrmann
Fotos: Andrea Huyoff
Viele kennen Alex Stolze noch als Mitglied von Bodi Bill. Die eklektische Mischung aus Akustik und Electronica hat in den Nullerjahren weit über Berlin hinaus für Aufmerksamkeit und Akzeptanz gesorgt. Doch der Produzent mit der fünfsaitigen Geige ist schon lange auf Solo-Pfaden unterwegs. 2018 erschien „Outermost Edges“, ein eindringliches Album, das sich leicht im Popfach einordnen lässt, wenn man nicht genauer hinhören möchte. Doch die Geschichte geht tiefer. Für den gebürtigen Berliner stand soziales Engagement schon immer im Fokus. Ein Engagement, das er seit einigen Jahren in seiner neuen Heimat umweit der deutsch-polnischen Grenze vertieft. Sein neues Album „Kinship Stories“ erzählt diese Geschichte, gegossen in elf Tracks und zahlreiche eindrückliche Videos.
Das Gespräch fand am 9. November 2020 statt. Der Autor wollte den Musiker ursprünglich in seiner Heimat im Brandenburgischen besuchen, die Pandemie-Situation ließ dies jedoch nicht zu. Also traf man sich beim Autoren zu Hause. Am Küchentisch bei Tee mit Hafermilch vergeudeten beide nicht viel Zeit mit der wundervollen Musik Stolzes, sondern sprachen vor allem über sein Leben in der Provinz, soziales Engagement, Gemeinschaft und sein Leben als Jude in Deutschland.
Du lebst seit geraumer Zeit in Brandenburg. Was hat dich nahe an die polnische Grenze verschlagen?
Seit vier Jahren bin ich dort dauerhaft, vor etwa zehn Jahren haben wir damit begonnen, die Häuser zu restaurieren, zunächst die Dächer. Zum Lebensmittelpunkt wurde die Gegend vor fünf Jahren, als ich mit meiner ersten Platte angefangen habe. Ich wollte von Anfang an dort produzieren und mein Studio einrichten. Anfangs bin ich dann immer für mehrere Tage rausgefahren und habe mich praktisch eingeschlossen und aufgenommen.
Stadtflucht also. Erzähl doch bitte von deinen Beweggründen. Die können ja ganz unterschiedlich sein – von einer Horizonterweiterung bis zum kategorischen Bruch mit dem Urbanen.
Ich bin in Berlin geboren, in Köpenick 1976 – und habe den gesamten Wandel der Stadt sehr intensiv miterlebt und -gelebt. ich sehnte mich irgendwann einfach nach einem anderen Blickwinkel auf die Welt. Natürlich reißt meine Beziehung zu Berlin damit nicht ab. Meine Mutter ist gebürtige Berlinerin, mein Geigenbauer hat hier seine Werkstatt und ich bin regelmäßig hier. Die Stadt hat mich geprägt und prägt mich weiter. Entdeckt hatte ich den Spot in Brandenburg schon vor 13 Jahren, noch zu Bodi-Bill-Zeiten. Wir suchten damals nach einem Ort, wo wir im Sommer Musik machen, aber unsere Familien mitnehmen konnten. Es ging natürlich noch nicht darum, ein Haus zu kaufen. Wir nisteten uns dort ein wie, naja, Schwalben im Sommer. Kinder und Musik – darum ging es. In Berlin war es damals schon deutlich schwieriger, solche Orte zu finden. Ich wollte immer frei sein, konnte oder wollte die Gegebenheiten der Stadt nicht mitspielen. Jobs machen oder für die Industrie arbeiten. Mein letztes Studio war auf der Köpenicker Straße. Das Haus ist mittlerweile längst abgerissen. Damals wollte ich eigentlich weg aus Deutschland. Das war nicht so einfach, denn natürlich hatte ich in Berlin viele Freunde und Bezugspunkte. Dort, an der polnischen Grenze, war es leer. Aber in Stettin war Leben. Eine polnische Stadt, die auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dort Menschen aus ganz Ostpolen angesiedelt. Weil die Stadt leer war. Das fügte sich dann Schritt für Schritt. Seitdem bin ich Gast in Berlin.
Du willst hier einfach nicht mehr jeden Tag sein.
Und ich will mehr Freiheit für meine Familie. Mein Sohn ist jetzt zehn Jahre – und geht einfach ins Studio und macht Trap. Man hat mehr Zeit füreinander. Und wer es schafft und uns besucht, bleibt für länger. Seit wir dort leben, fühle ich mich eher enger mit der Welt verbunden. Das zu erreichen, war natürlich mit einer enormen Kraftanstrengung verbunden. Häuser zu restaurieren ist weder einfach noch preisgünstig.

Ich wollte euch ja eigentlich besuchen, aber dann schnellten die Infektionszahlen wieder nach oben und ich habe den Schwanz eingekniffen. Wie lebt ihr?
Ursprünglich lebten dort fünf Familien. Es ist ein Ensemble aus Backsteinbauten aus der Gründerzeit – für Bahnarbeiter, die für die Berlin-Stettiner Bahn arbeiteten. 1843 wurde das Haus fertig, in dem wir jetzt wohnen. Seitdem wurde dort praktisch nichts mehr gemacht. Vielleicht wurde zu DDR-Zeiten nochmal die Dachpappe ausgetauscht, aber als wir ankamen, gab es keine Fenster, Türen und Dächer, und natürlich auch kein Wasser und Strom. Im großen Haus daneben war es noch schlimmer. Das war viel Arbeit, dort ist jetzt mein Studio. Peu à peu haben wir das dann restauriert, immer wenn Geld da war. Das hat sich alles gelohnt.
Ein neuer Lebensmittelpunkt für dich und deine Familie ist das eine. Ich spüre aber, dass du mehr wolltest, bzw. dass das immer mitschwang: in dieser kulturellen „Ödnis“ etwas zu bewirken, eine Art „Habitat“ zu etablieren.
Das ist ein schönes Bild. Und es stimmt. Laut UNESCO ist die Gegend, in der wir leben, „unbesiedelt“, sie hat weniger als 17 Einwohner*innen pro Quadratkilometer.
Das war aber doch nicht immer so, oder?
Nein. Aktuell werden Windräder bei uns gebaut. Beim Ausheben der Fundamente wurde dort Keramik gefunden, die 7.000 Jahre alt ist. Das ist für die Gegend sehr ungewöhnlich und bedeutet, dass der Landstrich damals bevölkerter war als heute. Das müssen damals 100 bis 200 Menschen gewesen sein. Zum Vergleich: Das nächste Dorf in unserer Gegend hat heute vielleicht 140 Einwohner*innen. Kulturell passiert natürlich extrem wenig. Die Fördergelder in Sachen Kultur gehen an die lokale Feuerwehr, weil die die wenigen Events veranstaltet. Sich dort einzubinden ist schwierig – es gelingt hier und da, aber eigentlich führen wir ein Insel-Dasein.
Berliner*innen in Brandenburg ... das hat auch Konflikt-Potenzial.
Wir suchen den natürlich nicht. Und wenn man wie wir keine Nachbarn hat, ist man mit bestimmten Klischees auch gar nicht konfrontiert. Berliner*innen mähen ihren Rasen nicht, zum Beispiel. Die kommen nur am Wochenende zum Partymachen. Es geht aber auch ganz anders. An der Schule unserer Kinder ist der Zusammenhalt großartig. Da wurden wir alle toll aufgenommen. Ich habe dort viele Veranstaltungen zu jüdischem Leben organisiert und auch an der VHS unterrichtet. Meine Frau ist Bildende Künstlerin und wurde sofort an die Jugendkunstschule geholt. Sie kümmert sich dort vor allem um Mädchen, die keine Perspektive und schon Suizid-Versuche hinter sich haben. Es mischt sich alles ohnehin mehr, als man vielleicht denkt, nicht zuletzt durch die vielen polnischen Menschen.
Was hat der Umzug mit deiner Musik gemacht?
Weiß ich nicht. Ich will mich ja sowieso immer weiterentwickeln. Ich habe viel Zeit in London verbracht in den vergangenen Jahren, in Dalston, in Brixton – und dort vor allem versucht, den Groove aufzusaugen. Ich habe aber schon gemerkt, dass ich die dortige Hektik jetzt besser verdaue. Ich werde nicht mehr so schnell abgelenkt und kann mich besser konzentrieren.
„Das Komponieren wird immer wichtiger.“
UK ist ein gutes Stichwort. Ich höre diesen Einfluss auf deinem neuen Album durchaus. Was eigentlich absurd ist, denn gerade rhythmisch agierst du ja sehr „einfach“. Will sagen: klar strukturiert, eher grade. Und die Funkyness, die ich all deinen Tracks anhöre, ordnet sich immer den Songs unter, auch wegen der Geige natürlich. Ich finde das hochgradig spannend. Weil so ein Konstrukt entsteht, was extrem komplex ist, nicht zuletzt wegen der Lyrics, gleichzeitig aber auch Potenzial hätte, an einem vorbei zu rauschen.
Ich hadere oft selber damit. Aber ich bin eben nicht der Neoklassik-Geiger. Wenn ich eine Idee habe für einen Text, dann will ich die auch umsetzen. Ich möchte etwas sagen. Das romantische Stück, was gut in Playlisten funktioniert, reicht mir einfach nicht. Gonzales hat das damals ja sehr gut für sich entschieden und eine Piano-Platte gemacht. Ich bin mir sicher, dass ihm das auch sehr gut getan hat. Ich denke aber, dass ich diesen Punkt auch irgendwann mal erreichen werde. Ich merke das ja in der täglichen Studio-Arbeit: Das Komponieren wird immer wichtiger. Gleichzeitig fühle ich mich der Geige auch verpflichtet. Die ist so schwer zu spielen und kann parallel dazu so viele Emotionen auslösen und transportieren. Ich möchte beweisen, dass dieses Instrument mehr ist als ein Emo-Sahnehäubchen für XY – und, genauso wichtig, mehr ist als die popmusikalische Waffe eines David Garrett, der aus seinem „Gefängnis“ ausbricht. Schau und hör die Playlisten an: Piano ist immer schön, kann man sich wunderbar beim Abwaschen anhören. Die Geige hat immer noch einfach ein Scheiß-Image.
Seit wann spielst du Geige?
Ich habe mit sieben oder acht angefangen. Also eigentlich spiele ich schon länger, als ich rechnen kann.

Alex Stolze, Kinship Stories, ist auf Nonostar erschienen.
Sprechen wir doch konkret über dein neues Album „Kinship Stories“. Der Titel ist ja schon eine Ansage.
Und beschreibt perfekt mein Leben auf dem Land. Mir geht es vor allem um die Community – konkret natürlich um die, die wir dort aufgebaut haben. Um die Dinge, die uns vereinen, die wir geteilt haben. Mir ist das wichtig. Besonders in einer Zeit, in der wir ja eigentlich alle vereinzelt werden sollen. Ich bin selbst Teil der jüdischen Community. Und wenn uns Freunde aus Berlin besuchen, bringen die auch viele türkische Leute mit. Dazu kommen Geflüchtete aus der Gegend, oft auch Moslems. Das ist dann immer super bunt – halt die Welt. Genau das mag ich ja auch so an London: Da fragt ja auch niemand danach. Genau das nach Brandenburg zu bringen, ist total schön.
„Bei uns in Brandenburg fehlen oft einfach die Bezüge. Dort leben Menschen, die vielleicht noch nie einen Juden, eine Moslem oder einen Afrikaner getroffen haben.“
Würde das genauso gut funktionieren, wenn ihr nicht soweit ab vom Schuss leben würdet?
Ich denke schon. Der Konflikt, der sich dabei auftut oder auftun kann, ist doch überall gleich: Die eine Hälfte will die Welt als Ganzes begreifen, die andere Hälfte denkt eher national. Das ist bei uns so, in den USA oder in Israel. In Brandenburg fehlen oft einfach die Bezüge. Dort leben Menschen, die vielleicht noch nie einen Juden, eine Moslem oder einen Afrikaner getroffen haben. Mir ist auch wichtig, dass niemand Angst hat, wenn man zu uns kommt. Im Zug zum Beispiel. Und ich hoffe auch, dass die Schaffner*innen und Busfahrer*innen merken: Die sind cool. Ich kenne genug Leute, die nicht allein Zug fahren wollen. Machen die nicht. Und gleichzeitig erzählen mir viele meiner jüdischen Freund*innen, wie sauwohl sie sich bei uns in Brandenburg fühlen. Ich muss ihnen dann immer wieder sagen, dass unser Hof nicht wirklich Brandenburg als Ganzes widerspiegelt.
Wie wird jüdisches Leben bei dir öffentlich? Beziehungsweise: Ist das überhaupt eine relevante Frage?
Kippa in der Öffentlichkeit trage ich sehr selten. Bei uns im Garten, klar, oder wenn ich aus der Synagoge komme. Aber natürlich schwingt die Öffentlichkeit immer mit. Ich habe zum Beispiel sehr enge Beziehungen zu Leuten aus der Community, die 2019 in Halle waren. Das sind alles Berlinerinnen. Wenn die mich besuchen, laufen wir auch mit Kippa durchs Dorf. Bei der Ordination des Rabbiners Jeremy Borovitz in Berlin habe ich gespielt. Seine Frau, Rebecca Blady, war bereits Rabbinerin. Zusammen betreuen sie Base BRLN, eine neue, sehr offene Community. Ich kenne auch Menschen, die beim Halle-Prozess dabei waren. Ich versuche immer, das nicht isoliert zu betrachten. Die Geflüchteten, die hier bei uns um die Ecke in Schwedt wohnen, hatten kürzlich auch eine Auseinandersetzung. Vor dem Supermarkt wurden sie angepöbelt. Und in der Zeitung stand natürlich, dass sie* angefangen hätten. Absurde Vorstellung, wenn man die kennt. Die tun so etwas einfach nicht. Die sprechen mehrere Sprachen und haben den ganzen Weg geschafft – von Guinea über Mali, haben Libyen überlebt und kamen dann über Italien hierher. Mit denen habe ich „The Rucksack Song“ gemacht.
Der Song ist entstanden aus einem Projekt mit den Jugendlichen. Der Titel bezieht auf sich ihre Flucht – und im Text erzählen Morlaye Bah und King Ali wie es eben so war, mit dem Rucksack quer durch die Welt.
Der Track sticht ja auch musikalisch hervor. Er ist exponiert, lauter, und ich dachte mir schon, dass es auch textlich um etwas Besonderes geht. Ich dachte an „New“, ein Stück von deinem ersten Solo-Album „Outermost Edge“, und natürlich an das Video, das dein Engagement für Geflüchtete und deren Weg bereits exemplarisch zeigt. Es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, wie ich die Kontrastierungen in deiner Musik wahrnehme. Weil der Sound die Dringlichkeit der Themen – ob nun textlich oder visuell – nicht zwingend widerspiegelt.
Für mich ist das einerseits der Wind. Dieses „Hhhhwwwwoooo“. Das ist die eine Seite. Ich denke tatsächlich oft: Lass die politischen Inhalte und die Beats doch weg. Die Geige reicht doch, verbaut in das sonstig Experimentelle der Elektronik. Aber dann passiert etwas. Dann gewinnt die AfD in Brandenburg. Oder mein lieber Freund Ben Osborn, der auch auf unserem Label veröffentlicht, schickt mir den Text zu „Babylon“.
Er kommt aus Oxford, ist Lyriker. Wir kennen uns aus der Synagoge, er ist wie ein Bruder für mich. Er arbeitete damals gerade an einem Theaterstück, in dem Babylon vor allem eine Metapher für die Brandkatastrophe im Grenfell Tower in London ist. In solchen Momenten fühle ich mich dann fast schon wie in der Renaissance, einer Epoche, in der die Komponisten auch immer mit Text gearbeitet haben. Damals ging es oft um Spiritualität. Und die spielt bei mir auch eine Rolle. „The Way We Care“ zum Beispiel ist eine Hommage an das jüdische Dasein, wie man mit dem Trauma umgeht. Wie kann man das überhaupt schaffen?
Ich kann diese Dinge nicht über Bord werfen. Vielleicht kommt das aus meiner Kindheit in der DDR und aus meinem Elternhaus. Es war klar, das der Glaube an eine bessere Gesellschaft komplett enttäuscht worden war – politisch und religiös, und zwar aufgrund der schlechten Eigenschaften der Menschen. Die Diskussionen zu Hause haben sich immer darum gedreht. Mein Vater hat noch sehr lange an dieses Versprechen geglaubt – bis er aus der Partei geflogen ist. Ihm ging es immer darum, Religion und Gesellschaft zu versöhnen.
Das kam in der DDR mit Sicherheit nicht gut an.
Aber daran hat sich doch heute auch nichts geändert! Glauben wir wirklich an das Gute im Menschen? Ich trage das einfach mit mir rum. Gleichzeitig spüre ich, dass ich diesen Konflikt immer weniger ertrage. Auch deshalb fühle ich mich in Brandenburg so wohl. Da habe ich Ruhe, kann mich um die Tiere kümmern. Um das in der Musik aufzulösen ... dafür werde ich noch ein paar Alben brauchen.

Ich würde gerne bei diesem Thema bleiben, weil es mich persönlich sehr interessiert. Disclaimer: Ich komme aus einer sehr katholischen Familie und erlebe bis heute, was diese Prägung mit unserer „Sippe“ angestellt hat. Nun war Katholisch-Sein in Westberlin kein Problem. Aber wie bist du in Ostberlin damit aufgewachsen? Zwischen ... sagen wir zwischen religiöser Verwurzelung einerseits und dem Clash zwischen Staat und Amtskirche andererseits.
Als Kind bin ich in dieser Identität nicht aufgewachsen. Ich habe davon erst relativ spät erfahren. Bis dahin war es aus meiner Perspektive sehr säkular. Und: Meine Mutter ist katholisch. Ich war damals auch nie in der Jüdischen Gemeinde in der Rykestraße – das kam alles viel später. Mit anderen Worten: Ich hatte eine Art Außenseiterrolle. Ich wusste, das es väterlicherseits etwas gab und auch bei meinem Onkel. Ich habe diesen Weg dann später selber gewählt. Vielleicht auch, um dieses Fremdsein zu überwinden. Erst nach dem Mauerfall habe ich viele Dinge herausgefunden und entdeckt. 1995 bin ich dann nach Israel, wollte alles aber auch immer aus der anderen Perspektive kennenlernen. Und bin zuerst in ein arabisches Projekt gegangen, habe in Tel Aviv gejobbt und war praktisch dabei, als Rabin ermordet wurde. Mittlerweile empfinde ich das als normal. Ich engagiere mich in der Community, mache da auch viel Musik. Heute kann ich sagen: In der DDR sind die Erwartungen enttäuscht worden, in Israel aber auch. Aber: Ich kann das Land und die Menschen von der Politik trennen. Das Gleiche gilt in Brandenburg. Meine polnischen Freunde sind mir nicht weniger wert ob der dortigen Entwicklungen. Oder England. Oder die USA. Was Israel angeht: Mein Lieblings-Schriftsteller ist Amos Oz. Der hat über Netanyahu mal berichtet – die Eltern kannten sich und haben viele Feiertage miteinander verbracht –, dass er als kleines Kind immer unter dem Tisch krabbelte und den Leuten vor das Schienbein getreten hat. Der war einfach ein Stresser. Für mich ist er der erste Populist, den ich überhaupt ab 1995 in der Politik wahrgenommen habe. Er hat die Linke in Israel kaputt gemacht. Aber er hat das Land auch sicherer gemacht, deshalb wählen die Menschen ihn. Das muss doch auch anders gehen. Und dann spricht man auch wieder anders über das Land. Genau wie über die Geige.