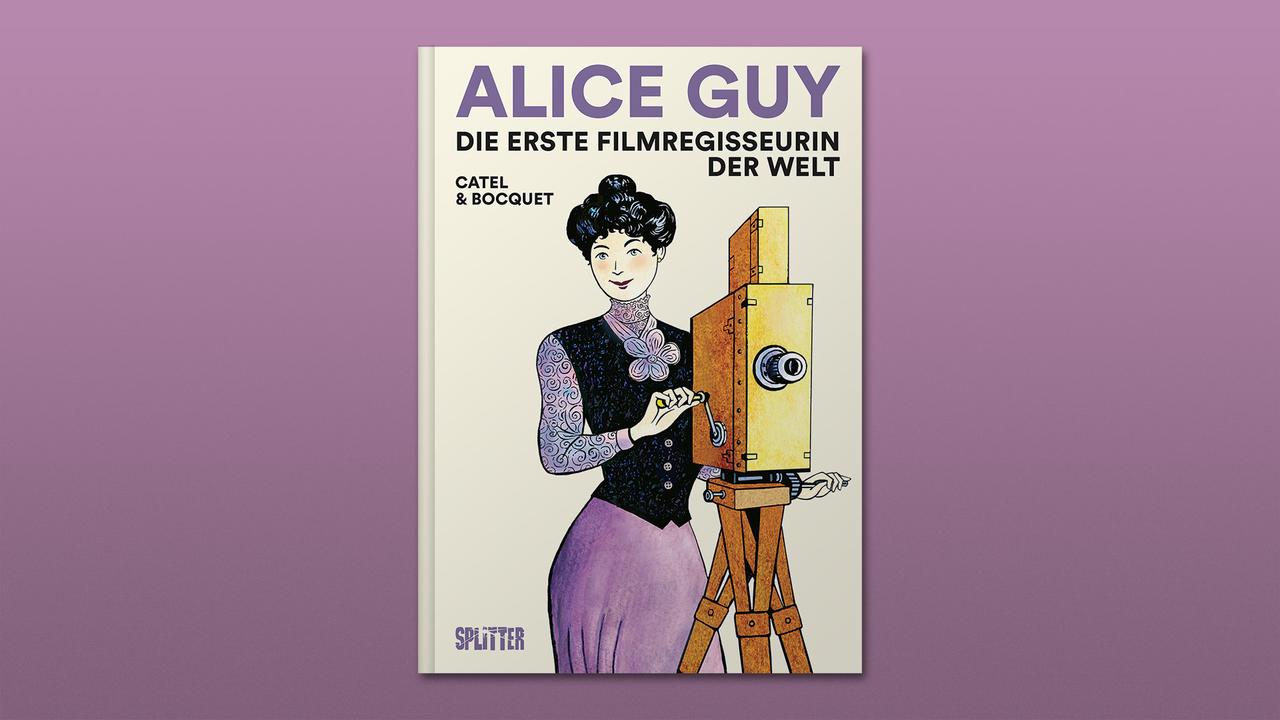A Song For You auf der Volksbühne | Foto: Anika Zachow
Im vergangenen Jahr wurde das Gesangsensemble A Song For You gegründet. Ohne Releases oder aufwendige Musikvideos schaffte es die bis zu 60-köpfige Musikgruppe, die Berliner Volksbühne auszuverkaufen, bekommt zahlreiche internationale Anfragen und spielte unter anderem auf dem diesjährigen Melt Festival. Etwas, das viele Acts in vielen Jahren nicht erreichen. Dabei geht es gerade erst richtig los. Wer einmal A Song For You erlebt hat, wird sich an etwas Kollektives, tief Emotionales und Einprägsames erinnern. Hier ist Musik ein Gemeinschaftserlebnis, das seine Wurzeln in Gospel-Chören hat, aber mit zeitgenössischer Instrumentierung, HipHop- und RnB-Einflüssen und modernem Tanz neu definiert wird. Auf dem Pop-Kultur-Festival 2023 werden A Song For You ihre Auftragsarbeit „Unravel“ präsentieren. Wir sprachen mit dem musikalischen Leiter Noah Slee und dem Kreativdirektor Dhanesh Jayaselan über die Entstehung und Idee dieses einzigartigen Projekts, über eine neue internationale Soul- und Jazz-Szene in Berlin, warum in Deutschland kaum Kultur für gemeinsames Singen besteht und weshalb so ein Unterfangen auch exzellente Management-Skills erfordert.
Das Ensemble A Song For You gibt es jetzt seit einem Jahr und hat schnell Wellen geschlagen. Ihr seid beide vor einigen Jahren von ziemlich weit her nach Berlin gekommen. Was habt Ihr bis dahin gemacht?
Noah Slee: Ich komme aus Neuseeland und bin Singer-Songwriter. 2017 bin ich nach Berlin gezogen. Die letzten Jahre war ich hauptsächlich mit meinen Solo-Arbeiten beschäftigt. Mit den Jahren habe ich mich immer mehr mit den lokalen Szenen vertraut machen können. Dabei habe ich viele andere Artists kennen gelernt, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin. Es sind einige kreative Kollaborationen entstanden. Vor knapp einem Jahr haben Dhanesh und ich uns zusammen getan und unsere Kräfte und Ideen gebündelt. So ist quasi A Song For You entstanden.
Dhanesh Jayaselan: Ich wurde in Malaysia geboren, bin aber in Australien aufgewachsen. Ich kam 2019 nach Berlin, also kurz vor der Pandemie. Mein musikalischer Hintergrund liegt im HipHop, Soul und Jazz. Da gibt es seit einigen Jahren eine neue aufkommende Szene in Berlin. Es kommen immer mehr Künstler:innen her und seitdem ist hier etwas Eigenes entstanden. Ich bin eher in der Organisation und Kuration tätig. Ich habe in Filmproduktionen gearbeitet und Musikvideos gemacht, auch so habe ich in der Stadt viele kreative Menschen kennen gelernt.
Diese Genres und Szenen sind in den letzten Jahren in Berlin enorm gewachsen.
Dhanesh Jayaselan: Es ist eine eine große Community entstanden. Bei der Zusammenarbeit zwischen Noah und mir ging es zum einen darum, den Fokus auf Acts zu legen, die sonst kaum Öffentlichkeit bekommen. Dann haben wir eine Theaterproduktion gemacht. Noah erzählte mir, wie sehr er das Singen in einer Gruppe vermisst. Das kollektive Erlebnis und auch das Spirituelle daran. So ist das Stück für Stück gewachsen. Letztlich wurde daraus unser Gesangsensemble. Die ersten Proben waren noch mit fünf Leuten in einem kleinen Studio. Anfangs haben wir Songs von Noah gecovert, aber auch von anderen Acts. Mit den Monaten wuchsen wir auf 20 bis 30 Leute. Die meisten waren Freunde oder Freunde von Freunden. Wir mussten knapp kalkulieren, weil wir uns bis dahin selbst finanziert haben. Uns war wichtig, einen Raum zu schaffen, in dem sich alle verstehen und gegenseitiges Vertrauen entsteht. Wir wollten aber auch nicht, dass jetzt alle einfach mitmachen können, weil wir dann die Kontrolle darüber verlieren würden. Wir wollten eine organische Struktur. Dann kam die Förderung von der Initiative Musik, was eine solide Basis für das Projekt schuf. Wir konnten in den Limusic Studios in Südfrankreich arbeiten. Wir waren mit 20 Leuten dort. Neben den Sänger:innen waren Produzenten, Köche und Filmleute dabei. Im letzten August haben wir dort unser Album aufgenommen, das wahrscheinlich Anfang 2024 veröffentlicht wird. Außerdem entstand eine Dokumentation, die ebenfalls gerade fertig gestellt wird. Es ist in der Zeit viel passiert. Wir bekommen Anfragen von internationalen Artists aus London und den USA, die mit uns arbeiten wollen.

Noah Slee (links) und Dhanesh Jayaselan (rechts) sind Gründer und künstlerische Leiter von A Song For You.
Es hat mich ebenfalls beeindruckt, wie schnell das alles bei euch geht. Aber kurz zurück in die Zeit, als ihr aus Australien und Neuseeland hergezogen seid. Was waren da eure musikalischen Erwartungen? Oder anders, wie sehr wurdet ihr enttäuscht?
Noah Slee: Um ehrlich zu sein, wurde ich sehr inspiriert, als ich hier ankam. Ich bin zwar ein bisschen rumgereist, habe aber nur in Australien und Neuseeland gelebt. Mich inspirieren neue Sounds, neue künstlerische Ansätze und in meinen neuseeländischen Kreisen spielten House oder Techno nur in ihren kommerziellen Spielarten eine Rolle. Als ich auf die Suche ging, Leute zu finden, die ähnliche Musik wie ich mache, merkte ich, dass vielleicht doch nicht so viel in der Richtung los ist. Am Ende findest du aber Gleichgesinnte. Nach fünf Jahren habe ich immer noch das Gefühl, dass das alles wächst und sich entwickelt. Es kommen ständig talentierte Musiker:innen in die Stadt, um Jazz, Soul und RnB zu spielen. Das liegt auch daran, dass die Stadt im Verhältnis zu anderen Großstädten in der Welt irgendwie immer noch bezahlbar ist. Mittlerweile bekommt Berlin weltweit Anerkennung für diese Stile und Genres, auch wenn das bestimmt nicht der Mittelpunkt der internationalen Szene ist.
Dhanesh Jayaselan: Die hiesige Musikwelt zu entdecken, hat meinen Horizont geöffnet. Andererseits habe ich von Beginn an Soul, Musik mit einer tieferen persönlichen Bedeutung für mich vermisst. Diese Netzwerke konnten wir bilden. In der Stadt gibt es aber auch nicht so viel Platz für solche Musik. Das war eine Sache, die uns beschäftigte. Hier gibt es sehr viel Raum für elektronische Musik und Club-Sounds. Es existieren eher die Narrative, wie man mit Clubmusik und DJing in Berlin zum Millionär wird.
Was auch nur die Wenigsten schaffen.
Dhanesh Jayaselan: Das stimmt natürlich. Aber zu sehen, wie wenig Platz es für soulful music gibt, die live gespielt wird, war zum einen enttäuschend, aber zum anderen eine große Motivation. Es gibt eine weiße Leinwand und wir haben die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu versammeln, die wiederum motiviert sind, eigene Räume zu schaffen und die Sache vorwärts zu bringen. Das gilt auch abseits unseres Projekts für andere Sachen wie Refuge Worldwide oder Sonic Interventions. Alle spielen eine wichtige Rolle, die von uns geschätzten Musiken ins Rampenlicht zu rücken.
Noah Slee: Während Corona arbeitete ich an meinem Album. Ich wollte mit internationalen Künstler:innen und vielen Features arbeiten. Da wir alle wegen der Pandemie mehr oder weniger feststeckten, wurde daraus ein Album, in dem ich hauptsächlich mit Artists aus Berlin arbeitete. In der Zeit produzierte ich mit vier Background-Sänger:innen. Alle kommen aus Deutschland und sie erzählten, wie selten sie zusammen mit anderen Menschen singen. Dabei würden sie es so toll finden, mit anderen in Harmonien zu singen. Sie meinten, dass in Deutschland schon der Gesang zu dritt eine große Sache sei. Das hat sich bei mir verfangen. In der Tat singen die meisten solo. In anderen Ländern Europas ist das anders. Ich denke an Irish Pubs oder an Flamenco, wo alle aktiv mitklatschen und mitmachen. Natürlich gibt es die Kirche, die gibt aber einen strengen Rahmen vor. Das hat mich beschäftigt. In Neuseeland gehört es zum Alltag, zusammen zu singen. Dort sang ich mit mindestens zehn anderen Menschen und das mindestens einmal pro Woche. Ob in der Kirche oder auf Partys, das ist einfach normal. Ich habe dieses Gefühl in Deutschland wirklich vermisst. Ich wollte das einfach zurückhaben, ohne große Hintergedanken. Das Zusammenkommen, um gemeinsam zu singen, mit Menschen, die exakt das Gleiche wollen.

Habt ihr eine Antwort dafür, wieso es in Deutschland so ist?
Noah Slee: Vielleicht ist es kein Teil der Kultur. Ich weiß es nicht. Manchmal, wenn ich mit Freunden auf der Straße zusammen singe, dann schauen uns die Leute oft entsetzt an, als würde die das richtig anwidern. Vielleicht sollte ich das so nicht sagen, aber diese gemeinsame spontane Freude – irgendwie passt das hier nicht rein. Die meisten rufen nur: Halt die Schnauze! Woanders bleiben Menschen stehen, klatschen mit oder interessieren sich dafür. Wir hatten mal eine Probe in einem Tanzstudio. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Platz. Wir haben noch nicht mal mit dem Singen angefangen und habe noch hier und da paar Sachen mit der Gruppe besprochen – und schon stand jemand in der Tür und hat uns angeblafft, was zur Hölle wir da machen würden. Das war schon witzig. Manchmal frage ich mich, ob hier das Leben nicht auf diese Art und Weise zelebriert wird, wie wir es kennen. In Deutschland schätzen die Menschen ihre Privatsphäre. Sie kommen von der Arbeit nach Hause und möchten ihre Ruhe haben. Da will keiner auf der Straße tanzen, weil jemand singt oder Musik macht. Wir waren kürzlich in Lissabon, da war es völlig anders.
Dhanesh Jayaselan: Wir kommen aus Kulturen, die das Gemeinsame anders leben. Die Community spielt eine Rolle, wir haben oft große Familien. Oft ist die Familie Familie, ohne deine eigentliche Familie zu sein. Das ist der Vibe, mit dem wir aufgewachsen sind. Ohne uns anfangs darüber bewusst zu sein, scheint eine unserer Aufgaben zu sein, dieses Mindset durch das Projekt mit hineinzubringen. Bei uns wird keiner hungrig nach Hause geschickt. Jeder, der zu Besuch ist, wird wie Bruder, Schwester, Cousin oder Cousine behandelt. Das Gemeinsame, das Zusammensein, im Sinne einer Community und Familie, gerade wenn die eigene Familie weit weg lebt, ist uns wichtig. Das war uns anfangs gar nicht so klar, dass das hier anders gelebt und definiert wird.
„Manchmal frage ich mich, ob hier das Leben nicht auf diese Art und Weise zelebriert wird, wie wir es kennen. In Deutschland schätzen die Menschen ihre Privatsphäre. Sie kommen von der Arbeit nach Hause und möchten ihre Ruhe haben. Da will keiner auf der Straße tanzen, weil jemand singt oder Musik macht.“ (Noah Slee)
Das ist ein interessanter Punkt und dafür gibt es wahrscheinlich viele Antworten. Es gibt durchaus eine Tradition von Chören in Deutschland. Aber man denkt dann eher an Schützenvereine und Bergmannchöre. Das sind dann oft traditionelle und altmodische Konstrukte. Vielleicht kann man das Singen in Fußballstadien noch dazu zählen. Aber in der Tat, schön und beseelt sind diese Formen des gemeinsamen Singens eher nicht. Ihr habt zwar noch nicht so viel live gespielt. Aber wenn man euch live erlebt, dann macht das was mit den Menschen. Es hat eine ganz eigene Energie und Strahlkraft. Ihr habt auch auf dem Melt Festival gespielt, was ein großes Festival ist. Aber wie würdet ihr das in eigenen Worten beschreiben?
Dhanesh Jayaselan: Gut, dass du die anderen Chöre erwähnst, weil wir da unserer Meinung nach auch nicht wirklich reinpassen. Deshalb nennen wir das auch Vocal Ensemble, weil es zum einen eine vorgeformte Vorstellung von Chören gibt, wir zum anderen aber auch viele andere Elemente reinbringen, wie Tanz und Choreographien. Wir erzählen Geschichten, wir integrieren Tanz und Solo-Performances. Das ist anders als ein typischer Chor, der aufgereiht auf der Bühne steht. Wir sind wie ein Schiff, auf dem viele Medien und Disziplinen stattfinden.
Noah Slee: Der Reiz besteht darin, dass wir etwas ausfüllen, das offenbar nicht nur uns in Berlin und Deutschland enorm fehlt. Wir spüren die Verbindung, die entsteht. Nachdem wir in der Volksbühne im März gespielt haben, wurden wir viel auf Social Media angeschrieben. Die Menschen erzählten, wie sehr sie der Abend berührt hat. Den Abend mit uns zu erleben, diese kollektive Erfahrung, war für sie offenbar bedeutsam. Dabei war das gar nicht Teil unseres Konzepts. Aber es ist natürlich schön, wenn Menschen bei unserer Musik Emotionen empfinden und mit uns und dem Raum Verbindungen schaffen. Wir möchten mit unserer Musik, Freude und Geschichten teilen. Hinzu kommt, dass viele Menschen durch die Pandemie das gemeinsame musikalische Erlebnis noch mehr aus dem Blick verloren haben. Aber Verbindungen zu spüren, kann etwas Schönes und Heilendes haben. Uns sagen viele, dass sie so etwas wie bei uns noch nie erfahren und erlebt hätten. Uns geht es aber genauso. Auch viele in der Gruppe haben dieses spirituelle Moment noch nie zuvor erlebt. Das hat auch uns die Augen geöffnet.

Hinterlassen Eindruck: A Song For You nach ihrem Auftritt auf der Berliner Volksbühne. | Foto: Anika Zachow
Eine Sache, die mich beschäftigt, ist, wie organisiert ihr euch? Es ist in Berlin quasi unmöglich, eine Band mit vier Leuten professionell zu betreiben. Wie macht ihr das mit 40 und mehr Menschen? Ich stelle mir viel Chaos in der Chat-Gruppe vor. Wie arbeitet Ihr mit Hierarchien? Für mich ist das schon ambitioniertes Management. Wie sieht die Arbeit aus?
Dhanesh Jayaselan: Es ist viel Trial and Error. Wir sind als Gruppe organisch gewachsen. Wir mussten lernen, wie man mit so einer Gruppe plant. Wir mussten erstmal einen gemeinsamen Tag finden, an dem wir uns regelmäßig sehen. Es ist der Montagabend bei uns geworden, eigentlich dachten wir, der Sonntagabend sei perfekt. Weil aber viele im Gastgewerbe arbeiten, ging das schonmal nicht. Dann gibt es einen regelmäßigen Newsletter, der alle über anstehende Planungen, Shows informiert und eine WhatsApp-Gruppe, in die nur Noah und ich reinschreiben können. Es gibt für alle Mitglieder eine weitere Chat-Gruppe, in der sie sich austauschen können. Es ist wichtig, diese Nachrichtenfluten zu limitieren. Wir arbeiten mit Schedules und Telefonlisten. Wenn man auf ein Festival wie das Melt fährt, dann sind über 40 Menschen im Bus, nicht nur die Gruppe selbst. Dann tauchen plötzlich Freundinnen und Freunde auf, die nicht eingeplant waren und auch nicht da sein sollten. Dazu kommen Leute von der Crew, Leute für Fotos und Film – da fühlt man sich wie ein Lehrer auf einem Schulausflug. Im Bus müssen wir alle Sitze durchzählen, rufen alle Namen auf und überprüfen die Anwesenheit. Wenn wir einen Abfahrtstermin haben und der Bus fährt um 12 Uhr, kommunizieren wir, dass er um 11:30 Uhr fährt. Wir wissen einfach, dass selbst dann noch Leute um 11:40 Uhr auftauchen. Es geht um so viele Details. Manchmal muss man eine Gruppe gewissermaßen austricksen, damit alles nach Plan läuft. Es ist eine Gratwanderung zwischen Demokratie und Bürokratie. Wenn es um Entscheidungen geht, haben wir innerhalb der Gruppe Sprecher:innen, eine Art Führungsriege von vier bis fünf Leuten. Mit denen stimmen wir Entscheidungen ab, sodass nicht nur wir beide alleine wichtige Entscheidungen treffen. Feedback ist wichtig. Manchmal denken wir, dass wir etwas so oder so machen sollten. Wenn das Führungsteam widerspricht und etwas anderes vorschlägt, dann nehmen wir das ernst. Am Ende sind wir genauso Künstler, die durch ein neues Feld navigieren und versuchen, sich zu orientieren. Es ist ein konstanter Lernprozess.
Noah Slee: Wir haben einen Ethos für die Gruppe geschaffen, der für alle gilt. Wir müssen untereinander stets respektieren. Unsere Egos legen wir an der Tür ab, wenn wir gemeinsam arbeiten. Es geht um das Kollektiv. Wir sind alles Sängerinnen und Sänger, das sind bekanntlich die Egozentrischsten in der Musik überhaupt (lacht). Wenn in einem Chor alle mit ihren eigenen Vorstellungen ankommen, wird das schnell unübersichtlich. Wir haben Leute, die schon ihre eigenen Karrieren aufgebaut haben, und welche, die ganz am Anfang sind. Wir müssen alle lernen, es geht nicht um die einzelnen Personen.
„Wenn wir unterwegs sind, fühle ich mich wie ein Lehrer auf einem Schulausflug. Im Bus müssen wir alle Sitze durchzählen, rufen alle Namen auf und überprüfen die Anwesenheit. Wenn wir einen Abfahrtstermin haben und der Bus fährt um 12 Uhr, kommunizieren wir, dass er um 11:30 Uhr fährt. Trotzdem tauchen viele erst um 11:40 Uhr auf. Manchmal muss man eine Gruppe austricksen, damit alles nach Plan läuft.“ (Dhanesh Jayaselan)
Für das diesjährige Pop-Kultur-Festival gibt es von euch eine Auftragsarbeit, die ihr aufführt. Erzählt mir, was ihr da genau vorhabt und worum es geht.
Noah Slee: Die Show nennt sich „Unravel“ und es geht um kollektiven Ausdruck. Es ist auch eine Reflektion über das letzte Jahr. Die Emotionen, die Entwicklung des Ensembles – wir haben festgestellt, dass man oft durch eine Gruppe und die gemeinsame Reise viel mehr über sich selbst erfährt und lernt, als wenn man das alleine für sich macht. Wir reisen zusammen, arbeiten hart für unsere Auftritte, nehmen gemeinsam ein Album auf. Das ist bei mir hängengeblieben. Die Mitglieder haben sich durch die Arbeit in der Gruppe neu kennen gelernt. Viele haben sich dadurch gefestigt und sind mit sich selbst mehr im Reinen. Das war – nicht nur bei mir – ein heilender Prozess. Am Ende wollte ich das mit der Show widerspiegeln. Es sollte aber auch anders sein, als das, was wir bislang gemacht haben. Wir haben unterschiedliche Kapitel. Es gibt die Geburt, das Erwachen, die kollektive Heilung und die Rückkehr zu einem selbst. Wir alle identifizieren uns damit individuell. Bei einigen, mich eingeschlossen, wurde das Leben völlig umgekrempelt. Bislang haben wir uns in der Regel im Rahmen zwischen Soul, Jazz und Gospel bewegt. Jetzt haben wir das so verinnerlicht, daher können wir uns aus den Zonen heraus bewegen. Wir wollten uns kreativ herausfordern. Es geht nun mehr um Soundscapes. Wir arbeiten an der Weiterentwicklung unseres Sounds: Es wird vermehrt Tanzelemente geben, das fordert auch das Ensemble. Denn viele haben zuvor noch nie professionell getanzt und lernen so ihre Körper neu kennen und erweitern ihre Skillsets. Poesie, Spoken Word, Interaktion mit dem Publikum – bei „Unravel“ werden viele Elemente zusammen kommen. Wir freuen uns schon sehr darauf. Das wird für alle eine aufregende und spannende Sache, auch weil wir unsere Grenzen damit öffnen.

Vom 30. August bis zum 1. September findet das Festival Pop-Kultur 2023 in der Berliner Kulturbrauerei statt. Konzerte, Performances, exklusive Auftragsarbeiten und Diskurse gibt es auch bei der diesjährigen Ausgabe zu erleben. Unter anderem gibt es dieses Jahr einen Fokus auf das Thema „Pop und Fußball“. Mit dabei sind Junior Boys, Codeine, Anika, Charlotte Brandi, FRZNTE, Meagre Martin, Nichtseattle, Rosa Anschütz, Wa22ermann, Zustra und viele mehr. Das Filter ist Medienpartner des Festivals. Weitere Infos und Tickets findet ihr hier: Pop-Kultur 2023