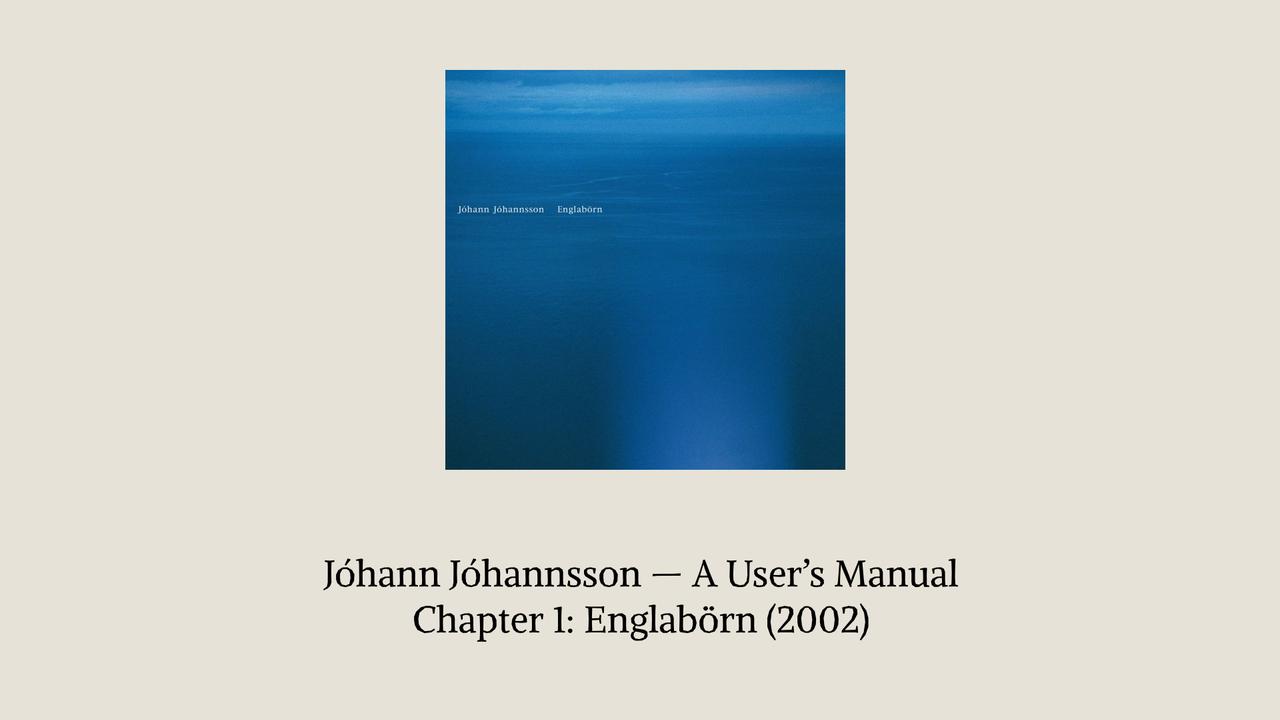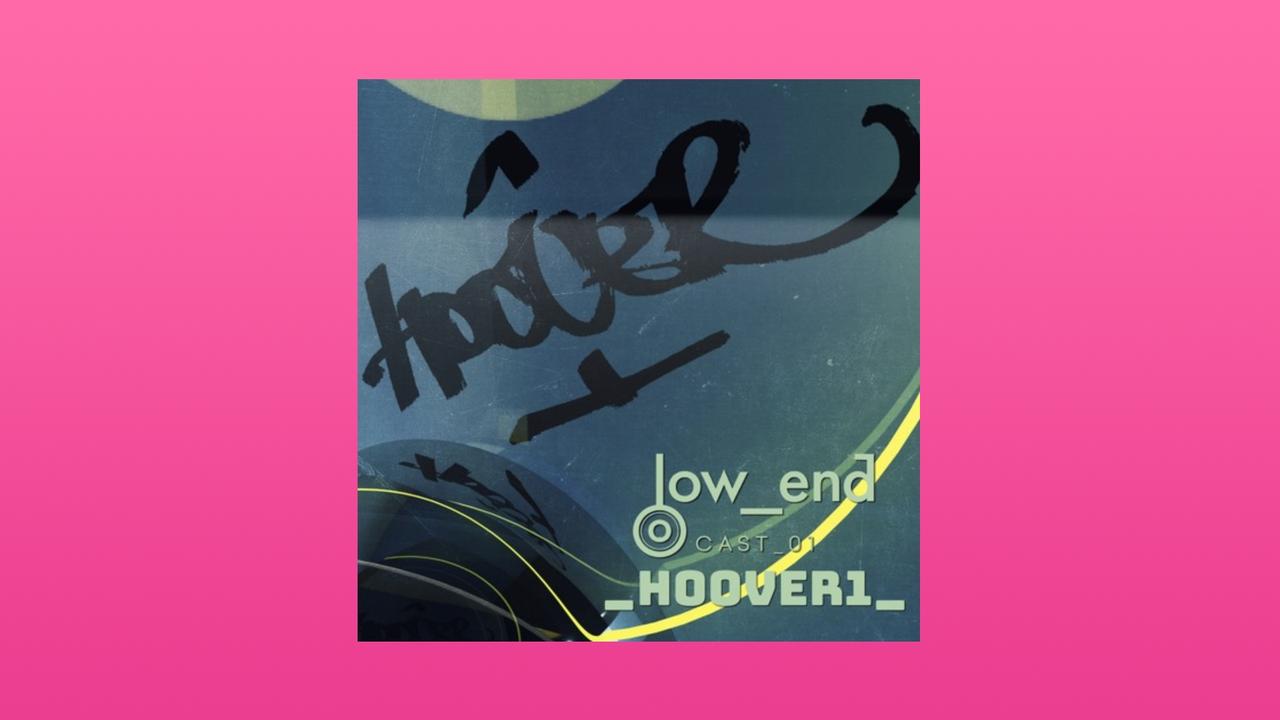Jóhann Jóhannsson – A User’s ManualChapter 2: Virðulegu Forsetar (2004) – Deutsch
9.3.2021 • Sounds – Gespräch: Kristoffer Cornils, Thaddeus Herrmann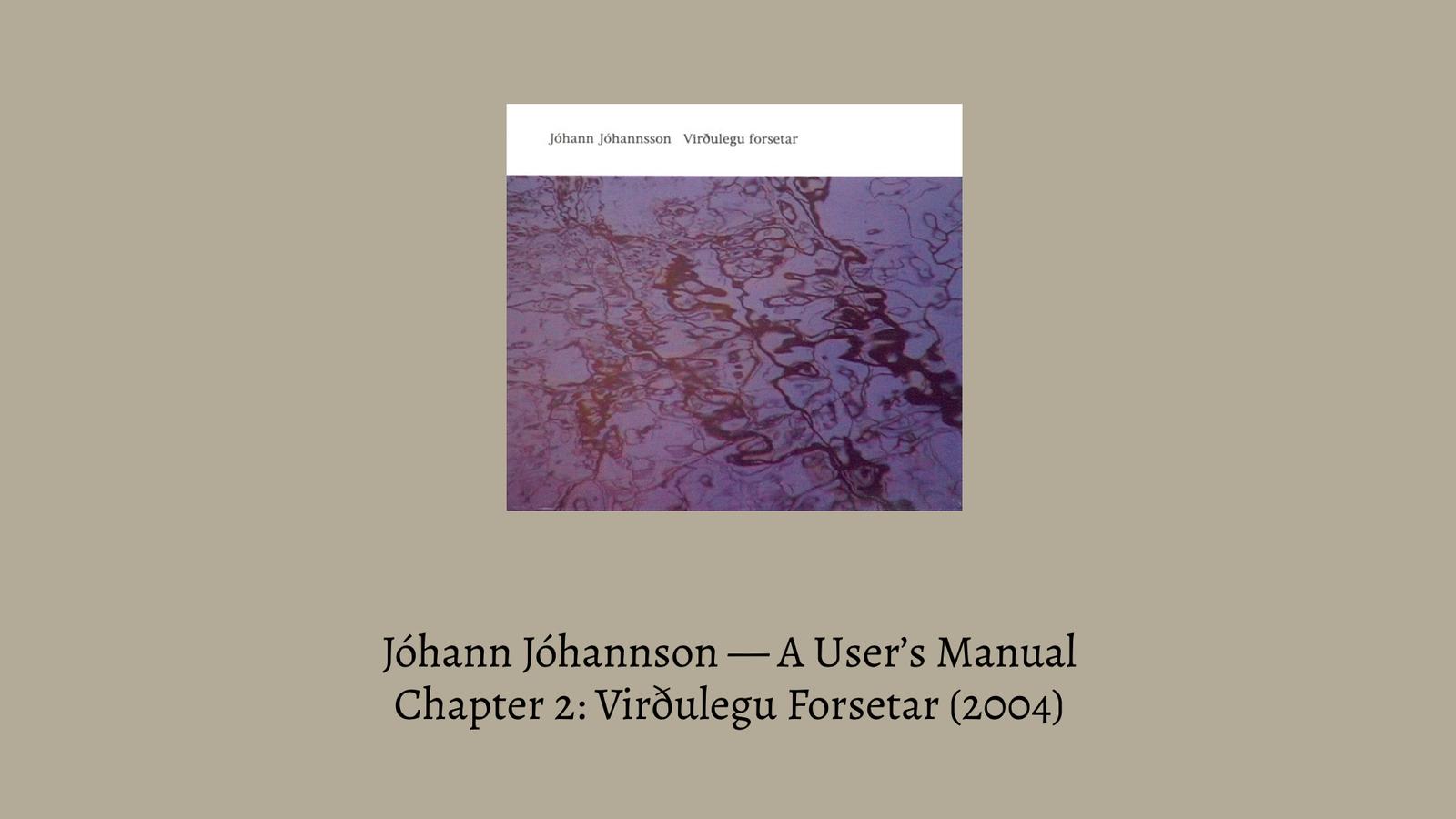
Weit über 20 Alben hat Jóhann Jóhannsson in seiner Karriere veröffentlicht. Wer weiß schon, wie viele Tondokumente noch in der Schublade liegen, die postum veröffentlicht werden könnten. Einmal pro Monat lassen Kristoffer Cornils und Thaddeus Herrmann das Werk des Komponisten Revue passieren – chronologisch, Album für Album. Im März nehmen sich beide „Virðulegu Forsetar“ vor – die zweite Solo-Veröffentlichung von Jóhannsson, der 2018 viel zu früh verstarb.
English version? Click here.
Ist „Virðulegu Forsetar“ das eigentlich Debütalbum Jóhann Jóhannssons? Ja, aber nein. Sagen Cornils und Herrmann, die noch ganz am Anfang ihrer zweijährigen Reise durch den Backkatalog des 2018 verstorbenen Komponisten stehen und doch den Pfad vor ihnen schon wie ihre Westentasche kennen. Sondern auch die Musikgeschichte, die sich ungefähr so erzählen ließe: Nachdem der Isländer sich im Kontext jeder Menge sehr verschiedener Bands seine Sporen verdiente, veröffentlichte das britische Label Touch im Jahr 2002 seine erste Soundtrack-Arbeit neu. „Englabörn“ war für ein Theaterstück geschrieben worden und wurde für die Neuauflage dezent überarbeitet, funktionierte deshalb aber auch als Album-an-sich.
Es sollte zwei weitere Jahre dauern, bis sich Jóhannsson mit „Virðulegu Forsetar“ zurückmeldete, ebenfalls auf Touch. Die im Oktober 2004 erscheinende Aufnahme steht in krassem Kontrast zu den ziselierten Miniaturen von „Englabörn“: Es geht in den Raum, es geht durch die Zeit hindurch und immer und zu jeder Sekunde mitten ins Mark. Bedächtig schlagen die Autoren das zweite Kapitel von „Jóhann Jóhannsson – A User’s Manual“ auf. Was sie darin finden? Entgrenzung, mindestens.
Kristoffer: Wir sitzen gar nicht im Berlin des Jahres 2021 an unseren Schreibtischen, knapp zweieinhalb Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Sondern Schulter an Schulter im Kirchenschiff des beeindruckendsten christlichen Bauwerks – sorry, Gaudí –, das ich jemals gesehen haben: die Hallgrímskirkja in Reykjavík. Ein Gotteshaus wie aus einem Gemälde von Mariusz Lewandowski.

Foto: Yves Alarie on Unsplash
Es ist Abend. Vor uns, aber auch hinter uns: die Musiker*innen: Blechblasinstrumente, Glockenspiel und Glocken, Klavier, Orgel und Elektronik verteilen sich auf zwei Seiten des Raums. Wenn diese gut 20 Menschen aufgehört haben werden zu spielen, wird es dunkel sein – nicht selbstverständlich in diesen Breitengraden. Wir horchen gut eine Stunde lang. Es dröhnt beständig, im Frequenzbereich darüber wallt es auf und ab. Doch die Erde bebt nicht, sie erhebt sich. Oder vielleicht sind das doch nur die heliumbefüllten blauen Luftballons, die über den Verlauf dieser Stunde langsam auf den Boden sinken; immer schneller, je lauter die Musik wird. Die Schwerkraft, die sie herunterreißt und uns gleich mit.
Das ungefähr war die Premiere von „Virðulegu Forsetar“ im Jahr 2003, so in etwa muss sie sich angefühlt haben. Ein Jahr später erschien die Komposition, eingespielt in derselben Location, wie zuvor auch „Englabörn“ als Album auf Touch, zuerst sowohl als CD wie auch als audiophile DVD im 5.1-Surround-Mix, der das Live-Erlebnis nachbauen sollte. Erst später wurde sie auf Vinyl aufgelegt und landete so in meinen Händen, als ich mich bei Rumpsti Pumsti – damals noch in Neukölln – durch die Touch-Kiste grub. Und weil ich „The Miners’ Hymns“ liebte, habe ich sie ungehört mitgenommen und ließ mich dann auch beim ersten Hören von ihr mitnehmen, direkt ins Kirchenschiff der Hallgrímskirkja, irgendwann 2003.
Achtzehn Jahre und eine als Video dokumentierte postume Aufführung des Werks später möchte ich nun von dir wissen, Thaddi: Welche Gefühle stellen sich bei dir ein, wenn du diese Musik hörst? Bei unserer letzten Sitzung hat du vom „Epochalen, Dunklen und Pastoralen“ dieses Albums gesprochen. Was bedeutet das in die Hörsituation übersetzt? Gardinen runter, von isländischen Hügellandschaften träumen?
Thaddi: Weder Gardinen runter noch von Island träumen. Im Gegenteil. Diese Musik hat für mich eine unglaubliche Strahlkraft – und das Helle beißt sich überhaupt nicht mit der durchaus dunklen Stimmung. Die ja auch gar nicht wirklich dunkel ist – vielmehr erhaben, gleißend und majestätisch. In sich verharrend und doch voller Bewegung. Das bringt das Pastorale für mich auf den Punkt. „Englabörn“ ist im Vergleich ja eine kammermusikalische Fingerübung. Hier geht es – musikalisch gefühlt – um das große Ganze: mit vergleichsweise kleinen Mitteln. Denn: Auf Albumlänge wird ja praktisch nur ein Motiv – Loop – durchdekliniert, der immer wieder sanft angefasst und verändert wird. Und ja – ich fühle mich in dieser Größe einfach sauwohl, inmitten der Waldhörner und ihrer epochalen und auch sakralen Kraft. Das Grummeln unten, die Höhen oben, die sanfte Auflösung des Motivs – das ist perfekt. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie das erste – und bislang einzige – Mal auf Island war, zum Airwaves-Festival. Ich sah damals sogar ein Konzert von Jóhannsson, als Teil vom Apparat Organ Quartet. Der Gig war schlimm und das Dosenbier kostete 10 €. Aber natürlich habe ich auch die Hallgrímskirkja besucht – das fühlte sich erhaben an.
„Raum und Zeit scheinen sich auszudehnen. Zusammenzuziehen. Zu atmen. Das finde ich überwältigend.“
Kristoffer: Ich finde die Wortwahl sehr interessant: Du sprichst vom Pastoralen, von Größe. Das sind Begriffe des Raums. Und gleichzeitig nennst du es aber auch epochal – das ist eine zeitliche Kategorie. Und das sind für mich auch die zwei wichtigen Eckpunkte dieses Albums. Es braucht natürlich die Hintergrundgeschichte der Aufführung nicht unbedingt, um das zu verstehen. Aber das Bild allein hilft ungemein dabei, sich zu verdeutlichen, wie diese Komposition – das ist es ja, eine einzige, lange Komposition, aufgesplittet in vier Teile – konzipiert ist. Die Tatsache, dass die Musiker*innen nicht nur auf der Bühne stehen, sondern vorne und hinten im Kirchenschiff – dazwischen der Hörraum. Die Verlangsamung des Bläsermotivs und wie die Musik zum Ende hin wieder an Fahrt gewinnt – wie Zeit verstreicht und was der Sound dazu beiträgt. Die Ballons – als Synthese von dem allen. Das macht „Virðulegu Forsetar“ für mich zu einer sehr genialen Meditation über das Verhältnis von Raum und Zeit während des Hörens. Und zwar sehr spezifisch: während des Hörens. Ich zerfließe bei den ersten Tönen, und sickere im Mittelteil, der fast nur noch von statischen Drones geprägt ist, dann langsam auf den Boden. Und setze mich dann zum Ende hin aber wieder zusammen und zurück auf den Stuhl. Ich kann schwer in Worte fassen, was für Emotionen das in mir auslöst. Euphorie hier, ja. Melancholie dort, ja. Noch viel mehr allerdings. Vor allem aber scheinen sich Raum und Zeit auszudehnen, zusammenzuziehen. Zu atmen. Das finde ich überwältigend.
„Ich bin ja Techno. Und brauche eigentlich generell nur einen Loop, um glücklich zu sein. Diese Variabilität hier jedoch – ich würde das nicht einmal als kompositorische Cleverness bezeichnen – eröffnet mir einen Kosmos, der für mich nach wie vor unerreicht ist.“
Thaddi: Das ist es doch genau. Das Hauptmotiv ist in seiner dringlichen Stille derart mitreißend, dass es lebensverändernd sein kann. Natürlich muss man dafür empfänglich sein. Ist das jedoch der Fall, befindet man sich schon nach wenigen Sekunden im freien Fall in Richtung Glückseligkeit – wie immer die für einen selbst gefärbt ist. Und der Aufbau, das ewige Antäuschen der gedämpften Euphorie, macht dieses Album für mich so unendlich wertvoll. Ich bin ja Techno. Und brauche eigentlich generell nur einen Loop, um glücklich zu sein. Diese Variabilität hier jedoch – ich würde das nicht einmal als kompositorische Cleverness bezeichnen – eröffnet mir einen Kosmos, der für mich nach wie vor unerreicht ist. Weil er einen ganz bestimmten Sinn und Zweck erfüllt, auch ohne die Uraufführung gesehen zu haben. Stattdessen widme ich mich diesem Werk noch heute ganz – sorry! – unbefleckt und tauche ein in diesem See aus Blechbläsern, die mir immer wieder ein Motiv spielen, das einfach alles in mir anspricht. Ich fühle mich wie der Messdiener, der nochmal Weihrauch nachlegt, das Fässchen voller Energie schwenkt, und sich wundert, warum nicht Jóhann Jóhannsson läuft – gut, er hatte die Platte noch noch nicht geschrieben –, sondern die 256 aus dem Gotteslob. Ende meiner – zum Glück! – gescheiterten katholischen Kindheit!

Kristoffer: Oha! Die religiöse Komponente des Ganzen sollten wir sicherlich aber von einem abtrünnigen Protestant zum verhinderten Messdiener nochmal diskutieren. Zuerst aber zur Musik: Du hast ja schon den Loop als prägendes Motiv und Stilmittel erwähnt. Mich erinnert „Virðulegu Forsetar“ tatsächlich an William Basinskis „Disintegration Loops“, deren erster von vier Teilen im Vorjahr erschienen war. Doch anders als Basinskis sich zersetzende Tapes ist die Komposition Jóhannssons nicht auf die Endgültigkeit des Zerfalls ausgerichtet, sondern wie die Einzelstücke auf „Englabörn“ in kompositorischer und konzeptueller Hinsicht zirkulär angelegt: Das markante Bläsermotiv wird immer langsamer, versumpft im, ja, Noise, erhebt sich wieder und steht am Ende wieder dort, wo es anfing: dieselbe Geschwindigkeit, dieselbe Lautstärke. Nietzsches Theorie der ewigen Wiederkunft und Möbius-Schleifen sollen neben Thomas Pynchons „The Crying of Lot 49“”, Posthörnern, Kybernetik und Vögeln zu den Themen gehört haben, die Jóhannsson damals inspirierten, obwohl er sie dezidiert nicht als Thema der Musik verstanden haben wollte. Eben die jedoch reflektiert den Input zurück: Das Album ist eine Schleife, sie kündigt im ersten Ton schon das Absterben des Sounds und aber auch dessen Wiederkehr an. Das mag ein, du deutest das ebenfalls an, kompositorischer Taschenspielertrick sein und es bordert natürlich an einem sehr feierlichen, vielleicht sogar religiösem Pathos. Es riecht nach Weihrauch, es liegt Osterduft in der Luft. Aber weder wirkt das alles billig noch kitschig. Warum nicht? Du hast es ganz richtig gesagt: Es wird alles nur angetäuscht. Die Melancholie setzt beispielsweise nicht ein, weil die Musik nicht verloren wird – sondern nur für eine Weile so getan wird, als sei sie verschwunden.
Thaddi: Du nagelst mich hier gleich mehrmals ans Kreuz, um im katholischen Sprech zu bleiben. Keine Sorge, ich habe das seit langer Zeit hinter mir und fand das Fußballspielen auch immer spannender als das Evangelium. Worum es mir eigentlich geht; Ich bin davon überzeugt, dass wir alle für die Art von Stimmung, die Jóhannsson hier erzeugt, empfänglich sind. Denn diese Stimmung ist so emotional wie abstrakt. Deshalb ist sie auch nicht in diese, uns hier vorliegende Form gepresst und verewigt. Das ist eher eine Idee, ein Gedanke, der uns alle wie auch immer irgendwann bis ins Mark erschüttern lässt. Und genau das passiert auf dieser Platte für mich. Ich knie nieder vor Ehrfurcht. Das hat nichts mit meiner Kindheit, sonder vielmehr mit meiner musikalischen Suche nach dem Nonplusultra zu tun. Ich nehme das wertfrei in mich auf. Kenne weder das Album von Basinski noch den Roman von Pynchon – mit dem bin ich jedoch nie wirklich warm geworden. Dieses Album holt mich ab. Ich weiß nicht genau, wo, aber es reißt mich mit wohin auch immer. Das große, alles überstrahlende Motiv, die Reduktion, das Zerstörerische, der sanfte Wiederaufbau – und das alles nur mit ein paar Akkorden. Ich lehne mich mal weit auf meine kleine, dunkle, stille Straße hinaus: Dieses Album ist das vielleicht beste, das Jóhann Jóhannsson jemals gemacht hat.
Kristoffer: Das ist eine Ansage, die ich … vielleicht unterschreiben kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, „Fordlandia“ und „The Miners’ Hymns“ stehen in meiner Welt in großer Konkurrenz zu dieser Platte, allerdings ist das zweite kein Album in dem Sinne und tatsächlich habe ich „Virðulegu Forsetar“ in meinem Leben wesentlich häufiger gehört als „Fordlandia“, so schön diese LP auch ist. À propos LP: Ich habe am Anfang nicht ganz grundlos erwähnt, dass ich das Album zuerst auf Vinyl in die Finger bekam. Denn was du bezüglich der Konzentration sagst, das spiegelt sich bei mir ein wenig in der, sagen wir, manuellen Rezeption wider. Ich stehe gerne auf, drehe die Platte um, lege die Nadel wieder in die Rille und befinde mich sofort im nächsten Kapitel dieser Erzählung, wenn wir das so nennen wollen. Das Album macht nicht nur in emotionaler Hinsicht etwas mit mir, es fordert mich auf eine Art zum Mitmachen, mindestens aber zum Miterleben auf. Zur affektiven und physischen Teilhabe.
„Es geht hier um Transformationen, um die Aleatorik des Lebens. Just das ist es, was dieses so erhabene Album im selben Zug für mich extrem nahbar macht.“
Dazu passt es auch, dass Jóhannsson selbst den Begriff „Ambient“ dezidiert abgelehnt hat. Ich zitiere mal seine Aussage dazu: „For me, it’s much more about chaos and tension rather than harmony. I go through many different emotions listening to the piece, veering from intense joy to acute sadness. The central point is perhaps how a very simple thing can change by going through a very simple process – something about change and transformation and the inevitability of chaos.“ Und das bringt es auch exzellent auf den Punkt. Es geht hier um Transformationen, um die Aleatorik des Lebens. Just das ist es, was dieses so erhabene Album im selben Zug für mich extrem nahbar macht. Ein gewisser Pomp wird auch angedeutet, oder in deinen Worten angetäuscht, aber eigentlich nähert sich Jóhannsson mit seinen Mitstreiter*innen hier den ganz großen Themen über sehr kleine Einzelteile. Einen Loop. Eine brummelnde Bassspur, die mächtigste in seiner Diskografie vielleicht. Auch das Glockenspiel, das auf „Englabörn“ so präsent war, hält sich hier extrem zurück. Das lässt Raum und Zeit, um sich in diesen Sound zu betten und seinen Regungen und Wirrungen zu folgen. Diese Spannung zu spüren, von der er selbst spricht.
Was mich alles wiederum zur Frage bringt: Wie klassifizieren wir eigentlich diese Musik? Müssen wir nicht, schon klar. Aber je mehr ich mich vor allem in sein Frühwerk eingrabe, desto mehr wundere ich mich, woher diese Musik plötzlich kam, nachdem er zuvor vor allem in, na, mindestens popaffinen Bands gespielt hat. Das Apparat Organ Quartet war auf eine implizite Art von Post-Minimal-Music beeinflusst, aber „Virðulegu Forsetar“ hängt alleine im luftleeren musikhistorischen Raum. Auch das ist ein Argument für das Album. Aber ich finde es sonderbar, dass er wie aus dem Nichts mit dieser Musik ums Eck kam. Kannst du dir das von irgendwo herleiten?
Thaddi: Tatsächlich nein. Das ist aber auch eine Frage, die ich mir einfach nicht mehr stelle. Es geht mir nicht mehr um die Auffüllung bestimmter Leerstellen in der Biografie oder seinem musikalischen Schaffen. Er ist tot, ich höre seine Musik, so wie sie überliefert ist. Deine Punkte sind allesamt valide und interessant – für mich bleiben die Emotionen bestimmend. Denn ganz egal, was Jóhann Jóhannsson mal gesagt hat: Was macht „Virðulegu Forsetar“ heute (noch) mit mir? Da ist mein Fazit klar und deutlich: Ich empfinde diese Ehrfurcht noch immer. Und ertappe mich nach wie vor dabei, wie ich durch meine Küche fege, und die großen Gesten von Dirigent*innen imitiere. Um diese Kraft abzunehmen. Ein Motiv. Ein Loop. 385 Variationen. Kein Verlust in der Bedeutung.
Kristoffer: Da geht es mir exakt genauso wie du. Aber wir arbeiten hier auch an einem Projekt, das einer gewissen Kontinuität verschrieben ist, seine Diskografie chronologisch aufarbeitet und dabei sicherlich auch hier und dort nach vorne und nach hinten schauen muss. Von „Virðulegu Forsetar“ geht es weiter Richtung „Fordlandia“, „The Miners’ Hymns“, einige seiner Film-Soundtracks sind hier ebenfalls schon angedeutet. Aber ich habe das Gefühl, als gäbe es kein wirkliches Davor. Versteh’ mich nicht falsch, das ist für mich kein Manko. Und andererseits will ich das ebenso wenig verklären und an dieser Stelle Geniekult betreiben. Sondern analysieren. Und dazu scheint mir indes dieser eine Baustein zu fehlen. Womöglich aber hast du recht: Vielleicht ist es am besten, diese Komposition für sich stehen zu lassen, hin und wieder anzudocken und doch jedes Mal etwas Neues dabei zu fühlen.
Thaddi: Natürlich geht es bei einem Künstler wie Jóhannsson auch, wenn nicht vor allem – ich hoffe, wir finden das in dieser Serie heraus – um kleine, minimale Änderungen in seiner grundsätzlichen „Palette“, wie man so schön sagt. Ich bekomme bei diesem Begriff im das große Kotzen, aber ich bin auch kein Komponist. Vielleicht ist das auch einfach passend. „Virðulegu Forsetar“ ist und bleibt für mich der beste Loop der Welt. Das ist doch was.