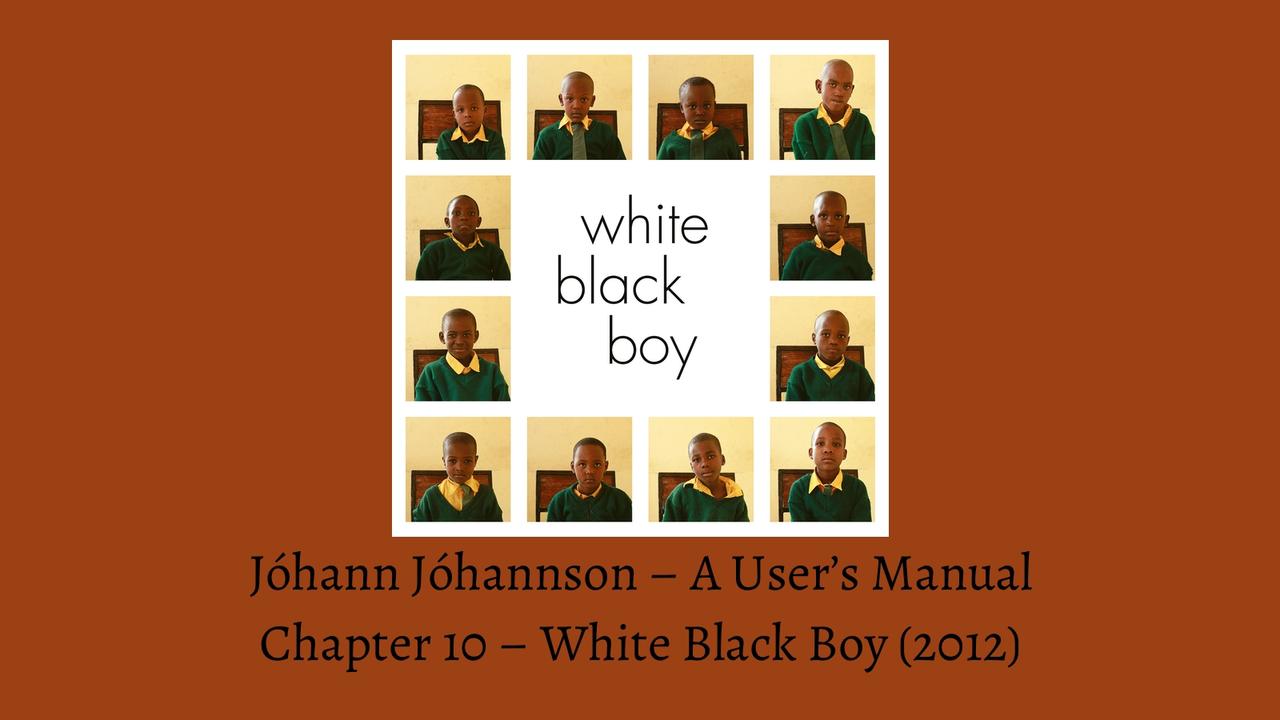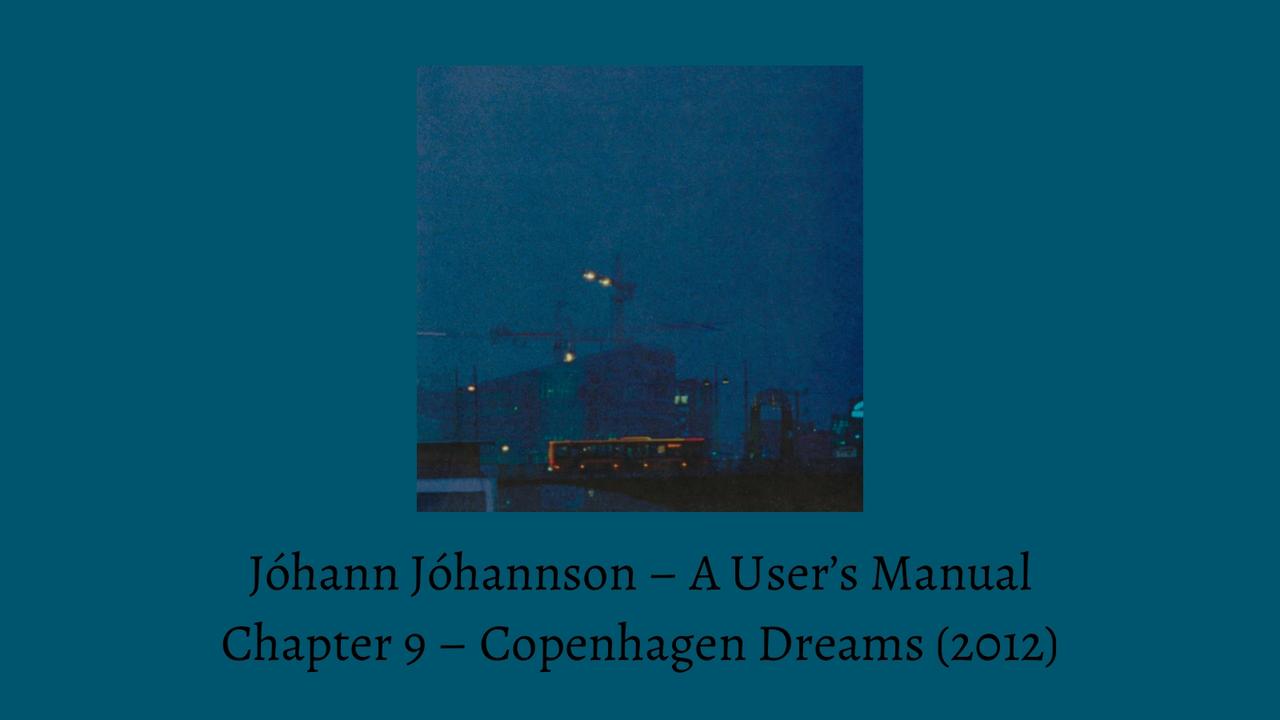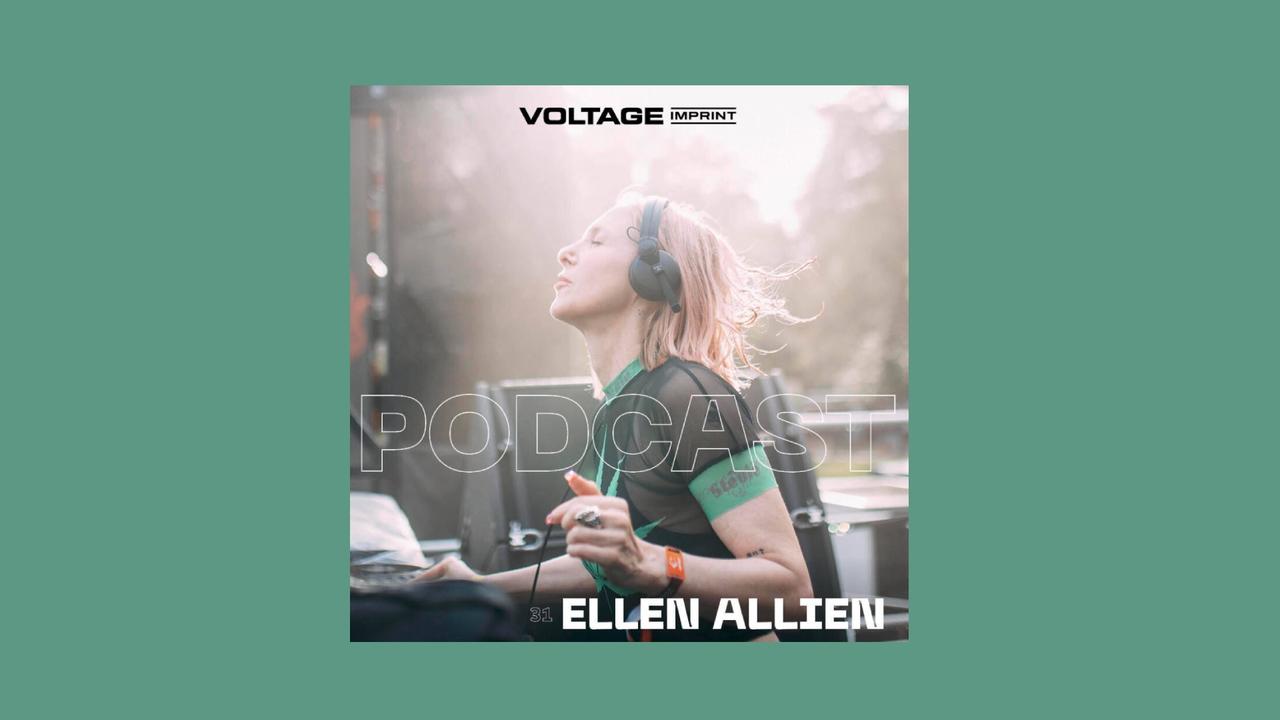Jóhann Jóhannsson – A User’s ManualChapter 10 – White Black Boy (2012) – Deutsch
13.7.2022 • Sounds – Gespräch: Kristoffer Cornils, Thaddeus Herrmann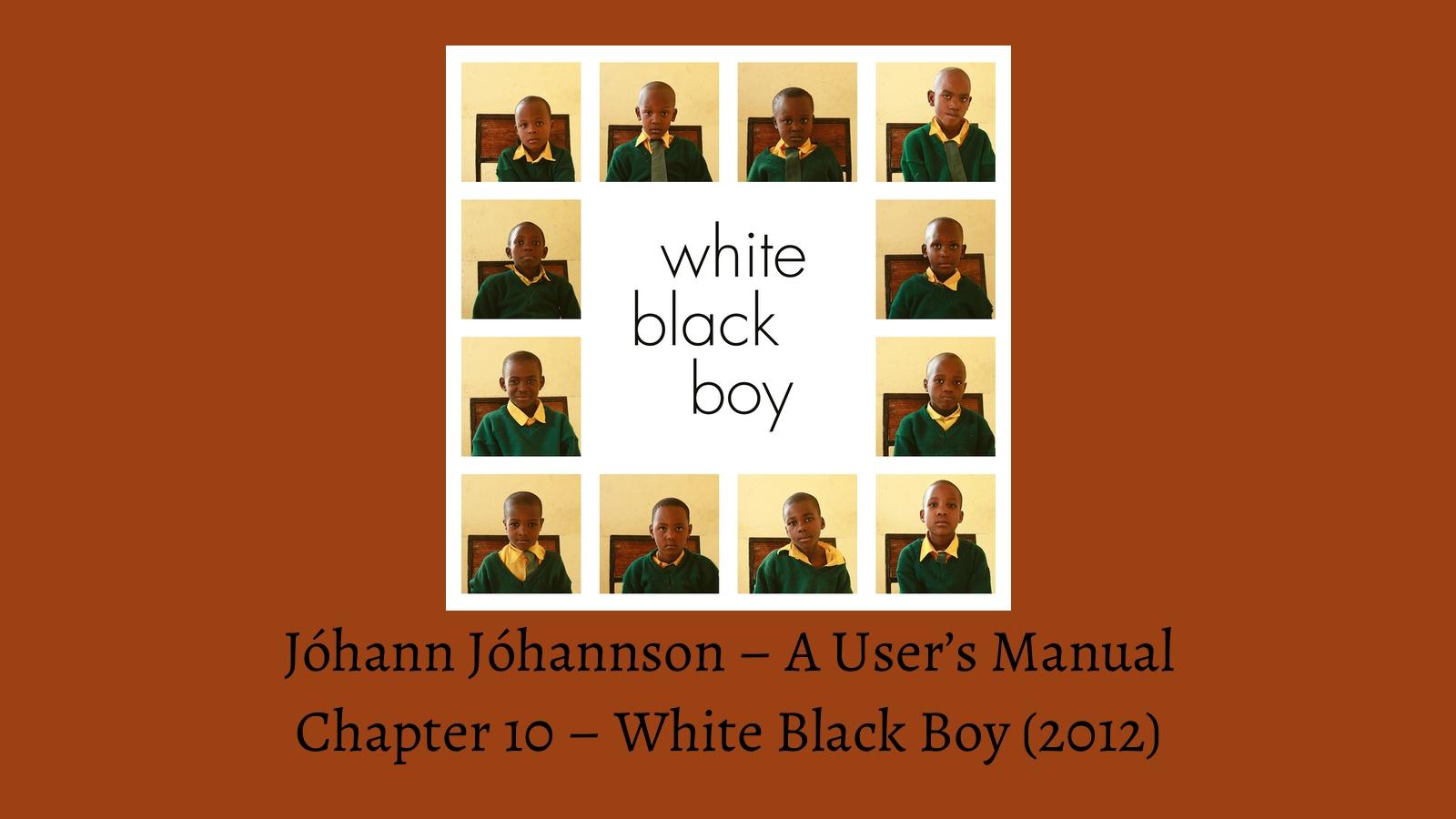
Weit über 20 Alben hat Jóhann Jóhannsson in seiner Karriere veröffentlicht. Wer weiß schon, wie viele Tondokumente noch in der Schublade liegen, die posthum noch veröffentlicht werden könnten? Regelmäßig lassen Kristoffer Cornils und Thaddeus Herrmann das Werk des Komponisten Revue passieren – chronologisch, Album für Album. In der zehnten Ausgabe widmen sie sich einer Soundtrack-Arbeit, die erst sieben Jahre nach dem dazugehörigen Film veröffentlicht wurde: „White Black Boy“ von Camilla Magid.
English Version? Click here.
Oder besser gesagt: „Sort hvid dreng“. Denn bei dem knapp einstündigen Dokumentarfilm handelt es sich um eine dänische Produktion, die allerdings in Tansania gedreht wurde. Dort schwebt der Junge Shida in ständiger Gefahr. Denn sein Albinismus – das Plattencover mag in die Irre führen, der englische Titel bringt den Kern der Sache aber zum Ausdruck – macht ihn zur Beute von Kriminellen, die seine Körperteile und sein Blut an Magier:innen verkaufen wollen. Weshalb Shida wie auch andere Kinder mit Albinismus auf ein Internat geschickt werden, wo sie gleich mit der nächsten Hürde konfrontiert werden: Dort sprechen alle Englisch, sie aber nur Swahili. Das klingt fast zu fantastisch (und grausam), um wahr zu sein, und tatsächlich sieht diese Doku fast aus wie ein Spielfilm. Umspielt werden diese beeindruckende Bilder von der Musik Jóhann Jóhannssons, die allerdings erst im Jahr 2019 und also sieben Jahre nach Premiere des Films von Deutsche Grammophon veröffentlicht wurde.
Kristoffer: Wir haben es nach Personal Effects bereits mit dem nächsten posthum veröffentlichten Soundtrack zu tun und nach Copenhagen Dreams mit der zweiten Auftragsarbeit des Jahres 2012. Der dritten wenden wir uns nächstes Mal zu. Wir merken: Mit Anbruch der Zehnerjahre nimmt Jóhannssons Karriere als Soundtrack-Komponist Fahrt auf. Und tatsächlich soll es noch eine Weile dauern, bevor er sich mit passion projects wie „End of Summer“ und schließlich dem nächsten eigenständigen Album, „Orphée“, zurückmeldet. Durch die eher still und leise vollzogene nachträgliche Veröffentlichung dieses Soundtracks im Jahr 2019 ist diese Musik so lange an mir vorbeigegangen, bis mir ein Blick auf unsere Planung für diese Serie als Reminder dafür diente, dass noch 13 bisher ungekannte Tracks auf mich warteten. Zuerst gehört habe ich sie dann eher lo-fi: übers Telefon. Es war ein schöner Tag im Spätfrühling und ich in der Küche am Werkeln, wenn ich mich richtig erinnere. „White Black Boy“ lieferte den perfekten Soundtrack für diesen Moment und die eher mäßige Wiedergabequalität schien dem Ganzen eher etwas hinzuzufügen denn zu rauben: ein bisschen Patina. Die klebt sowieso auf vielen dieser Stücke in einer Art und Weise, wie das schon bei „Copenhagen Dreams“ der Fall war. Nur ist der Grundton viel freundlicher, lichter – weniger melancholisch. Das überrascht angesichts des Sujets des Films. Wie dem auch sei: Ich mag diesen Soundtrack sehr. Der Erfolg des Films schien moderat ausgefallen zu sein, denn bei IMDB werden vom Algorithmus lediglich andere Indie-Produktionen als vermeintlich ähnliche Filme vorgeschlagen, zu denen Jóhannsson den Soundtrack beigesteuert hat – ein deutliches Indiz dafür, dass sonst kaum nachhaltiges Interesse daran existiert. Ich habe ihn nicht geschaut, würde das aber gerne nachholen. Wie geht es dir damit? Ich hatte im Vornherein den Eindruck, du seist zumindest von der Musik kein sonderlich großer Fan.
„Kompositorisch sticht der Soundtrack nicht sonderlich heraus.“
Thaddi: Bis ich mir den Trailer angeschaut habe. Soundtracks sind ja so ein Ding. Du siehst einen Film, die Musik unterstützt. Hörst du die Musik jedoch losgelöst vom Bewegtbild – wie in diesem und meinem Fall –, nimmst du die klangliche Vermessung nur anhand der Töne vor. Mit denen habe ich überhaupt kein Problem, nur kompositorisch sticht der Soundtrack nicht sonderlich heraus. Der lichte Ton, den du ganz richtig beschreibst, ist wundervoll. Ich bilde mir zudem ein, hier erstmalig im Werk von Jóhannsson überhaupt zu hören, wie er Sound-Partikel unter den Granularsynthese-Bus schmeißt und so fast unmerklich die elektronische Komponente seiner Musik zusätzlich betont.
Wir haben unseren Termin hier und heute ja einige Male verschieben müssen. Was bei mir dazu führte, dass ich das Album faktisch tagelang laufen ließ. Ich fand das sehr angenehm – mitsummen könnte ich aber immer noch nicht. Und es passiert mir tatsächlich ziemlich oft, dass ich Passagen von Jóhannssons Alben vor mich hin summe oder brumme, je nach Timbre.
Kristoffer: Das ist wieder mein Cue Point dafür, dass ich gestehen muss, mich nie an einzelne Motive und Melodien zu erinnern, oder? Zieht sich zumindest als roter Faden durch unsere Gespräche, dass ich das immer wieder betone. Ist hier allerdings auch so, was jedoch ebenso an der späten Veröffentlichung liegen mag. Sehr hypothetisch gefragt: Kannst du dir vorstellen, dass dir dieser Soundtrack wesentlich mehr ans Herz gewachsen wäre über die Jahre, wenn er schon anno 2012 veröffentlicht worden wäre?
Thaddi: Schwer zu sagen. Ich habe in den vergangenen Wochen nicht nur dieses Album von ihm viel gehört, sondern auch mal wieder vermehrt die älteren Werke, die wir ja alle schon besprochen haben. Ich fühle zu vielen dieser Alben eine deutlich größere Nähe, sie haben mehr Wucht, hallen in meinem Herzen mehr nach. Diese dezidiert „freundlichere“ Stimmung, die Leichtigkeit der Motive: All das ist gut, kulminiert für mich aber wenige Jahre später in „The Theory Of Everything“. Also: Wahrscheinlich hätte ich damals ähnlich argumentiert. Ohne natürlich zu wissen, was mich in den kommenden Jahren erwarten würde.
„ Das darf ja auch mal sein: Hoffnung!“
Kristoffer: Sprich, du gönnst Jóhannsson das bisschen Happiness nicht! Scherz beiseite, ich betrachte diesen Soundtrack tatsächlich als eine Art invertierte „Copenhagen Dreams“, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich den aber vorgezogen hätte. Eben weil das getragen-melancholische bei Jóhannsson dann doch am besten funktioniert. Zumindest für mich. Und für dich auch. Trotzdem muss ich „White Black Boy“ in Schutz nehmen: Mehr noch als eine Vorskizze zu „The Theory of Everything“ – die eigentliche besprechen wir in der nächsten Ausgabe – sehe ich darin wieder einen kleinen kompositorischen Rundumschlag. Der mir erneut rückblickend zeigt, wie speziell Jóhannsson selbst noch dann klang, wenn er, na ja, recht generische Soundtrack-Arbeiten im Akkord weggearbeitet hat. Denn diese 13 Stücke tragen ganz deutlich seine Handschrift. Das finde ich schon bemerkenswert, ebenso wie den Tonfall. Denn obwohl der Film in cinematografischer Hinsicht dermaßen ästhetisiert ist, dass ich doppelt und dreifach nachschauen musste, ob das wirklich eine Doku und nicht doch ein Spielfilm ist, bleibt das Sujet ja doch eher dunkel. Es geht ums Anderssein, um soziale Isolation und ums Ausgestoßenwerden – keine leichte Kost, vor allem weil sie eine sehr dringliche existenzielle Dimension hat. Und dann legt sich diese Musik darunter, als würde sie ein happy ending zu versprechen. Ob es das im Film gibt, weiß ich nicht – ich habe ihn wie gesagt noch nicht gesehen. Aber als Soundtrack an sich scheint mir „White Black Boy“ das doch in Aussicht zu stellen. Darf ja auch mal sein: Hoffnung!
Thaddi: Wenn Jóhannsson nicht auf so besondere Art komponieren und arrangieren würde, säßen wir ja nicht hier bei Folge zehn unserer gemeinsamen Reihe. Das ist seine Stärke, sein großes Können, auch „Auftragsarbeiten“ immer mit seiner ganz eigenen Handschrift zu versehen und eben nicht so generisch klingen zu lassen, wie ein ähnlicher Score aus den Tiefen des Zimmer‘schen Universums herausgefallen wäre. Ohne despektierlich klingen zu wollen: Da machen doch alles die Praktis, oder? Die Studios sind mit Sicherheit mit einer großen Zahl praktischer ProTools-Templates ausgestattet, mit denen mal eben ein Soundtrack weggeschubst werden kann. Aber ich schweife ab. Was wollte ich sagen, bzw.: schreiben? Genau: Jóhannsson ist so tief in seinem Kosmos verwurzelt, dass es ihm immer gelingt, bestimmte Elemente im orchestralen Arrangement dann eben doch speziell klingen zu lassen. Bewusst oder unbewusst? Keine Ahnung. Aber genau das ist das Besondere an seiner Kunst.
Kristoffer: Ich glaube, etwas genauer gesprochen handelt es sich eher um ein kammermusikalisches Arrangement, denn die ganz großen Geschütze werden hier nicht aufgefahren. Das Klavier spielt eine große Rolle, hin und wieder Tupfer von Xylofonen oder Glockenspielen (nicht sicher!) oder anderen Gerätschaften, die ihn seit „Englabörn“ in seiner Praxis begleiten. Einerseits sind es die Instrumente selbst und andererseits eben genau das reduzierte Ensemble als solches, die hier maßgeblich zu seinem Sound beitragen – sowie eben auch natürlich die elektronischen Beigaben, die allerdings anders als auf seinen Alben oder späteren Soundtracks wie „Sicario“ oder „Arrival“ vor allem für das Sounddesign und weniger als eigenständige Stimmen eingesetzt werden. Müsste ich die Stimmung dieses Soundtracks auf ein Wort herunterbrechen, wäre das Intimität. Und die erzeugt Jóhannsson hier mit den bekannten, aber bestens erprobten Mitteln. Klar ist das dann wiederum nicht innovativ. Aber dennoch würde ich sagen: „White Black Boy“ ist für mich ein schönes Werk.
Thaddi: Und es ist tatsächlich bemerkenswert, wie die Intimität auf dieser Platte die Sinne flutet. Das Intime spüre ich in fast allen Werken von Jóhannsson, nur ganz unterschiedlich umgesetzt. Anders gesagt: Wäre Jóhannsson Michael Schanze, hätte seine TV-Show für Kinder nicht „1, 2 oder 3“ heißen können, weil er mindestens 450 verschiedene Tore, Antworten, Möglichkeiten im Angebot hat. Können auch nicht alle Komponist:innen.