Hollywoods Hit-MaschineDer Komponist Jóhann Jóhannsson im Interview
5.11.2015 • Sounds – Interview: Thaddeus Herrmann
Wie schnell sich die Umstände doch ändern können. Es ist gerade mal zwölf Jahre her, seit der Isländer Jóhann Jóhannsson sein erstes Album veröffentlichte. Musik macht er freilich schon viel länger. Als integraler Bestandteil der Reykjaviker Indie- und Underground-Szene spielte Jóhannsson in zahlreichen Bands, bevor er schließlich in Kompositionen für Orchester seine ganz persönliche musikalische Ausdrucksform fand. Seit einigen Jahren ist er gefragter Soundtrack-Komponist, auch und immer öfter für große Hollywood-Produktionen. Wie erfüllend diese Arbeit ist und wie sie sich von seinen anderen Projekten unterscheidet, erklärt Jóhannsson, der dieses Jahr mit einem „Golden Globe“ für die Filmmusik von „Theory Of Everything“ ausgezeichnet wurde, im ausführlichen Interview. Wir haben ihn in seiner Wahlheimat Berlin getroffen.
Woran arbeitest du gerade?
Schon wieder an einem Soundtrack. Es geht um den neuen Film von Denis Villeneuve, nach „Prisoners“ und seinem aktuellen Film „Sicario“ wird „Story Of Your Life“ unsere dritte Kollaboration. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte mit Amy Adams und Forest Whitaker, in der es darum geht, wie man mit Außerirdischen eigentlich kommunizieren kann. Ich mag das Drehbuch sehr, denn es ist kein klassischer Action-Film, der lediglich als Science Fiction getarnt ist, was leider ziemlich oft der Fall ist. Die Ideen und das Zwischenmenschliche stehen im Vordergrund.
Du bist seit einigen Jahren als Soundtrack-Komponist aktiv, auch vermehrt für große Hollywood-Produktionen. Natürlich möchte ich dich auch dazu befragen, jedoch zunächst in die Vergangenheit schauen, in das Wohnzimmer der Familie Jóhannsson in Island, wo der kleine Jóhann die Musik für sich entdeckt.
Musik spielte bei uns zu Hause eine große Rolle. Mein Vater spielte Akkordeon, Orgel und Schlagzeug, auch in Bands. Er nahm mich immer wieder zu Konzerten und Proben mit und natürlich gab es auch daheim Instrumente. Eine Heimorgel, ein Piano. Das erste Instrument, das ich richtig gelernt habe, war die Posaune.
Island ist ja ein schwieriges Thema. Erst war es lange Zeit so gut wie gar nicht existent im popkulturellen Sinne, dann kamen die Sugarcubes, Björk, Sigur Rós, Mum und für einige Jahre gab es in der Musikpresse kaum ein anderes Thema. Island war exotisch, anders, mystisch. Wie sah die Szene vor dem Durchbruch von Björk und den ersten Platten von Sigur Rós aus?
Es herrschte immer ein sehr freundschaftlicher Umgang miteinander. Man half sich gegenseitig und spielte natürlich auch nicht nur in einer, sondern immer in mehreren Bands. Wie das eben in einem kleinen Land ist. Nach Punk entwickelte sich auch in Island eine sehr vielfältige Szene. Björk und andere spätere Sugarcubes-Mitglieder hatten als Kukl zwei sehr gute Alben veröffentlicht, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Zeit des Postpunks hat uns alle sehr geprägt. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mein erstes Konzert 1989 gespielt. Unsere Band war damals die Vorgruppe der … Sugarcubes!
Ich mochte die Sugarcubes ja nie besonders. Mein erster Berührungspunkt mit isländischer Musik war, wenn ich mich recht erinnere, der „Children Of Nature“-Soundtrack von Hilmar Örn Hilmarsson.
Der in der gleichen Szene unterwegs war damals wie Björk und Co. „Children Of Nature“ ist von 1991, wenn mich nicht alles täuscht. Eine ganz wichtige Platte, genau wie der Film. Und ein ganz großer Einfluss für mich.
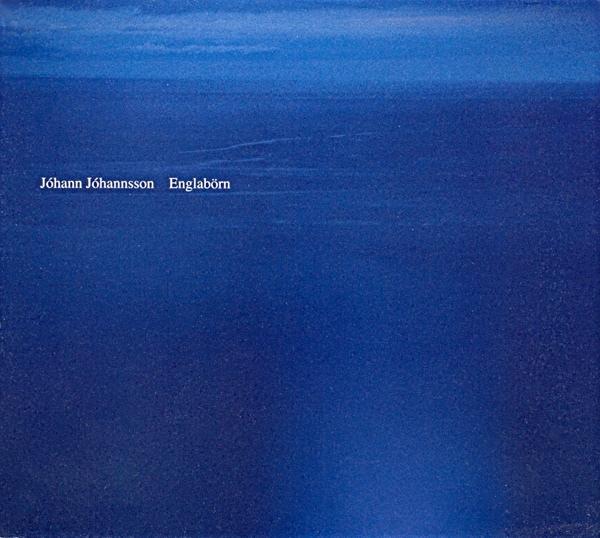
Englabörn, das erste Album von Jóhannsson (2002)
Wie klangen die Bands, in denen du damals gespielt hast?
Wir haben alle „Spacemen 3“ und „Loop“ und „The Jesus & Mary Chain“ gehört, Indie, ganz klassisch. Und so klangen wir auch. Viel Distortion, Wall Of Sound, mal mit Drummer, mal mit Drummachine. Es ging immer um Klangformung. Konzerte zu spielen, war zwar cool, mich hat die Arbeit im Studio aber schon damals mehr interessiert. Nicht dass ich ein großes Studio hatte, im Gegenteil. Aber ein bisschen Equipment stand mir zur Verfügung: ein Atari, ein Sampler. So habe ich mich ganz langsam an die Musikproduktion herangetastet. Irgendein Projekt stand immer an, weil wir uns eben alle immer gegenseitig geholfen haben. Meine musikalische „Sprache“ habe ich erst viel später gefunden, und das auch nur, weil ich mit einer Theatergruppe gearbeitet habe. Ich war ihr Komponist. Damals konnte ich zum ersten Mal für Ensembles und Streichquartett schreiben. Die Musik meiner ersten Alben „Englabörn“ und „Virðulegu Forsetar“ dokumentieren das.
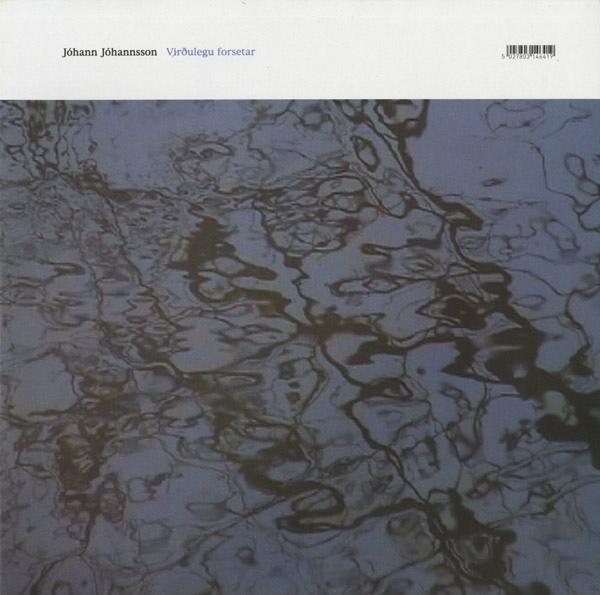
Virðulegu Forsetar, Jóhannssons zweites Album (2004)
Diese Art des Projekt-basierten Arbeitens zieht sich wie ein roter Faden durch deine Karriere. Früher Komposition für Theater und Tanz, heute der Soundtrack. Ist das eine bewusste Entscheidung? Bietet dir so ein klar abgesteckter Rahmen Sicherheit?
Weiß ich gar nicht. Ich arbeite auf jeden Fall sehr gerne mit anderen Menschen zusammen. Ich füge mich da gerne ein. Und ich verstehe es auch nicht als reine Auftragsarbeiten. „Englabörn“ ist zwar Theatermusik, wurde aber von mir für das Album umgeschrieben und neu strukturiert. Oder mein Album „IBM 1401“: Die Musik habe ich mit für eine Tanz-Performance gemeinsam mit dem Tänzer und der Choreographin entwickelt. Dann waren wir lange Zeit auf Tour mit dieser Produktion und erst dann habe ich es in einem Album verarbeitet. Ohne die Choreographin hätte ich die Musik auch nie schreiben können. Ich hatte das Konzept, die Grundidee, ein paar Skizzen rund um den alten IBM-Computer, erst ihre Ideen jedoch haben sich so inspiriert, die Stücke wirklich zu finalisieren. Musik für solche Projekte zu komponieren, hat auch große Vorteile. Gerade Anfang der Nuller-Jahre wäre es weder mir noch meiner kleinen Plattenfirma möglich gewesen, ein Orchester zu engagieren. Ich konnte diese Platten nur machen, weil die ursprünglichen Projekte das dafür notwenige Budget aufbringen konnten.
„Absolute Musik interessiert mich nicht."
Kontext spielt bei mir aber immer eine große Rolle. Auch für Musik, die ihren Ursprung nicht in einer Art von Auftragsarbeit hat. Ich habe immer bestimmte Geschichten oder zumindest Ideen im Kopf, die eine Rahmenhandlung für Alben ergeben. „Musik-Musik“ oder „absolute Musik“ interessieren mich nicht. Dinge miteinander zu verbinden, in einen Kontext zu stellen: Das finde ich spannend. Ich empfinde es fast als zu einfach, Musik „nur so“ zu schreiben und den Stücken irgendwelche Titel zu geben. Musik braucht Kontext. Auch wenn der nur für mich Sinn macht.
So ein Kontext, eine Rahmenhandlung ist ja ohnehin für den Großteil der Hörerinnen und Hörer nicht relevant, oder?
Und ich habe damit überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Ich will niemandem vorschreiben, wie er Musik allgemein oder meine im Besonderen zu hören hat. Aber es gibt auch Menschen, die sich für den Hintergrund und die Entstehung von Musik interessieren. Vollkommen egal, ob sie dann eine wie auch immer geartete Beziehung zu dieser Hintergrundgeschichte aufbauen können oder nicht, sich darin wiederfinden. Wenn das aber passiert, ist es großartig. Ich las kürzlich ein Interview mit dem Schauspieler Steve Coogan, in dem er über seine Lieblingsplatten spricht, u.a. die „IBM 1401“. Die Geschichte der Platte hat ihn tief berührt. Das sind wirklich schöne Momente.
IBM 1401, A Users Manual

Für mich ist „IBM 1401, A User’s Manual“ dein vielleicht wichtigstes Album. Erzähle doch bitte die Geschichte.
Es begann mit meinem Vater. Er erzählte mir von Aufnahmen, von Musik, die er mit diesem Computer gemacht hatte. Er arbeitete für IBM als Programmierer und war gleichzeitig mit der Wartung dieses 1401 beauftragt, dem ersten Computer in Island überhaupt. Dieses Computer-Modell war so ziemlich das erste, das in die Serienfertigung ging und an Universitäten im Einsatz war, aber auch in großen Firmen, die ihre Buchhaltung digitalisierten. Und er fand in Island eine Möglichkeit, wie man mit diesem Computer Musik machen konnte. Nicht im herkömmlichen Sinn – natürlich – das Ganze war sehr experimentell. Er stellte ein Kurzwellenradio neben den Teil des Rechners, wo der interne Speicher untergebracht war. Dann programmierte er den Speicher und das Radio fing dessen elektromagnetische Strahlung des Speichers auf. Als Ton, mehr oder weniger eine klassische Sägezahnwelle. Mein Vater entwickelte einen Algorithmus, mit dem es möglich war, diesen Ton zu modulieren und den IBM so kleine Melodien spielen zu lassen. Popsongs, Mozart, da war alles dabei. Als der Computer 1971 dann durch ein neueres Modell ersetzt werden sollte, entschieden sich mein Vater und seine Mitarbeiter dazu, diese Songs auf Cassette aufzunehmen. Das Tape beginnt jedoch mit meinem Vater, der es sich nicht nehmen ließ, eine Art Grabrede für den 1401 zu halten, er wollte sich verabschieden. Und offenbar hatten sie kein frisches Tape verwendet. Nach der Rede und den Songs folgte eine Art gesprochene Gebrauchsanweisung für den Computer, ganz offensichtlich von IBM selbst, die – so reime ich mir das zusammen – zu einer Diashow abgespielt werden sollte, um bestimmte Dinge besser zu verstehen oder auch Probleme zu beheben. Diese britische „Erzählerstimme“ hört man auf meinem Album.
„Während der Arbeit an einem Soundtrack begreife ich mich nicht primär als Musiker, sondern eher als Filmemacher.“
Wie wird man eigentlich Soundtrack-Komponist?
Filmmusik ist eine große Leidenschaft von mir. Und ich komponiere auch schon sehr lange Soundtracks, zunächst eher für kleine Projekte, nennen wir sie mal Arthouse-Produktionen. Meine Alben sind da wohl eine ganz gute Visitenkarte. „Prisoners“ war dann das erste große Projekt, sowohl für mich als auch für den Regisseur Denis Villeneuve, der zuvor auch eher in der Arthouse-Szene aktiv war. Die Art und Weise, wie er arbeitet, kam mit sehr entgegen, er ließ mir vollkommene Freiheit. Die Musik ist also einerseits ein Soundtrack, andererseits aber eigentlich auch ein Solo-Album, weil ich zu keinem Zeitpunkt auch nur den kleinsten Kompromiss machen musste. Er wollte Musik von mir, das war alles. Was mich an Soundtracks als Komponist interessiert, ist die Tatsache, dass ich mich bei jedem Film völlig neu orientieren muss. Musik für einen Film zu schreiben, bedeutet zunächst, die richtige Ausdrucksform zu finden, die „Sprache“ des Films ausfindig zu machen. Mir bereitet diese Herausforderung viel Spaß, weil ich Filme generell sehr mag. Ich begreife mich während eines solchen Projekts auch gar nicht primär als Musiker, sondern eher als Filmemacher. Was funktioniert am besten für den Film, was braucht der Film: Das sind Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Mein Komponisten-Ego tritt in den Hintergrund, ich arbeite in einem Team. Da ist kein Platz für meine Obsessionen, es geht um das gemeinsame Ziel. Wenn es gut läuft, dann entsteht dabei etwas wirklich Besonderes. Und wenn es nicht so rund läuft, dann war es eben nur Musik für einen weiteren Film. Auch das muss dann einfach so hinnehmen. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit in Soundtracks investiert. Es gab viele Anfragen, es waren gute und interessante Drehbücher, da fällt es schwer, nein zu sagen. Aktuell spüre ich, dass ich eine Pause brauche, um mich auf meine eigenen Projekte zu konzentrieren. Auch wenn ich daran immer parallel gearbeitet habe. Ich habe mir die Arbeit in der Vergangenheit schon zeitlich aufgeteilt. Sechs Monate Soundtracks, sechs Monate meine Projekte. Die erste Veröffentlichung, die ansteht, ist tatsächlich wieder ein Soundtrack, aber für einen Film, den ich gedreht habe, auf Super 8 in der Antarktis. Das erscheint als Paket auf dem Berliner Label „Sonic Pieces“. Nächstes Jahr kommt ein echtes Solo-Album, und vor wenigen Monaten habe ich eine Komposition für Chor und Streichquartett in New York uraufgeführt. Die wollen wir 2017 veröffentlichen. Es kommt also einiges.

Ich stelle mir die Arbeit an Soundtracks ja sehr stressig vor.
Es kommt immer darauf an, generell mag ich aber klare Deadlines.
Für mich ist ein Soundtrack dann wirklich gut, wenn er nicht nur auf der Leinwand funktioniert, sondern auch als Album. Und das ist meinem Empfinden nach zu selten der Fall. Soundtracks funktionieren oft nach dem Schema F. Zwei, drei Themen, zahllose Variationen, Soundtracks bestehen oft aus sehr kurzen Stücken, die dann noch mit den lizenzierten Popsongs angereichert werden, die, der Zeitleiste des Films folgend, zwischen die eigentlichen Kompositionen gequetscht werden. Aus Sicht der Komponisten muss das doch der blanke Horror sein.
Ich versuche die Musik so zu schreiben, dass sie auch losgelöst vom Film funktioniert. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Aber das ist das Ziel. Es gibt zahlreiche Soundtracks aus en 1960er- und 1970er-Jahren, die mich sehr beeinflusst und beeindruckt haben, zunächst auch oft, ohne den dazugehörigen Film gesehen zu haben. Obskure Musik, merkwürdige Keimzellen der Kreativität. Die Form des Soundtracks liegt mir sehr am Herzen. Und man muss einen Soundtrack auch anders konzipieren als das klassische Solo-Album. Es gibt diese Wiederholungen, die Variationen, es kommt aber darauf an, wie man sie strukturiert, wie sie aufeinander aufbauen. Im Film und auf Platte. Auf meinem aktuellen Soundtrack für „Sicario“ zum Beispiel gibt es ein Stück – „Desert Music“ -, das im Film nur wenige Sekunden läuft, auf dem Soundtrack aber rund fünf Minuten lang ist. Ich achte bei den Aufnahmen sehr darauf, dass es auch auf Platte funktioniert. Entweder nehmen wir anderer Versionen zusätzlich auf oder zumindest längere. Aber genauso wie ich Soundtracks anders angehe als Solo-Alben, müssen Soundtracks auch anders gehört werden.
Wie funktioniert das praktisch, einen Soundtrack zu komponieren. An welchem Punkt des Filmprojektes steigst du ein?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt sehr vom Regisseur ab und wie wichtig ihm die Musik ist. Denis Villeneuve ist ein extremes Beispiel. Er schickt mir das Drehbuch und ich bin auch zum Teil bei den Drehs dabei, um die Stimmung besser nachvollziehen zu können. Für den neuen Film „Story Of Your Life“ habe ich schon sehr früh einige Skizzen aufgenommen und ihm geschickt, damit er sie während der Dreharbeiten hören kann. Wir versuchen so, uns gegenseitig zu inspirieren, auch wenn diese Demos vielleicht gar nicht im finalen Film auftauchen werden. Das sind ideale Umstände. Wenn die Musik integraler Teil der DNA eines Films ist. Das ist natürlich nicht immer so. Oft wird bei einer Produktion erst während des Schnitts entschieden, wer nun die Musik schreiben soll. Auch das ist nachvollziehbar, denn erst im Schnitt bekommt man in der Regel eine ungefähre Ahnung davon, was für einen Film man hier eigentlich gerade fertigstellt. Wie er aussehen wird, welche Stimmung er transportiert. Bei „Theory Of Everything“, dem Film über Steven Hawking, war das zum Beispiel so.
Und dann kommen die Deadlines ins Spiel.
Klar, aber ich hatte dennoch rund drei Monate Zeit. Es gibt Kollegen, die schreiben Soundtracks in drei Wochen.
Du hast „Sicario“ und „Theory Of Everything“ selbst erwähnt. Zwei Alben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. „Theory Of Everything“ ist sehr …
… romantisch?
Unbedingt. Und „Sicario“ ist sehr düster, dronig, sehr perkussiv. Es hat mich gefreut, eine andere Facette von dir zu hören. Die kannte ich noch nicht. Oder ich hatte vergessen, dass es sie gibt, weil du die vergangenen Jahre sehr auf getragene Streicher-Arrangements fokussiert hast. „Sicario“ ist musikalisch sehr eigen.
Sagen wir mal so: Bei „Theory Of Everything“ habe ich mich tatsächlich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin total stolz darauf, die Musik gemacht zu haben, aber das Projekt hat es erfordert, dass ich mich ein bisschen … dehne. „Sicario“ hingegen ist viel näher dran an Jóhann Jóhannsson dem Komponisten. Drums und Percussion haben bei mir in den letzten Jahren keine große Rolle gespielt, das stimmt. Aber ich mag diese Ausdrucksform, Musik, die einen überwältigt und vielleicht auch fragend zurücklässt. Diese Art der Komposition interessiert mich aktuell sehr, ich habe mich immer mehr in diese Richtung entwickelt. Dunkle, nicht klar definierte Texturen und Strukturen.
Gehört der melodiöse Jóhannsson damit der Vergangenheit an oder ist das nur eine Phase?
Eher letzteres. Das Solo-Album, an dem ich gerade arbeite, hat wieder viele „schöne“ Elemente im klassischen Sinn, ist aber auch deutlich elektronischer und sehr dronig. Ich versuche mit jeder Platte immer etwas Neues zu machen. Nur so lerne ich selbst dazu. Sonst würde ich mich auch langweilen. Es gibt Kollegen, die haben ihre spezifische Ausdrucksform gefunden und variieren die von Album zu Album. Das ist vollkommen in Ordnung, ich könnte das aber nicht.





