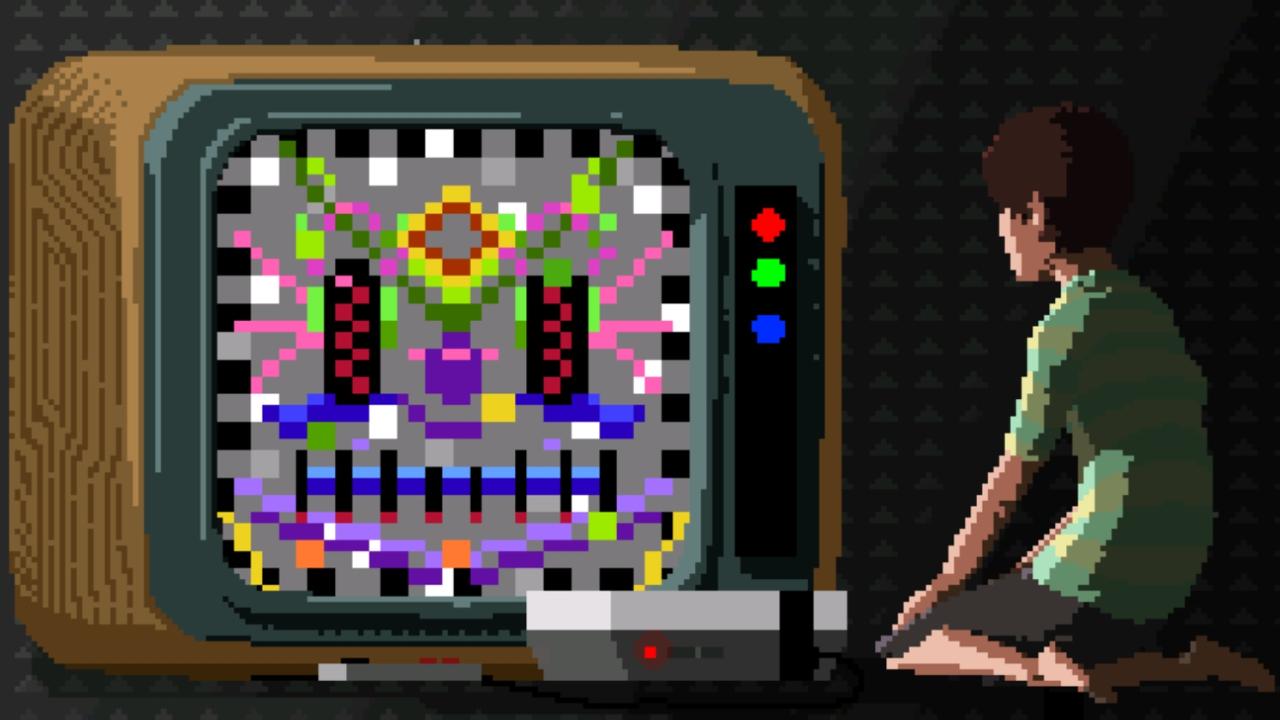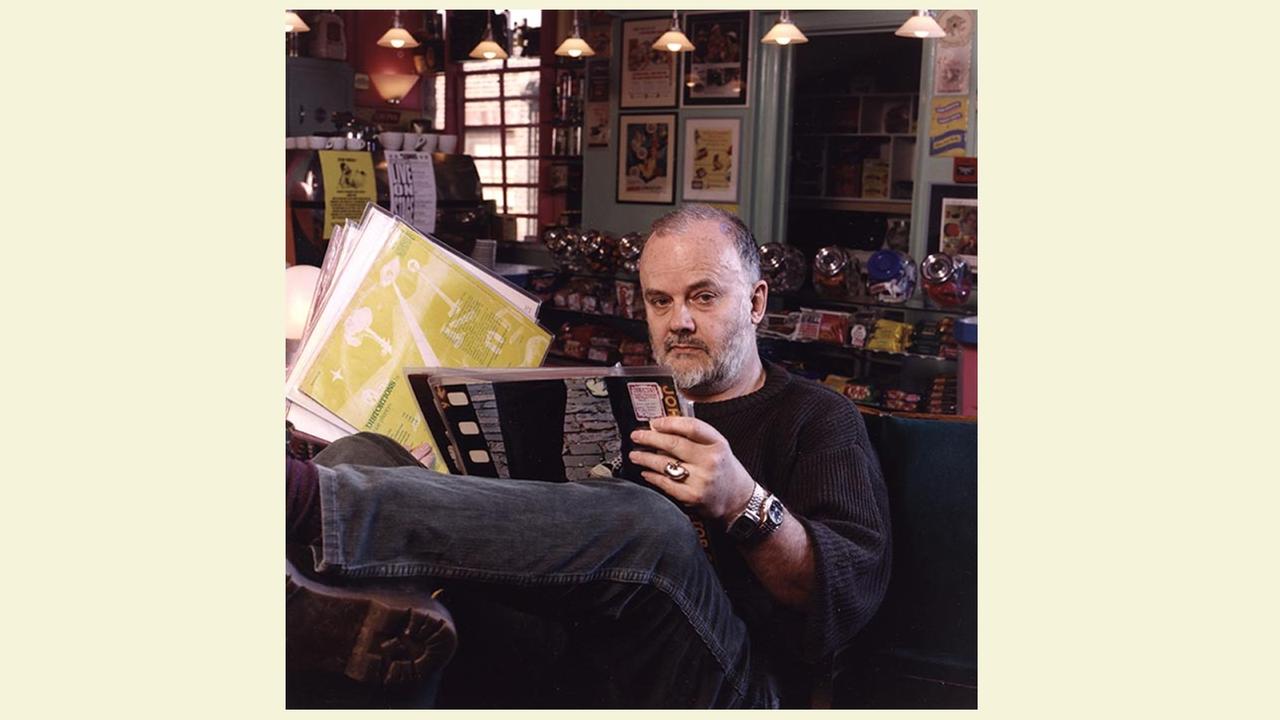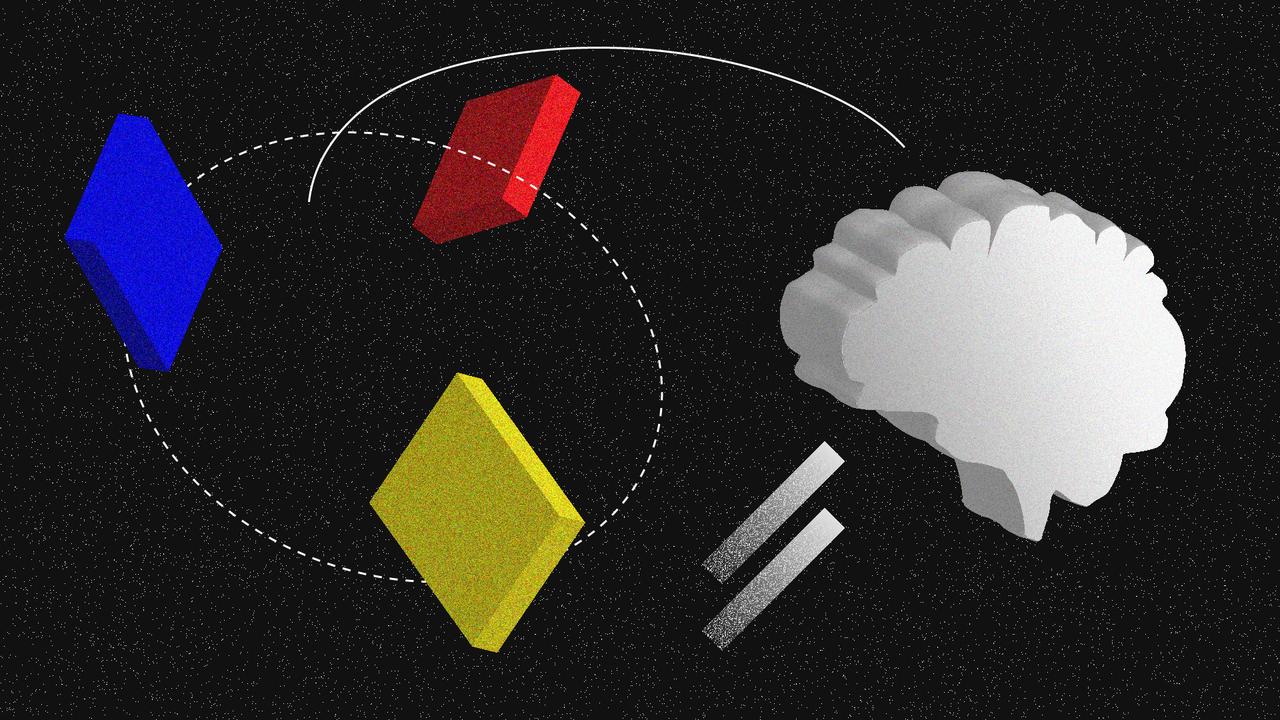Hassliebe DeutschrapDie Autoren Jan Wehn und Davide Bortot über die Geschichte von HipHop und ihr neues Buch „Könnt ihr uns hören?“
28.2.2019 • Sounds – Interview: Ji-Hun Kim
Deutschrap als Massenkultur: Zehntausende HipHop-Fans beim Splash! 2018 | Foto: Woodyphotografix
Im Musikjournalismus gehören Jan Wehn und Davide Bortot zu den ausgewiesenen Experten, wenn es um deutschen HipHop aka Deutschrap geht. Das manifestiert sich in ihrer Oral History „Könnt ihr uns hören?“ über die Entstehung eines Genres, das heute mehr Mainstream und erfolgreicher ist als jede andere Musik der Gegenwart. Davide Bortot leitete von 2003 bis 2007 die Redaktion der Magazin-Institution Juice. Jan Wehn ist Gründer des HipHop-Magazins All Good und gilt spätestens seit seinen Podcasts als eine der reflektiertesten und meist geschätzten Stimmen im Geschäft. Für das gemeinsame Buch führten die Autoren über 100 Interviews mit so ziemlich jedem, mit dem man über dieses Thema sprechen sollte. Herausgekommen ist eine lebhafte und zugleich respektvolle Erzählung über etwas, das beide als ihre große Hassliebe beschreiben. Sollten bei einer Hassliebe immer derart unterhaltsame wie lehrreiche Bücher rauskommen – uns wäre es recht.
Wie lange habt ihr am Buch gearbeitet?
Jan Wehn: Die ersten Anfragen haben wir August 2017 raugeschickt, die ersten Interviews dann im November geführt. Im Grunde genommen haben wir ein Jahr daran gearbeitet.
Euer Buch reiht sich in den Kanon anderer Oral Historys in deutscher Sprache. Allen voran Jürgen Teipels „Verschwende deine Jugend“ und dann auch „Klang der Familie“ von Sven von Thülen und Felix Denk. War euch klar, dass ihr an der Fortschreibung der hiesigen Popkulturgeschichte arbeitet?
Davide Bortot: Wenn man uns da einordnet, bin ich auf jeden Fall sehr glücklich damit. „Klang der Familie“ war für mich eine wichtige Inspiration.
Jan: Ich habe Felix gefragt, wie sie das gemacht haben und danach war uns klar: Das kann man schaffen. Uns ging es aber nicht darum, irgendeine Art Nachfolger oder so dazu zu schreiben.
Davide: Wir haben lange darüber gesprochen, wie man diese Geschichte erzählen kann. Das Konzept der Oral History erwies sich als gute Option. Für mich war es eher eine Inspiration, als dass wir uns da einreihen wollten. Wir haben den Anspruch gefasst, nicht nur für unsere Peergroup ein Buch zu schreiben, sondern dass jemand, der generell daran Interesse hat, es genauso lesen kann. Bei uns fällt die Zeitspanne viel größer aus. Die erste Geschichte spielt sich im Jahr 1981 ab und die letzte 2018. Auch räumlich war das viel diverser. „Klang der Familie“ lebt ja von dem Gefühl, einem kleinen Zirkel über einen prägenden, aber doch sehr kurzen Zeitraum in Berlin beizuwohnen. Bei uns wird wesentlich weiter rausgezoomt.
Jan: Das Format bietet sich einfach an. Wir sprechen von einer Zeit, in der ich wahnsinnig jung war. Mir kam das immer bisschen respektlos und vermessen vor, aus meiner Perspektive zu erzählen, wie das damals eigentlich gewesen ist. Für mich war dies der respektvollste Umgang.
Dennoch gibt es eine Selektion mit den Protagonisten, die interviewt werden. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie kann man einen so einen historischen Rahmen stecken?
Jan: Einige sind sehr offensichtlich. Künstler wie Martin Stieber von den Stieber Twins, Toni L, Kool Savas, Sido, Marteria und Casper waren eigentlich gesetzt. Dann haben wir geschaut, wer drumherum für Erzählstränge sorgen könnte, die nicht so offensichtlich sind.
Davide: Da sind viele Stellvertreter dabei. Es heißt nicht, dass die, mit denen wir nicht gesprochen haben, nicht relevant sind. Wir hätten noch 100 mehr interviewen können. Für viele Strömungen haben wir uns eine Stellvertreterin oder Stellvertreter rausgesucht. Es ging um interessante Perspektiven.
Ich habe persönlich Anfang der Nuller-Jahre mein Interesse an deutschem HipHop ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, das Buch kann Leute aus beiden Generation abholen: junge Cloudrap-, aber auch alte HipHop-Fans. War das die Intention, den einen großen Bogen zu spannen?
Jan: Es gibt die Vorstellung davon, dass die Musik Ende der Neunziger-, Anfang der Nuller-Jahre einen Peak erreicht hatte. Auch in meinem Freundeskreis sind viele danach ausgestiegen. Ich kann sogar einen konkreten Moment benennen: Als „Mein Block“ von Sido auf der Juice-CD erschien, hat das in meinem Umfeld zu handfesten Diskussionen geführt. Ab dem Moment hatte man quasi zwei Lager. Ich fand es aber wichtig, zu zeigen, wie alles zusammenhängt und dass es vor allen Dingen auch weitergeht. Alles steht doch in Beziehung zueinander. Es geht auch um den Respekt zwischen den Generationen. Die Älteren sprechen ja gerne den Jüngeren die Qualität ab. Umgekehrt gibt es genauso eine kritische Distanz. Das liegt aber in der Natur des HipHop.
Spaltete 2004 Freundeskreise und die Gemüter: Sido – Mein Block.
Ihr schreibt selbst, dass das Thema bei euch eine Art Hassliebe ist. Was meint ihr damit?
Davide: Ich weiß noch genau, wie ich die „Alte Schule“-Compilation zum ersten Mal gehört habe. Wir waren 13,14 und ich fand das total kacke. Wir hatten doch Black Moon, Wu-Tang Clan, D.I.T.C. – wieso hätte ich mir so was schlecht gemachtes anhören sollen? Ich hatte mit Graffiti nichts am Hut, das Cover hat mich schon abgeturnt. Ich fand das weder funky noch stylish – und dann noch die ganze Regelkacke. Im Rückblick weiß ich diese Pionierarbeit anders einzuordnen und zu verstehen. Ich weiß, was für ein kulturelles Kapital da geschaffen wurde. Auch was für eine bedeutsame Leistung das für die popkulturelle Identität in diesem Land für viele Generation danach war. Aber die Musik hat mir damals trotzdem nicht gefallen. Ich hab mich eher für Drum and Bass, House und Elektronik interessiert. Geändert hat sich das dann mit Eins Zwo und Dynamite Deluxe, die haben das für mich erst klar gemacht. Diese Hassliebe existiert bis zum heutigen Tag. Ich finde viel Musik nicht gut. Aber wenn ich etwas Besonderes für mich entdecke, dann berührt es mich mehr als alles andere. Ich wollte mich nicht vor die Szene als Ganzes stellen, was ein üblicher Reflex vieler Leute ist, das nach außen immer zu verteidigen. Immer wieder werden – damals wie heute – Positionen vertreten, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Es gibt viel Kackmusik, aber vor allem so viel Quatsch, der immer wieder in irgendwelchen Interviews und Social Media erzählt wird. Das beschäftigt mich heute fast mehr als die Musik. Das ist meine Hassliebe.

Die 1993 erschienene Compilation „Alte Schule“ erschien auf MZEE Records und gilt heute als Meilenstein. Damals dabei: Stieber Twins, Boulevard Bou, Toni L, DJ Stylewarz und viele mehr.
Jan: Ich würde mich dem anschließen. Aber letztlich ertappe ich mich dabei, wir mir Spotify anzeigt, dass im Januar bei mir sowohl das Döll-Album als auch die Modus-Mio-Playlist am häufigsten lief. Das ist mir dann gar nicht so bewusst. Ich frage mich oft: Wie kann das sein, dass du so viel Zeit deines Lebens mit so einem Unsinn verschwendest – auch vollkommen zurecht. Aber dann gibt es wieder die Momente, in denen mir nichts lieber ist, als mich damit zu beschäftigen. Das übt noch immer eine wahnsinnige Faszination aus. Ich kann einfach nicht ohne.
Ich bin erstaunt, wie groß dieser Kosmos geworden ist. In den Neunzigern gab es HipHop, Skate-Punk, Techno, Hardcore, aber da hat man sich für eines oder mehrere Genres in seiner formativen Zeit entschieden. Vielleicht auch, weil das Angebot und der Zugang gar nicht so groß war. Mir scheint, als wäre HipHop heute alleine so groß und komplex wie alle Subkulturen von damals zusammen. Aber dann trägt man doch auch Verantwortung darüber, welche Narrative geschrieben werden. Für welche Geschichtsschreibung entscheidet man sich? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Kinderzimmer Productions nicht einmal auftauchen. Wie geht das, fragte ich mich, dass man mit so vielen Rappern spricht und nicht einmal der Name gedroppt wird?
Davide: Ich habe das auch gerne gehört und immer hochgehalten. Aber es ist interessant zu hinterfragen, inwiefern sich über all die Jahre gewisse Narrative verfestigen können. Ist aber nicht nur beim HipHop und der Musik so. Die Repetition von bestimmten Annahmen und Erzählungen führt dazu, dass plötzlich etwas zum unumstößlichen Fakt wird. Kinderzimmer Productions wurden tatsächlich von fast niemandem erwähnt. In meinen Interviews war Marc Leopoldseder der einzige, der das mal kurz angeführt hat. Als Beispiel, dass es früher schon Acts gab, die sich bewusst gegen den Mainstream, Klischees und bestimmte Rollenbilder gestellt haben und er sich wünscht, dass so was heute öfter passieren würde. Es ist wahrscheinlich ein normales Phänomen. Das Narrativ um Advanced Chemistry ist ein Beispiel dafür. Es ist unbestritten, dass sie früh dran waren mit allem und einen immensen Impact auf viele Leute hatten. Es hat aber offensichtlich auch damit zu tun, was aus bestimmten Dingen erwachsen ist. Dass Advanced Chemistry heute so hochgehalten werden, hat damit zu tun, dass sie das ganz persönliche Erweckungserlebnis für die Beginner waren und die wiederum eine erfolgreiche Band sind, die sehr offensiv ihre Sozialisation nach außen trägt. Vielleicht wäre das ohne diesen Umstand gar nicht so das große Thema. (Das 2016 erschienene Comeback-Album der Beginner heißt „Advanced Chemistry“ und man ging mit Advanced Chemistry danach gemeinsam auf große Tournee, Anm. d. Red.) Die Sache bei Kinderzimmer Productions ist wahrscheinlich die: Einfach zu wenige, die danach erfolgreich HipHop gemacht haben, beziehen sich darauf. Das schmälert die Leistung natürlich keineswegs.
So geht Legendenbildung: Die Beginner auf der Bühne mit Torch 2016 in Hamburg.
Mir fällt das auch bei anderen Genres wie Indie und Rock in den Neunzigern auf. Dass plötzlich nur noch Nirvana und die Red Hot Chili Peppers für eine Dekade stehen, und hundert andere großartige Bands mehr oder weniger ausradiert werden.
Davide: Tobi Tobsen hat erzählt, dass es diesen imaginären Trennstrich gibt: Auf der einen Seite gibt es die Gewinner und dann gibt es welche, die ganz nah dran an der Gewinnerseite waren. Aber über die Jahre hat sich die Kluft, die einst ganz klein war, zu einem riesigen Graben ausgewachsen. Heute gibt es die Beginner, Dendemann, die als Legenden auch teils verklärt werden und viele, die damals ganz nah dran waren und heute total in Vergessenheit geraten sind. Ich habe gestern mit jemanden über MC Rene und Too Strong gesprochen – vielleicht waren die auch einfach zu früh dran. Die Beginner sind vielleicht die einzigen, die 1991/1992 schon dabei waren und dann zu so einem großen kommerziellen Erfolg gelangt sind. Alle anderen Protagonisten der frühen Neunziger hatten nie den ganz großen kommerziellen Durchbruch. Mit Ausnahme der Fanta 4 – aber deren Geschichte ist ohnehin eine ganz andere.
Jan: Es radiert sich genau wegen solcher Dinge aus. Ich hatte anfangs einen krassen Vollständigkeitsanspruch, Davide nachts angeschrieben und gefragt, ob auch ja der eine etwas über den anderen erzählt hat. Ich hatte richtig Herzklopfen aus Angst, dass jemand Wichtiges keine Erwähnung finden könnte. Eine illusorische, naive Idee von Vollständigkeit – so bin ich auch in die Interviews gegangen, und teilweise war schon bei der ersten Frage klar, dass dieser Mensch offenbar dann doch nicht die Relevanz hatte, die ich ihm beigemessen hätte. Ich hätte gerne mehr über Frankfurt erzählt. Im Buch fokussiert sich das stark auf Moses Pelham und Rödelheim Hartreim Projekt. Aber jemand wie Azad hat uns wiederum kaum etwas von dieser Zeit erzählt. Über die wichtigsten Jams wussten teilweise die meisten auch einfach nicht mehr richtig Bescheid. Interessant auch, wie bei all diesen Leuten links und rechts Sachen runterfallen und sich ein Strang manifestiert. Bei einigen der früheren Generation merkte man, dass es durchaus Brüche in ihren Lebensläufen gibt. Einige wollen kaum über die Vergangenheit sprechen. Und bei Dendemann haben wir auch das Gefühl, dass er damit abschließen will: Das war das, aber jetzt ist jetzt. Ich kann das verstehen. Aber gerade, wenn es darum geht, einen Kontext zu erschließen, ist das natürlich schwierig.
Man darf ja auch den Rahmen nicht sprengen.
Jan: Ursprünglich hatten wir eine Version mit 900 Seiten. Da hätte man mehr Platz den Details und Nebenschauplätzen widmen können. Wir hätten wahrscheinlich auch 1.300 Seiten drucken können.
Mir ist klar, dass Vollständigkeit ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Jan: Es gibt einige Leute, denen ich gerne mehr Platz eingeräumt hätte.
Davide: Wir nennen das den Mut zur Zuspitzung. Wir wollten Zusammenhänge aufzeigen und eine stringente Geschichte erzählen. Den Anspruch an Vollständigkeit habe ich schnell fallen lassen. Kinderzimmer würde ich in eine spezielle Kategorie tun. Es gibt immer diese Outlier, die in ihrer Zeit für etwas sehr Eigenständiges standen. Kinderzimmer kann man da nennen. Für mich zählen aber auch Feinkost Paranoia dazu. Die standen für sich, haben aber keine Strömung begründet.
Jan: Wir haben während der Gespräche durchaus Stichpunkte gesetzt und natürlich gefragt: Wer war für euch super wichtig, ist aber Zeit seines Lebens nicht richtig gewürdigt worden? Dann fielen hier und da auch Namen wie SD oder Profan 78. Ich bin selbst riesengroßer Profan-Fan. Am Ende waren es aber doch nur drei Leute, die überhaupt etwas zu ihm gesagt haben.

Real: Davide Bortot und Jan Wehn machen wie Rapper Fotos auf der Straße. | Foto: Robert Winter
Wie kam es, dass Torch nicht dabei war. Den habt ihr mit Sicherheit nicht nur einmal angefragt. Was treibt er?
Davide: Man kann dazu sagen, dass er mit der ganzen Deutschrap-Sache, wie sie sich heute präsentiert, wie sie sich als Szene und Industrie darstellt, nicht besonders glücklich ist. Er findet, dass Geschichte verfälscht und vieles in der Geschichtsschreibung nicht akkurat wiedergeben wurde. Er kann sich mit vielem, was heute passiert, nicht identifizieren und wollte nicht zu dieser Dynamik beitragen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Dennoch wollte er das nicht, und er hatte das Gefühl, das schon so oft erzählt zu haben. Torch ist derzeit eher an einer akademischen Aufarbeitung dieser Geschichte interessiert. Sein Thema ist HipHop, nicht Rap, und noch weniger geht es ihm um Deutschrap. Auch wenn er von anderen als Gründervater von Deutschrap tituliert wird: Sein Ding war das nie. Für ihn ging es immer um die drei gleichberechtigten Bestandteile der HipHop-Kultur. Er hat schon als Kind getanzt und gezeichnet und mit dem Aufkommen von HipHop quasi eine Plattform gefunden, in der er alle seine Talente abbilden kann. Das ist ihm wichtiger, als sein Rappen mit dem von Rin in eine Linie zu ziehen.
Jan: Es ist zwar schade, aber es funktioniert auch gut ohne ihn. Er taucht häufig auf. Toni L kommt oft zu Wort, der kann auch viele Dinge aus der Zeit erzählen. Es gab einige, die hatten keine Zeit oder keine Lust. Da muss man halt andere fragen.
Davide: Wir haben es auf jeden Fall versucht.
Davon bin ich schwer ausgegangen.
Jan: Man verdrängt, wie oft man Menschen hinterher gerannt ist. Wie ich zehn Mal mit einem Berliner Rapper auf WhatsApp hin und her geschrieben habe, bis wir am Ende dann für eine halbe Stunde telefoniert haben – nur, damit er das Interview dann doch wieder zurückzieht. Naja, Hassliebe halt.
Jürgen Teipel hat mir erzählt, als er „Verschwende deine Jugend“ geschrieben und dafür frühere Punkmusiker aus Düsseldorf getroffen hat, sah er einige Male frühere Helden als gebrochene Gestalten mit Lidl-Tüte auf der Parkbank wieder. Beim Rap habe ich das Gefühl, dass es eher einige gibt, die akademische Karrieren gewuppt haben. David P. ist Mediziner geworden, Chris Stieber Architekt. Welche soziale Spannweite habt ihr dabei vorgefunden?
Davide: Das komplette Spektrum. So habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber gut, dass du es ansprichst. Genauso wie die Musik unsere Gesellschaft und unsere Welt in ihrer Gesamtheit widerspiegelt, tun es auch die einzelnen Biografien. Es gibt viele Akademiker. Es gibt trauriger Weise auch viele, die es nicht einfach haben im Leben. Die leben teilweise am unteren Ende des finanziellen Spektrums. Umgekehrt gibt es einige, die erfolgreiche Unternehmer geworden sind. Dann gibt es wiederum die, die weiterhin Kunst machen. Das fand ich das Interessanteste an dem Prozess, wie Leute, die man in einem bestimmten Kontext kennengelernt hat, in ihren Biografien sich sehr unterschiedlich entwickeln. Auch unter denen, die jetzt noch dabei sind. Die Haltungen könnten nicht unterschiedlicher sein. MC Rene hätte der erste Superstar sein können. Vielleicht war er es für kurze Zeit auch. Aber auch als es nicht so gut lief, hat er festgestellt, dass es ihm ums Machen und seinen künstlerischen Ausdruck geht. Er hat seinen Frieden gefunden mit der Sache und macht es dennoch weiterhin, weil es ihm am wichtigsten ist, im Studio zu sein und Tracks aufzunehmen. Er macht das exakt wie vor 25 Jahren.
Jan: Gleichzeitig ist Rapper zum Berufsbild geworden. Dendemann hat vor kurzem erzählt, wie sein Zahnarzt zu ihm meinte: „Sie sind Rapper von Beruf, oder?“ Da war ihm klar, dass es den Beruf Rapper jetzt gibt.
Damals noch kein Berufsbild. Für die ZDF-Sendung „Lost in Music“ 1993 freestylten MC Rene, Eißfeldt, Boulevard Bou und Denyo in der Berliner Insel der Jugend vor laufender Kamera.
Wie oft musstet ihr mit alten Helden mitleiden?
Jan: Tatsächlich seltener als gedacht. Mir wurde aber auch erst während der Arbeit an dem Buch klar, dass es um so viel mehr als nur die Musik geht. Insbesondere bei denen, die in den Achtzigern und Neunzigern damit angefangen haben. Zu erfahren, wie sehr das deren Leben geprägt hat. Wie Freundschaften fürs Leben entstanden sind. Aber wie auch Freundschaften an kommerziellen und eigenen Erwartungen zerbrochen sind. Das war sehr bewegend. Für mich, aber auch für die Gesprächspartner. Da sind des Öfteren die Tränen geflossen. Darüber habe ich zuvor nicht nachgedacht. Da habe ich das erste Mal verstanden, was ich da überhaupt mache. Einige haben ihr ganzes Leben nochmal auf links gedreht.
Davide: Ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied zur Punk- und vor allem der Techno-Szene ist auch, dass Drogen im HipHop keine so große Rolle gespielt haben. Gebrochene Existenzen haben ja nicht selten mit Drogen zu tun. Die Konsens-Haltung im HipHop war eher gegen Betäubung. Bei der Zulu Nation sogar explizit. Zudem hat Rap schon immer eine recht konsumfreundliche, kapitalistische Haltung gehabt. Viele Leute, die sich dahin gezogen fühlten, waren eher Machertypen. Leute, die irgendwas auf die Reihe kriegen und damit auch Geld verdienen wollten. Anfangs war das offiziell noch verpönt, aber man merkte bei vielen diese Hustler-Mentalität. Da sind viele Verkäufer darunter, die ihr Talent und ihre Beziehungen gewinnbringend einbringen wollen und können. Der Vibe im Tresor 1992 war wahrscheinlich ein anderer und drehte sich eher um alternative Lebensmodelle und die Ablehnung gesellschaftlicher Standards. Das gab es bei HipHop bis zu einem gewissen Level, aber es gab zugleich immer das Bedürfnis, etwas zu machen, etwas aufzubauen: Ich möchte was für die Community bewirken und Geld verdienen. Das war schon Thema in der Bronx der Siebziger: Man wollte es da raus schaffen. Um Deutschland war die Ausgangssituation zwar in der Regel weit weniger schlecht, aber auch da ging es um die Sneaker, die Kette, die Chartplatzierung, die Karre und den Kontostand
Jan: Wo man aber auch sagen muss, dass Anfang der Nuller-Jahre einige richtig auf die Schnauze gefallen sind. Da gibt es die Geschichte, dass Dendemann zu Martin Stieber nach Heidelberg geflohen ist, weil er die Steuerfahndung im Nacken hatte.
Davide: Buchhalterische Fähigkeiten und unternehmerische Ambitionen gehen ja nicht immer Hand in Hand.
Nichtsdestotrotz haftete dem frühen deutschen HipHop auch was Spießbürgerliches an. Ich musste bei dem Jan-Delay-Zitat lachen, wo er erzählt, dass es bei einer Jam einen Breakdance- und Freestyle-Contest gab und der erste Preis war ein Saftmixer. Das war wirklich nicht die Bronx.
Davide: Absolut. Es war ein bürgerliches Milieu, wenn auch nicht unbedingt Rich Kids. Eißfeldts Familie war vielleicht nicht wohlhabend, aber das waren Bildungsbürger und Künstler. Studierte Menschen, die das sogar unterstützt haben. Denyo erzählt das an einer Stelle: Da konnte man hingehen, kiffen, Platten des Vaters hören und samplen, ein künstlerisch-kreatives Umfeld, das in anderen Teilen der Gesellschaft nicht zur Tagesordnung gehörte. Die Spießigkeit kommt meiner Meinung nach durch die Regeln, die man damals aus dem Film „Wild Style“ aufgegriffen hat. Der wird von vielen noch immer als die Gebrauchsanweisung Nummer 1 tituliert. Die Ideologie der Zulu Nation hatte ja viel damit zu tun, ein besseres Leben für die Leute aus der Hood zu schaffen. Negatives in Positives umzukehren. Wenn man das aber auf eine Realität in Heidelberg oder Eppendorf überträgt, dann erhält es eine andere Dynamik. Ob der Saftmixer nun Zufall war, oder ob man wirklich sagen wollte: Hier wird nicht gesoffen, wir sind aktiv und trinken Saft, ist spekulativ. Aus der Sicht der Zulu Nation oder frühen House-Clubs in den USA hatte diese Einstellung aber natürlich eine ganz andere, viel existenziellere Bedeutung. Man hat das aber einfach übernommen, obwohl diese Regeln in einem völlig anderen kulturellen Kontext standen.
Jan: Das gilt zwar für die meisten Städte, in Berlin war das aber anders. Berlin galt schon immer als Gegenspieler. Und tatsächlich würde ich behaupten, dass das, was im Schwabenland wichtig war, für die Entwicklung der Berliner Szene keine Rolle gespielt hat. In Stuttgart hat sich ganz schnell eine krasse Infrastruktur gebildet. Die haben schnell erkannt: Man kann nicht nur Musik machen, sondern auch einen Club, wo sich die Künstler und DJs präsentieren können, womit die Leute anfingen die Platten zu kaufen. So ist ein Business entstanden. Man hat schnell mit Majorlabels verhandelt, hat sich um die GEMA gekümmert. Das gab es in Berlin überhaupt nicht, es war lange nicht so professionell. Im Gegenteil, man hat verächtlich nach Westdeutschland geguckt. Die sind mit Reisebussen auf Jams nach Westdeutschland und haben den Leuten die Schuhe abgezogen. Aphroe hat von einer Jam berichtet, wo alle ihre Schuhe ausziehen mussten. Dann wurde die Kasse eingepackt. Die haben sich an anderen HipHoppern bereichert. Tatsächlich haben sowohl Frauenarzt als auch Bushido mit der selben MPC ihre Musik gemacht. Die wurde geteilt und das Gerät wurde permanent durch die Stadt getragen. Bushido hat mir mal erzählt, wie er später seine MPC von DJ Nicon, dem DJ von Kool Savas, wieder abgekauft hat. Da gab es eher eine Shared Economy, wie man heute so schön sagt. Die hatten kein Geld für CDs und Platten, die haben Wege gefunden, Tapes zu kopieren und möglichst an der GEMA vorbei zu schleusen. Das war ein Konterpart.
HipHop im Jahr 2000. Als das Soho House noch kein Soho House und DJs noch Stars im HipHop waren: DJ Tomekk ft. Curse, GZA, Stieber Twinst, Prodigal Sunn und Curse – Ich lebe für HipHop
Ein Phänomen, das nicht nur die deutsche HipHop-Kultur betrifft, ist der Verlust des DJs. Eine Zeit lang gab es auch hier Star-DJs wie Tomekk, Plattenpapzt, Stylewarz oder Mirko Machine. Für mich ist das ein bisschen der Paradigmenwechsel von HipHop zu Rap. Wie kann so jemand wie der DJ, der so manifest für die Kultur war, derart in der Versenkung verschwinden?
Davide: Meine Theorie dazu lautet: Ende der Neunziger wurde Rap zu Popmusik in Amerika und damit wurde Sampling ein Thema. Rechteinhaber haben genauer hingeschaut: Aha, ihr seid plötzlich Millionäre und nutzt meine Musik dafür. Vielleicht möchte ich auch was davon abhaben. Dann kamen Swizz Beats und die Ruff Ryders. Das Label hat gesagt, mach' Beats, aber bitte ohne Samples. Wir geben nichts ab. Swizz Beats hat daher auf seinem Keyboard alles selber gemacht und damit auch die Ästhetik des Genres verändert. Samples haben keine Rolle mehr gespielt und der DJ seine Rolle als Musikproduzent ein Stück weit verloren. Der Sample-Gedanke, Musikgeschichte zu verstehen, gute Bits in Platten suchen – das ist das, was ein DJ eben macht. Das war dann nicht mehr gefragt. Der DJ als Live-Element auf der Bühne wurde zum Relikt aus einer Zeit, in er noch integraler Bestandteil der Bands war. Der Paradigmenwechsel von Swizz Beats hin zu einem Synthie-Sound im Rap war mit Sicherheit mit dafür verantwortlich, dass der DJ an Bedeutung verloren hat. HipHop wurde Pop und Pop hat eben die Fokussierung auf Performer und Persönlichkeiten – die klassischen Frontmänner. Mick Jagger braucht seine Kollegen, um zu spielen. Im HipHop brauchtest du das nicht mehr. Der DJ war nicht mehr notwendig, um Rap zu produzieren.
Jan: Man muss aber sagen, dass DJs gerade wieder an Bedeutung gewinnen. Ich war neulich bei einem Rin-Konzert in Wiesbaden – der tritt mit einen DJ auf, der sich nicht hinter der Bühne versteckt. Es gab immer wieder diese Momente, wo er als eine Art Hypeman seinen eigenen Slot bekam. Eine spannende Entwicklung, weil man gerade bei jemand Jungem wie Rin davon ausgehen würde, es sei ihm komplett egal. Ihm ist es auch egal, ob die Kids das da unten raffen oder nicht. Ich verstehe das aber auch als noble Geste. Rin hat auf seinem letzten Album Lakmann Props gegeben hat. Der hat damit Geschichtsverständnis demonstriert. Trettmann hat ja auch immer einen DJ dabei. Ob das jetzt der ursprüngliche HipHop-Gedanke ist …
Davide: ... ist es total! Trettmann arbeitet live mit der DJ Josi Miller zusammen, das ist schon ein Verweis auf die Ursprünge. Auf der anderen Seite hast du jemand wie Skepta, der den DJ hinter der Bühne versteckt. Ursprünglich ging es ja hauptsächlich um den DJ und der MC war Beiwerk. In den Neunzigern war das noch gleichberechtigt. Heute sieht das anders aus.
Jan: Selbst ein Bushido hat das immer hochgehalten. Der hat noch immer Scratches in seinen Songs.
Davide: Bushido, ausgerechnet!
Jan: Eben. Man spürt dennoch immer wieder das Bedürfnis zu samplen. Ob das mit Platten passiert oder mit getriggerten Vocals. Als Jay-Z damit gemeinsam mit Cassidy angefangen hat, ist das auch nach Deutschland geschwappt. Dann wurden Adlibs total angesagt, gerade im Cloudrap. Auf dem neuen Song von Tua „Vorstadt“, in der er von seiner Jugend erzählt, lässt er an einer Stelle Afrob zu Wort kommen und am Ende taucht Bausa auf. Auch hier gibt es das Bedürfnis, stringente Linien zu ziehen.
Davide: Die Referenzialität ist da.

„Könnt ihr uns hören?“ ist im Ullstein Verlag erschienen.
Der DJ wurde im Ozean des Kapitalismus aus Gründen der Effizienz also über Bord geworfen. Ich habe mal mit DJ Koze gesprochen. Auch darüber, wieso es kein Fishmob-Revival gibt.
Jan: Weil er keine Lust hat, sich heute auf die Bühne zu stellen und „Fick mein Gehirn“ zu rufen.
So in etwa. Er sprach unter anderem auch davon, dass es heute viel codierter zugeht. Er sah, bei aller Liebe zu HipHop, einen eindeutigen Bruch. In den USA sei die Wertschätzung gegenüber DJ Premier eine andere, meinte er. In eurem Buch kommt ebenfalls vor, dass in der Rap-Szene gerne mal gegen die Älteren getreten wird. Ob das in den USA so wesentlich anders ist, wage ich indes zu bezweifeln.
Davide: Da ist das genauso. Rap hatte ultimativ schon immer mit Verdrängung zu tun. Wenn jemand sagt: „Ich bin der Geilste“ heißt das immer auch: „Du bist schlecht“. Man muss sich den Platz freiräumen. Das war von Anfang an so.
Trotz des oft romantisierten Familien-Vibes?
Davide: Auf jeden Fall. Die Debatte, dass die junge Generation die ältere nicht respektiert, hat man 1982 mit Sicherheit auch schon gehört. Das ist einerseits traurig – Casper und Marteria fragten sich auch, wieso wir unsere Helden nicht mehr ehren. Kein Gitarrist käme auf die Idee, Jimi Hendrix und Muddy Waters als Penner zu beschimpfen. Bei House ist das auch so. Da laufen im Club Tracks aus den Neunzigern, und die Leute verstehen das, finden das gut. Das wäre im Rap unvorstellbar. Wenn du heute vor 17-Jährigen auflegst, spielt keiner Big L. Das passiert einfach nicht. Aber andererseits hat das wiederum dazu geführt, dass Rap derart boomen konnte.
Das Kompetitive, die Battles …
Davide: Der Wunsch, immer etwas Freshes zu machen. Wenn jemand gesagt hätte: Wir machen das so wie LL Cool J und bleiben dabei, dann hätte sich das nach kurzer Zeit erledigt. Dass aber drei Wochen später jemand kam und sagt: LL Cool J ist totaler Dreck – dadurch ist permanent etwas weiter entwickelt worden. Der Verdrängungskampf ist ein wesentlicher Motor für die 30-jährige Existenz des Genres. Die Anmaßung junger Menschen, zu sagen: Alles, was davor war, interessiert mich einen Scheiß. Wir machen das jetzt ganz anders. Die Hinwendung zur Geschichte kommt häufig erst mit der Zeit. Rin hätte seine Lakmann-Props in seiner Anfangszeit bestimmt noch für sich behalten. Ich finde das aber gut, so wie das ist.
Heutige Realität. Kokain dealen als kirmestauglicher Balearen-Sommerhit: Azet & Zuna – Hallo Hallo
Ich fragte mich kürzlich, ob nach rund 30 Jahren erstmalig der Punkt erreicht ist, in dem Gangster-Rap wirklich zum Gangster-Rap geworden ist. Selbst Sido war ja eher noch der druffe Drogenkunde mit PlayStation. Auf der einen Seite begrüße ich es gerade als Gastarbeiterkind, dass es so viele Stars mit Migrationshintergrund gibt, die Kinder mit ähnlichem Background anders abholen können. In eurem Buch wird ja darüber gesprochen, dass es Rapper wie Denyo und Afrob in den Neunzigern viel schwerer hatten als ein Max Herre, der sofort zum Posterboy avancierte. Das Thema der ökonomischen Ermächtigung spielt eine Rolle. Es gibt in der Szene aber auch Verwicklungen mit dem Abou-Chaker-Clan. Und Serien wie 4 Blocks, in denen Rapper wie Massiv und Veysel Gangster in Neukölln mimen und denen Jungs auf der Straße nacheifern. Einerseits erkenne ich Fortschritt, indem Migranten heute eine wichtige Rolle in der deutschsprachigen Popkultur spielen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl eines enormen Backlash. Es fängt mit Frauenbildern an und geht mit der unfassbar eindimensionalen Glorifizierung von Kokain weiter. Wie schätzt ihr die Situation ein?
Davide: Die Nähe zur Kriminalität und Gewalt ist nicht unbedingt neu. Auch in den Jams der Neunziger, nicht nur in Berlin, gab es immer Stress. Der Gangster-Rap von 44 Da Mess hatte 1997 schon eindeutige Bezüge zur Straße.
Jan: Auch die Islamic Force in Berlin. Da gab es früh schon Kontakte zu Gangs.
Davide: David P. hat erzählt, dass es selbst in München Gangs gab. Die Nähe zur Kriminalität gab es also auch dort. Gerade ist das natürlich viel in der Presse. Die sogenannten „arabischen Großfamilien“ haben das nämlich als Geschäftsfeld entdeckt.
Dem ist schon so.
Davide: Klar. Das organisierte Verbrechen funktioniert in Italien genauso. Mafias haben immer geschaut: Womit lässt sich Geld verdienen?
Ich finde das auch gutes Marketing. Gerade italienischen Cloud-Rap fand ich richtig spannend, weil auch so „authentisch“.
Davide: Die italienische Mafia verkauft aber auch Mozzarella, weil der gerade überall auf der Welt gefragt ist. Dass man mit Rap in Deutschland Geld verdienen kann, hat sich ja derweil rumgesprochen. Ein Problem. Aber die Diskussion, die wir führen müssen ist, wie wir zu bestimmten Moralvorstellungen stehen. Das Frauenbild ist ein Thema, die Glorifizierung von Drogen ist ein Thema. Die Gewalt ist ein Thema. Aber auch Antisemitismus.
Jan: Und Verschwörungstheorien. Das hat zwar weniger konkret mit Mafia-Clans zu tun, aber ja.
Wobei die Abou-Chaker-Brüder sogar von ihren Eltern schon „antizionistische“ Namen bekommen haben. Rommel, Nasser, Arafat … Antisemitische Verschwörungstheorien passen da gut ins Bild. Aber ich schweife ab …
Davide: Was ich zunächst begrüße ist, dass Menschen, die sonst eher am Rande stehen und für die die Welt nicht so viel übrig hat, dadurch andere Zugänge bekommen. Sei es, dass man gehört wird oder auch, dass man damit Geld verdient. Das finde ich super. Der Kapitalismus hat sich HipHop komplett einverleibt. Es ist schade, dass es wenig Korrektive und zu wenig Gegenstimmen gibt. Dass nur wenige aufstehen und sagen: Ich finde richtig scheiße, was du da gesagt hast. Auch weil das ihre eigenen Karrieren bedrohen kann. Es wird viel auf die HipHop-Medien gehackt, dass sie alle zu unkritisch seien. Dies trifft auf Künstler und viele andere Akteure der Industrie aber genauso zu. Sobald es um Geld geht, wird gerne mal darüber hinweg gesehen. Als Community müssen wir zu einer Debattenkultur kommen. Das ist mein Problem an der Sache: Die absurdesten Sachen werden einfach durchgewunken, weil es sich keiner mit irgendwem verbauen will.
„Wir müssen davon weg, den Medien oder Künstlern oder einer anderen konkreten Gruppe die Schuld zuzuschieben. Wir sind da alle in der Pflicht, fundamentale Regeln des menschlichen Zusammenseins einzuhalten.“
Jan: Wobei ich schon finde, dass eine Gegenbewegung erkennbar ist. Es gibt viele junge Journalistinnen und Journalisten, die Anfang 20 sind, das Maul aufmachen und ganz klar sagen, wenn jemand über die Stränge schlägt. Das ist begrüßenswert, auch wenn es lange noch nicht genug ist.
Ist das am Ende doch eine journalistische Aufgabe?
Davide: Man muss sich darüber bewusst sein: Medien haben heute nicht mehr den Einfluss, den sie früher hatten. Und HipHop-Medien sind heute genauso Teil der Industrie. In diesen Verflechtungen hängen wir genauso drin. Nehmen wir Spotify, die haben heute riesengroßen Einfluss durch ihre Playlist-Platzierungen. Die entscheiden mit, ob heute etwas erfolgreich ist oder nicht. Spotify versteht sich einerseits als neutrale Plattform, andererseits können sie durch Selektion Karrieren ebnen.
Bei Stephan Szillus, der im Buch auch zu Wort kommt, musste ich daran denken. Er betreut die Rap-Playlisten bei Spotify und ist heute wahrscheinlich einer der mächtigsten Musikleute des Landes.
Davide: Gar keine Frage. Wir als gesamte Community müssen uns fragen, was die Realitäten sind. Können wir innerhalb dieser kulturtechnischen Realität zum Diskurs kommen, Korrektive schaffen und klar machen, dass es Grenzen gibt? Dass das Spiel mit der Provokation, das ja immer gut funktioniert hat und das wir alle mitgemacht haben, ob als Fans oder Medien, sich im Rahmen bewegt und nicht schreckliche Weltbilder durch die Hintertür weiter verbreitet werden.
Ich finde das Prinzip Provokation bei Teenagern total einleuchtend. Ich habe auch im Auto meiner Eltern während der Fahrt zur Kirche Cypress Hill und Bodycount angemacht und mir auf der Rücksitzbank ins Fäustchen gelacht, weil die natürlich nichts gecheckt haben. Tracks wie „LMS“ von Kool Savas müssen gerade in bildungsbürgerlichen, akademischen Haushalten für viel Streit gesorgt haben.
Davide: Das Frauenfeindliche war für Kool Savas genau der Weg, gegen seine bildungsbürgerlichen, linksliberalen Eltern zu rebellieren. Das hat er so selber gesagt. Aber nochmal: Wir müssen davon weg, den Medien oder Künstlern oder einer anderen konkreten Gruppe die Schuld zuzuschieben. Wir sind da alle in der Pflicht, fundamentale Regeln des menschlichen Zusammenseins einzuhalten.
Jan: Menschen, egal ob Journalisten oder Kulturschaffende, müssen ein Bewusstsein dafür schaffen. Eine Zeit lang gab es überhaupt keines. Das ist aber das Wichtigste. Es gibt erste Party-Kollektive wie die Hoe-Mies, die bewusst versuchen, Safespaces zu schaffen für Leute, die sonst auf normale Jams entweder nie reingekommen wären oder sich sonst nicht sicher gefühlt hätten. Das ist wahnsinnig erfolgreich. Man kann nicht sagen, dass das ein paar verpeilte Spinner wären, die verzweifelte Müsli-HipHop-Veranstaltungen machen. Da geht es richtig ab. Ein Schritt in die richtige Richtung.
Davide: Leute wie Salwa Houmsi, Marc Leopoldseder und Marcus Staiger weisen auf so etwas auch im direkten Gespräch hin. Gerade beim Thema Antisemitismus geht es viel um Bewusstsein. Man muss Rappern wie Haftbefehl – den ich verehre und der mit Sicherheit nichts gegen Juden hat – auch sagen können, dass eine Punchline wie „Und ticke Kokain an die Juden an der Börse“ bestehende Narrative verfestigt, egal wie sie gemeint ist.
Kommen wir zum Schluss. Wie fängt der zweite Teil an?
Jan: Gute Frage.
Davide: Bei Teil zwei würde ich gerne die Geschichten einzelner Personen erzählen. Zum Beispiel die von Feinkost Paranoia. Das wäre die logische Konsequenz, da rein zu zoomen und mehr über die Psychologie, Schicksale und individuellen Geschichten zu erfahren.
Jan: Bin ich bei dir. Profan 78 würde bei mir auf der Liste stehen. Jemand hatte ihn mal als „Geist“ bezeichnet, das stimmt irgendwie auch. Jemand, der ein wahnsinniges Talent hatte, sich damit aber selbst im Weg stand. Auch das wird heute immer seltener. Dass es überhaupt Menschen gibt, die so ein Mysterium sind. Wo man gar nicht genau weiß, was ist denn jetzt mit dem? Warum schaffen die das nicht? Aus der heutigen Generation finde ich Edgar Wasser total interessant. Ich kenne seine Musik, aber nichts über den Menschen dahinter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Am Ende ist das aber immer die Frage, die mich interessiert. Aber dieser Blick auf die Details würde mich auf jeden Fall reizen.
Und ich schreibe den Text über Kinderzimmer Productions?
Davide: Ja, unbedingt.
Ihr seid demnächst auf Tour!
Jan: Ja, und darauf freuen wir uns. Es wird keine reine Lesung. Wir erzählen über unsere eigene HipHop-Sozialisation und in jeder Stadt wird es Gäste geben. Im Idealfall jemand vom Anfang und jemand von heute. So wird es auch Gespräche mit Protagonisten auf der Bühne geben, um noch mal in die Tiefe zu gehen und nachzuhaken. In Frankfurt sind Celo & Abdi mit dabei, in Hamburg Fettes Brot, in München David P., Schowi kommt in Stuttgart dazu, Trettmann ist in Leipzig dabei und es kommen noch einige Special Guests, deren Namen wir noch nicht verraten können.
Jan Wehn würde gerne dem Phänomen Edgar Wasser auf den Grund gehen. In diesem Song mit Fatoni beschreibt Wasser nur zu gut die Sachlage im HipHop. Auch hier könnte man von Hassliebe sprechen.