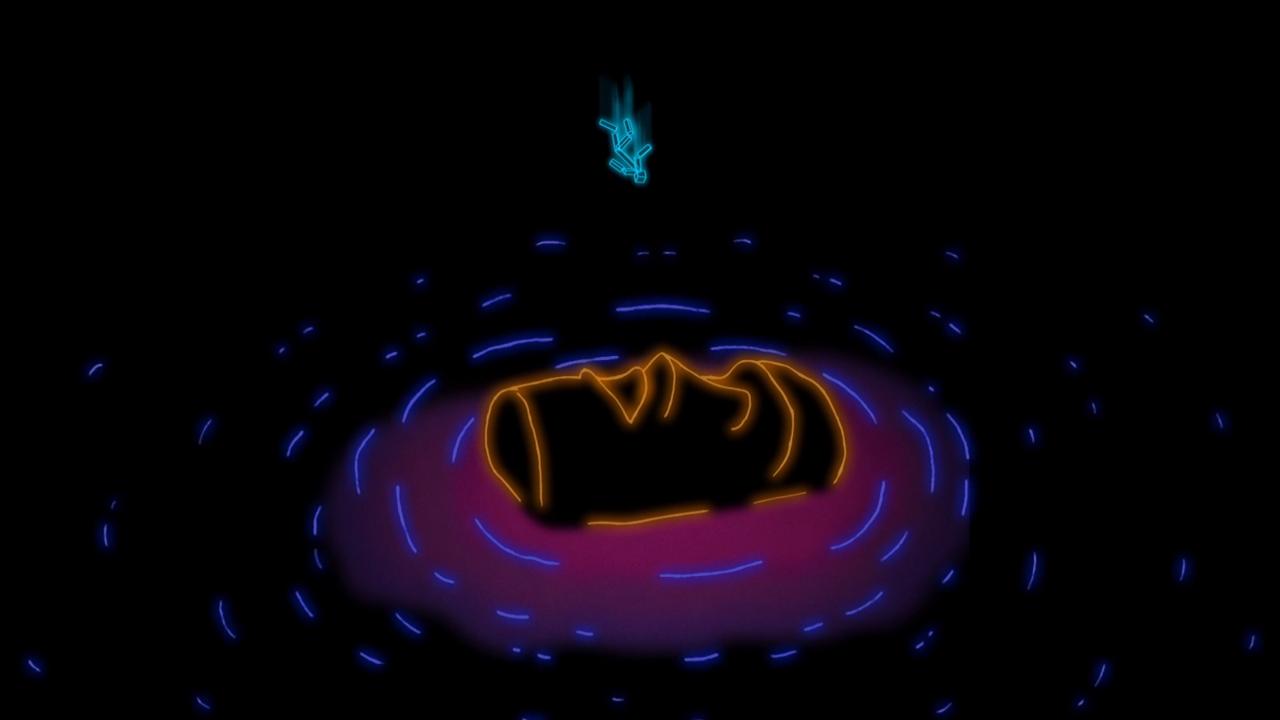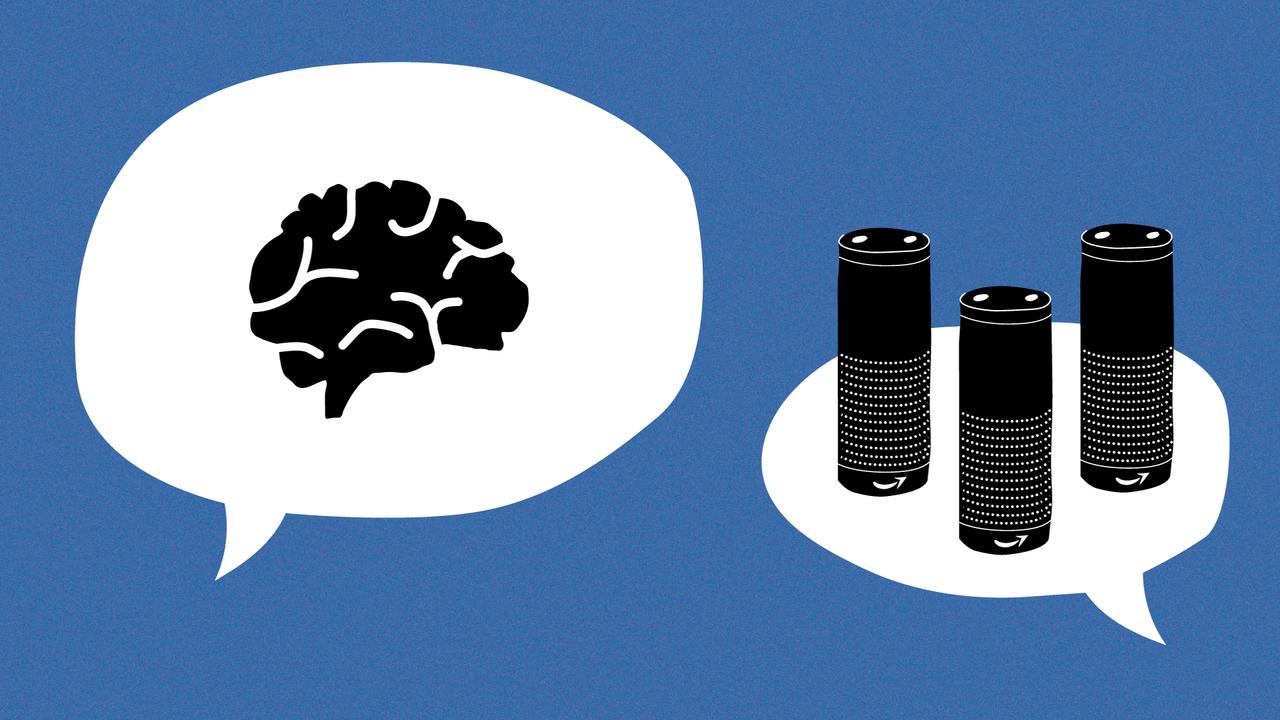Good Bye, Berlin!George FitzGerald über „All That Must Be“, Familienglück und die Rückkehr nach London
9.4.2018 • Sounds – Text & Interview: Benedikt Bentler
Photos: Rhodri Davies
Mit „All That Must Be“ hat George FitzGerald den sanft rollierenden und trotz der melancholischen Popnote tanzbaren House-Sound seines 2015 erschienenen Debütalbums „Fading Love“ konsequent weitergeführt. Nahtlos der Anschluss, bisweilen gar zum Verwechseln ähnlich und mit Domino Records auch dem Label treu geblieben. Der Sound wird zur Konstante, während abseits dessen alles ungeahnt ganz anders ist, als noch vor drei Jahren. Wie das Leben so spielt, plötzlich sind da Kind und Kegel – und die Wahlheimat Berlin ist vorerst auch Vergangenheit. Wie kommt’s?
Als ich George FitzGerald 2015 traf, um mit ihm über das Debütalbum „Fading Love“ zu sprechen, war die erste Frage: „Wo ist er hin, der Garage-liebende Typ aus London?“ Der sei durchaus noch da, so die Antwort. Er stecke in der Unperfektion von Aufnahmen, in Vocals, die mehr nach unter-der-Dusche klängen, als nach perfektem Studio-Setting. Und doch: Von den einstigen Releases auf Hotflush, Aus und Hypercolour war „Fading Love“ bereits ziemlich weit entfernt. Nicht nur aufgrund von fehlenden Breakbeats und Garage-Patterns, sondern auch weil FitzGerald erstmalig das Mikrofon in die Hand nahm, Texte schrieb, eine Geschichte zu erzählen hatte. Die Geschichte einer zerbrochenen Beziehung, der Sehnsucht und überhaupt: Liebe – aber nicht unbedingt die glückliche. Kitschig? Sicher.
Darüber hinaus aber zutiefst persönlich und ehrlich. „Das ganze Album ist sehr autobiografisch, auch wenn es keine Geschichte im engeren Sinne erzählt. […] Die LP behandelt das Thema Liebe keineswegs auf einer abstrakten oder entfernten Ebene. Es ist persönlicher als alles, was ich bisher geschrieben habe,“ sagte er damals. George FitzGerald lebte zu diesem Zeitpunkt in Berlin und daran sollte sich eigentlich wenig ändern. In Berlin fühle er sich mehr zu Hause, als in London, so der O-Ton.
„All That Must Be“ ist definitiv ein Album für Menschen, die auch „Fading Love“ schon mochten.“
Drei Jahre und ein Album später: George FitzGerald lebt in London, ist glücklicher Vater zweier Kinder und in festen Händen. Das hat er selbst nicht kommen sehen: „Ich hatte keine Ahnung, dass das so passieren würde. Anfangs, als meine Tochter noch ganz klein war, bin ich immer gependelt zwischen Berlin und London. Aber das war nicht, was ich wollte. Es wurde immer wichtiger für mich in London zu sein, also bin ich zurückgegangen.“ Endgültig? „Ich habe immer noch meine Wohnung in Berlin und vielleicht ziehen wir auch zusammen zurück. Ich weiß es nicht. Gerade bin ich auf jeden Fall ganz happy hier. Ich liebe die Stadt, musikalisch ist es sehr inspirierend. Solange der Brexit nicht alles völlig durcheinander bringt, werde ich wohl hier in London bleiben.“

Die Hektik Londons hat er wieder lieben gelernt, genau wie den breiten musikalischen Horizont, der dieser Stadt innewohnt. Allem Clubsterben zum Trotz ist die Vielfalt der Musikszene größer, als in der deutschen Hauptstadt. Ort seines kreativen Schaffens ist ein kleines, fensterloses Studio auf einem Industriegelände, unweit seiner Wohnung in Süd-Ost-London, der Big River um die Ecke. So hat er auch hier sein „peaceful little corner“, wie er selbst sagt.
Wer nun allerdings glaubt, die totale Umkehr der Lebensumstände spiegelt sich musikalisch auf „All That Must Be“ wieder, irrt gewaltig. Nahtlos schließt der Sound der neuen Platte dort an, wo „Fading Love“ endete. Teilweise glaubt man sogar, jenen Akkordwechsel auf ebenjenem Synthesizer längst zu kennen. Und der Künstler selbst kann das durchaus nachvollziehen: „Das Framework von „Fading Love“ liegt auch hier zugrunde, wurde aber um neue Spuren ergänzt. Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen komplexer und reicher an Texturen als vorher. Mit „Fading Love“ habe ich eine Form gefunden, mit der ich mich in Musik ausdrücken kann und auch wohlfühle. Vorher habe ich viel ausprobiert, unterschiedliche Identitäten getestet. Das hat sich völlig verändert. Jetzt versuche ich Vorheriges weiterzuführen und weiterzuentwickeln. „All That Must Be“ ist definitiv ein Album für Menschen, die auch „Fading Love“ schon mochten.
Nur der textlichen Konkretisierung entzieht sich die neue Platte gegenüber der alten – die Geschichte fehlt, obwohl es doch so viel zu erzählen gäbe. Zwar spielen Vocals nach wie vor eine große Rolle, diesmal aber gesamplet, abstrahiert, zerstückelt und bearbeitet – auch wenn es Ausnahmen gibt. „Diese Verfremdung macht neugierig, bringt etwas Mysteriöses rein. Es hat sicher auch mit dem Gefühl von Orientierungslosigkeit zu tun, das du anfänglich immer hast, wenn du woanders hinziehst oder dich generell in neue Situationen deines Lebens begibst. Musiker wie Squarepusher, Burial oder Aphex Twin haben gezeigt, dass Stimme so viel mehr sein kann als bloß Lyrics. Diese Denke gefällt mir, und darin besteht auch definitiv ein großer Unterschied gegenüber der letzten Platte, für die ich kaum Samples genutzt habe. Hier hingegen einen ganzen Haufen.“ Ausgerechnet „Roll Back“ (feat. Lil Silva), der melancholischste Track der Platte, wird explizit.
Es scheint als wäre es für FitzGerald einfacher, die düstere Seite seiner Emotionen in Worte zu fassen, als das junge Londoner Familienglück.
Zweite Ausnahme ist „Half-Light“ ein Feature mit Tracey Thorn, an deren ikonischer Stimme sich FitzGerald – ein Glück – ebenfalls nicht mit Effekten und Sampler vergriffen hat. Neben Tracey Thorn und Lil Silva war auch Bonobo im Studio zu Gast und ausgerechnet er bringt zurück, was der Musik von George FitzGerald im Laufe der Jahre verloren gegangen ist: Garage-Vibe. „Mit Bonobo Musik zu machen, hat mich wieder zurück zu dem Sound geführt, den ich anfangs gemacht habe, als ich noch in London gelebt habe. Das fühlte sich verdammt gut an.“ Kein Grund also, die Hoffnung auf die Rückkehr von Breakbeats aus dem Hause FitzGerald aufzugeben.
Nach Jahren des einsamen Reisens als DJ bringt George FitzGerald seine Musik mit „All That Must Be“ erstmalig und mit Band auf die Bühne. Mit dem Bedürfnis aus dem DJ im Hintergrund zum Mittelpunkt eines Abends zu werden, hat das allerdings nichts zu tun: „Die Leute wollten mehr und mehr, dass ich auch eigene Tracks in meinen DJ-Sets spiele, aber das war für mich schwierig. Es macht einfach viel weniger Spaß, seine eigenen Tracks aufzulegen, statt sie live zu performen. Der Live-Act ist also auch eine Art eine Reaktion auf den Wunsch, die Musik live erleben zu können. Für Menschen, die das Album zu Hause hören, die nicht ins Berghain gehen, dafür aber an einem Dienstagabend zum Konzert. Es geht natürlich auch darum, neue Dinge auszuprobieren, neue Erfahrungen zu machen.“

Dass die Live-Erfahrung neu ist, merkte man der Show im Berliner SchwuZ dann auch an. Nicht etwa aufgrund musikalischer, handwerklicher oder soundtechnischer Mängel, ganz im Gegenteil. Rechts und links die Bandkollegen an Synthesizern und Drums, vorne auf der Bühne die Sängerin. Mittig dahinter George FitzGerald. Schaut ruhig auf die Controller, wippt mit dem Kopf, nippt am Bier – alles unter Kontrolle. Und plötzlich wirkt er genau wie damals, wie der schüchtern und so sympathisch dreinblickende House-DJ hinterm improvisierten Pult der Kreuzberger Loftus Hall – gänzlich jenseits jeden Geltungsdrangs, während die Menschen tanzen. Manches ändert sich eben doch nie. Eine in diesem Fall sehr schöne Erkenntnis.