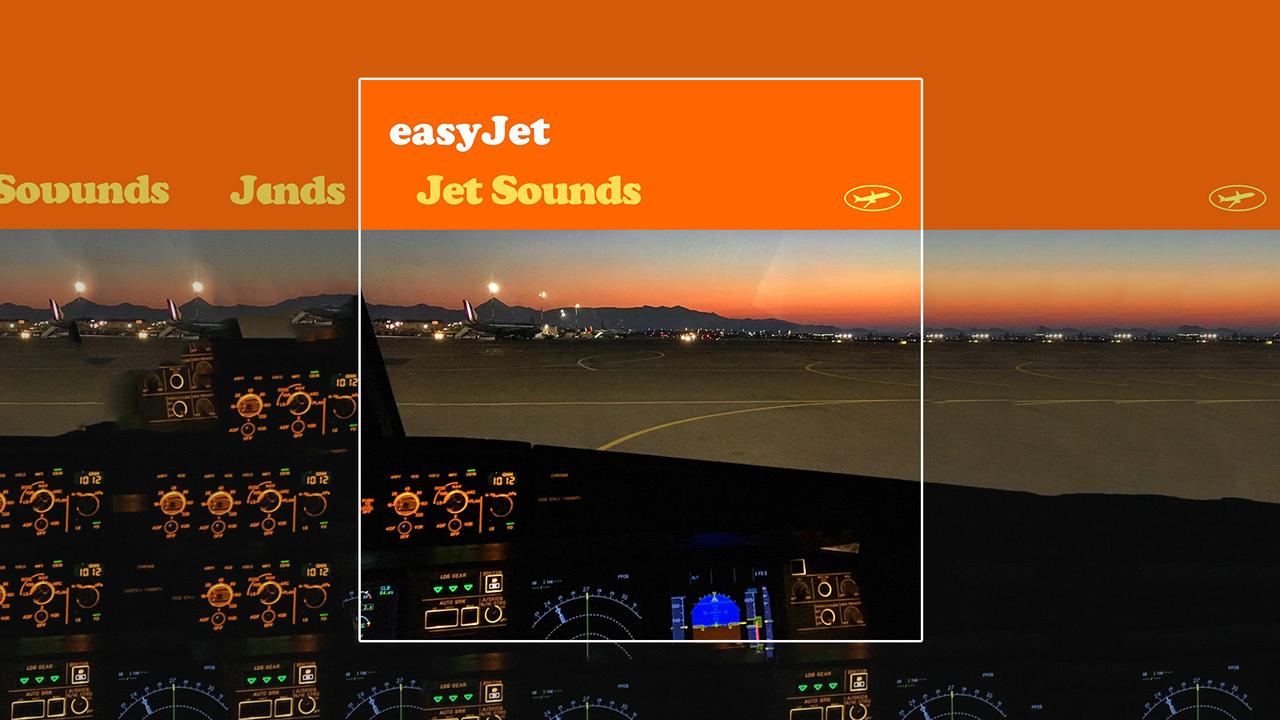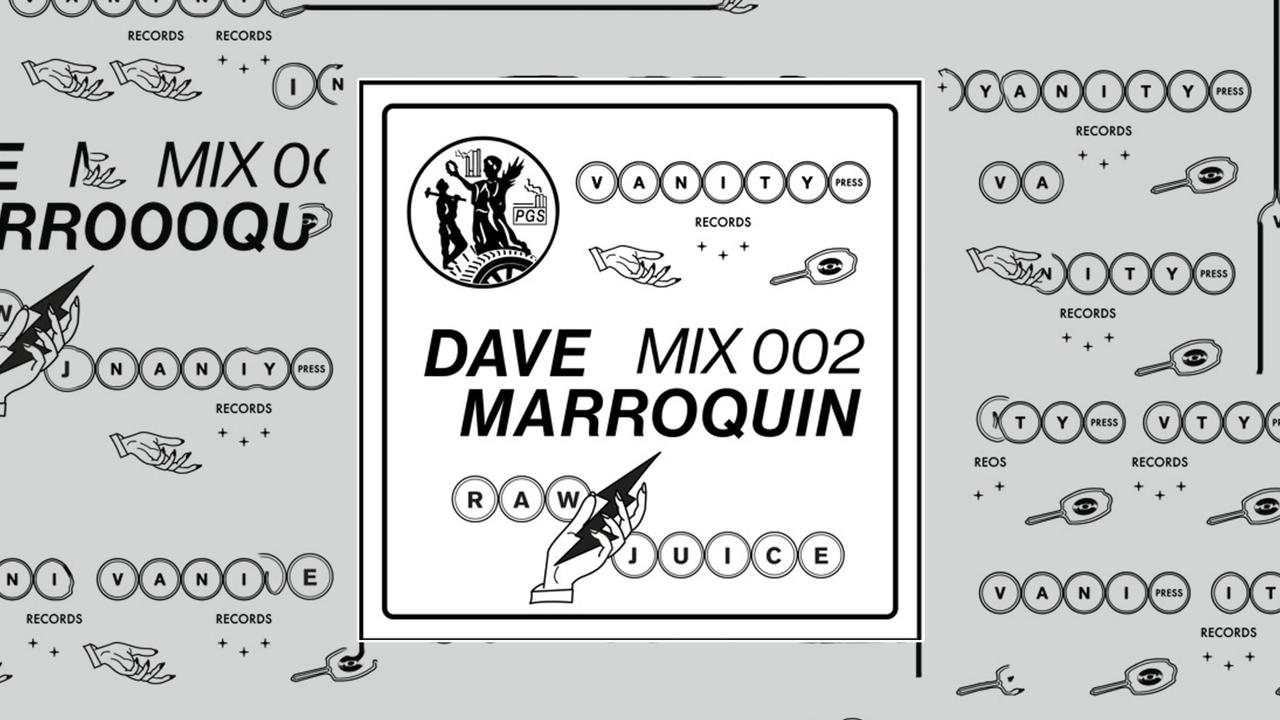Filter Tapes 026„All Nippon Airwaves“ von Vanessa Mitchell
17.8.2017 • Sounds – Interview & Fotos: Benedikt Bentler, Illustration: Susann Massute
Über ein Jahrzehnt hat Vanessa Mitchell in Japan gelebt, bevor sie nach Berlin gekommen ist. In Tokyo hat sie als Musikjournalistin gearbeitet, das Nachtleben um endlose DJ-Sets bereichert und als Teil eines Kollektivs eigene Partys veranstaltet. Das Thema für ihr Filter Tape lag auf der Hand: Japan. Herausgekommen ist ein Mix, der Beat samt Matching verweigert, und sich der japanischen, elektronischen Musik von einer experimentellen Seite nähert, auf sanfte und bezaubernde Weise. An den Decks steht Vanessa Mitchell nur noch selten. Die Freizeit neben dem Job wird lieber den Synthesizern im Heimstudio gewidmet, getreu dem Motto: Output irrelevant. Während des Gesprächs über das Tape, über Japan, Berlin und das Musikleben, fallen wir immer wieder in Schweigen, ganz ohne das Bedürfnis, jene angenehme Stille zu füllen, die nur der Begegnung mit leisen Menschen vorbehalten ist.
Woher kommst du eigentlich, Vanessa?
Ich bin in Neuseeland geboren. Mit sieben bin ich dann nach Australien gezogen, dort aufgewachsen und schließlich nach Japan gezogen. Ich habe immer noch einen neuseeländischen Reisepass. Und einen britischen, wegen meiner Eltern. Aber ich habe nicht in keinem der beiden Länder wirklich Zeit verbracht. Die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten (lacht).
Warum Japan?
Eigentlich wollte ich immer nach Berlin. Aber damals wäre es für mich schwer geworden, einen Job in Berlin zu finden, glaube ich. In Japan ist es weniger ein Problem, ein Visum oder einen Job zu bekommen, wenn du von der Universität kommst und Englisch deine Muttersprache ist. Ich dachte, Japan würde nur Zwischenstopp auf dem Weg nach Berlin. Aber ich hab mich in das Land verliebt und bin erstmal geblieben. Es gab aber noch weitere Gründe. Ich liebe Musik und damals hatte Shibuya [Bezirk in Tokyo, Anm. d. Red.] mehr Plattenläden pro Quadratmeter als jede andere Stadt der Welt. Technics-Plattenspieler kommen aus Japan. Korg kommt aus Japan. Roland-Synthesizer ebenfalls. Großartige Musiktechnik kommt von dort und ist dementsprechend ziemlich günstig. Du kommst so viel leichter mit elektronischer Musik in Berührung, als zum Beispiel in Australien. Du kriegst alles was du willst. Ich hatte einen guten Freund aus Japan. Der war DJ und hat mir wirklich die Augen geöffnet, mir gezeigt, dass die Menschen in Japan sich wirklich gut mit elektronischer Musik auskennen. Es gibt nicht nur Berlin, auch wenn viele Menschen diese Stadt für das Zentrum der elektronischen Musikuniversums halten. Andere Städte sind auch großartig.

Wie unterscheidet sich das Leben dort vom hiesigen, so ganz generell?
Es ist nicht so entspannt wie hier. Dein Terminplan ist voller, meist weißt du schon einen Monat vorher, was du an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit in deiner Freizeit tun wirst. Die Leute fragen dich nicht: „Was machst du am Freitag?“ Sie fragen: „Was machst du am 26.?“ Und du weißt tatsächlich, was du in drei Wochen, am 26., tun wirst. Du verdienst ganz gut und hast vielleicht ein bisschen mehr Geld zum Ausgeben. Du kannst also viel Shoppen (lacht). In Berlin tue ich das nicht. Viele Leute in Japan würden dir sagen, dass ihr Hobby Shopping sei. In dieser Hinsicht drehen sie dann auch durch – haben gleich zwanzig Paar Sneaker oder so.
Alle in einer Farbe.
Exakt (lacht). Es ist alles sehr konsumorientiert. Aber ich habe es geliebt. Es gab während meiner Zeit dort auch viele, tolle Clubs. Einige sind mittlerweile wohl geschlossen und die Auswahl ist kleiner geworden. Aber Ausgehen ist ähnlich, auch wenn man eher losgeht, eher heimkommt, was das Feiern irgendwie gesünder macht (lacht).
Wie bist du den Mix angegangen?
Du hattest mir ja das Konzept mit auf den Weg gegeben, einen Mix zum Thema Japan zu machen. Dann hab ich mich dazu entschieden, wirklich nur japanische Künstler mit reinzunehmen. Man hätte ja auch japanische Samples oder so nehmen können. Aber ich dachte: Nee, das ist eine tolle Möglichkeit, mal wirklich zu filtern. Und wenn ich an japanische Musik denke, dann vor allem an experimentelle Musik. Wenn ich im Club spiele, denke ich darüber nach, wie die Tracks zusammenpassen, miteinander funktionieren, das Set insgesamt. Hier war das etwas komplett anderes. Ich hab mir einfach 15 Tracks gesucht, die ich wirklich mag – ganz egal, um was für Musik es sich handelt. Dann habe ich versucht, die irgendwie zusammenzubringen. Deshalb ist der Mix nun eine recht eklektische Mischung geworden.
##Tracklist
- Pizzicato 5 - Porno 3003
- DJ Mitsu the Beats - M.O.O.D for Otis
- So Inagawa - Kashin
- Towa Tei - Channel Galaxy
- Kyoka - Ybe Ybe
- Nobukazu Takemura - Conical Flask
- Iori - Purple
- Ken Ishii - Endless Season
- Koss Aka Kuniyuki - N.o.w.
- Susumu Yokota - Gekkoh
- Aoki Takamasa, Tujiko Noriko - 26th Floor
- Kuniyuki Takahashi - After Creation
- Ryuichi Sakamoto - Bathroom
- Kyoto Jazz Massive - M.E. Outroduction
Wie würdest du elektronische, japanische Musik beschreiben? Kannst du das irgendwie einrahmen?
Ich würde sagen, sie klingt quirky.
Was ist quirky?
Ich kann das Wort nicht richtig umschreiben. Es klingt jedenfalls nicht wie elektronische Musik von irgendwo anders, vielmehr einzigartig, das geht schon bei den Samples los. Japanische Musik ist auch nicht sehr beeinflusst von anderen Szenen. Wenn du aus Japan kommst, ist quirky vielleicht auch nicht die richtige Beschreibung. Aber für einen Ausländer, der in Japan lebt – da fällt mir wirklich kein besseres Wort ein. Google sagt zu quirky: „having or characterized by peculiar or unexpected traits or aspects“ . Aber „perculiar“ ist negativ konnotiert, ich sehe das aber nicht im Geringsten negativ. Ich finde es aufregend, Musik zu hören, die anders und unerwartet klingt. Du weißt, nie was als nächstes kommt, alles ist ein Mysterium.
Wenn ich an elektronische, japanische Musik denke – und dieser Mix bestätigt das in meinen Augen –, dann denke ich an Tracks, die keine richtige Dramaturgie haben. Für mich sind das eingefrorene Momente – eingefroren für fünf Minuten. Man hört sie, wie man ein Foto betrachtet. Ich würde sie als lieblich, gleichzeitig aber kühl und auf gewisse Weise distanziert bezeichnen.
Das könnte man vielleicht, ganz vorsichtig gesagt, auch über den typischen japanischen Charakter sagen. Die Menschen sind nett und lieb und freundlich. Aber sie schauen dir nicht in die Augen. Das schafft oft – nicht immer – eine Barriere. Aber das mag auch an Tokyo liegen. Wo so viele Menschen auf so engem Raum leben, braucht es die persönliche Distanz, denn sie ist überhaupt nur auf dieser Ebene möglich. Aber ich weiß was du meinst, besonders wenn ich an den Track von Nobukazu Takemura denke. Der war vielleicht eine etwas merkwürdige Wahl, denn es gibt andere Tracks von ihm, die ich sehr viel lieber mag. Nur hab ich die nicht auf Platte.
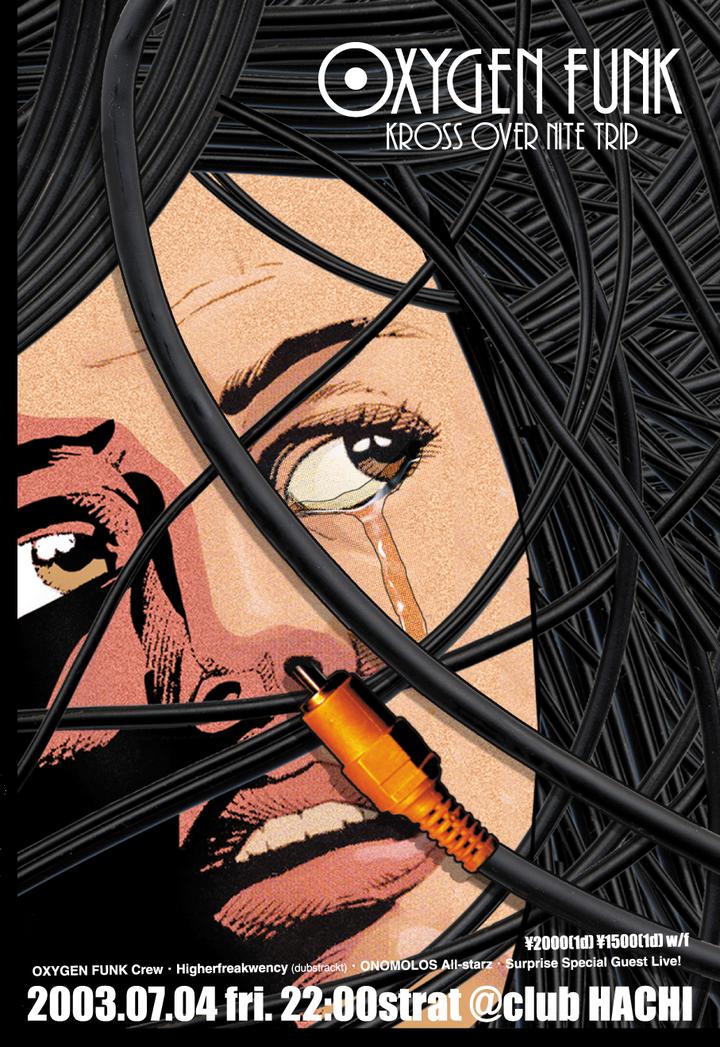
Flyerkunst aus Japan, 2003. „Oxygen Funk“ hieß die Partyreihe, die Vanessa Mitchell über zehn Jahre lang mitveranstaltet hat.
Das war tatsächlich genau das Stück, zu dem ich diese Gedanken bezüglich Lieblichkeit und Distanz notiert habe. Für mich einer der faszinierendsten Tracks.
Er startet sehr schön, wird aber sehr grindy, dirty, repetitiv und scheint schließlich gar nicht enden zu wollen. Mit zehn Minuten ist er ganz schön lang. Ich glaube, wer elektronische Musik wirklich mag, kann diesem Track viel abgewinnen. Für viele andere ist er wahrscheinlich nur total langweilig.
Es gibt übrigens nur einen Artist im Mix, den ich wirklich kenne. Ken Ishii, wen sonst?
Ich musste ihn mit reinnehmen (lacht). Er ist für viele die erste Assoziation, wenn es um elektronische Musik aus Japan geht.
Ich mag seine Musik. Da ist immer ein gewisses Level der Abstraktion, trotzdem bleiben die Stücke in der Regel sehr easy-listening – und eignen sich oft auch gut zum Tanzen.
Der Track ist aus den 90ern, vom ersten Album.
Vom Album mit dem Cover?
Ja, das bekannte – mit dem Cover. Jeder verbindet Ken Ishii ja mit Techno. Aber er hat auch eine andere spannende Seite.
Es gibt einen Artist, dem du zwei Tracks gegeben hast, Kuniyuki Takahashi.
Stimmt, aber die Tracks kommen aus unterschiedlichen Projekten. Den einen hat er als Koss produziert, ein wunderschöner Ambient-Track, der direkt die Gefühle anspricht. Wie der Subbass da reinkommt. Der andere hat dort am Ende einfach sehr gut reingepasst.
Am Ende gibt es diesen Track mit gesprochenen Lyrics. Worum geht’s da?
Das ist „26th Floor“. Es geht darum, dass zwei Menschen in den 26. Stock müssen, es aber keinen Aufzug gibt. Sie gehen also zu Fuß und machen unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Stockwerken. In einem Stockwerk riechen sie Curry, jemand kocht. In einer anderen Etage steht Müll herum. Es ist nicht mehr als Gequatsche. Dann sprechen sie über das Weinen, während sie Eis essen – sehr süß. Ihre Art und Weise miteinander zu reden ist ziemlich amüsant und besonders. Die Worte im Intro von Pizzicato 5 sind auch interessant. Da heißt es im Prinzip: Entspann dich, atme ganz tief ein. Stell dir vor, du sitzt auf dem großen, runden, weißen Sofa in einer Raumstation (lacht).
Es gibt da diesen Track von Kyoka, den ich auch sehr mag. Ich hab sie mal getroffen, hier in der Stadt. Ich war auf dem Weg zu einem See nördlich von Berlin, um Freunde zu treffen. Am Ende musste ich dann noch ein ganzes Stück laufen, und da waren diese japanischen Mädels mit ihren Camping-Sachen. Die sahen überladen und dementsprechend fertig aus. Ich hab sie auf Japanisch angequatscht und trug eine Tasche mit Ableton-Aufdruck, so kamen wir auf das Thema Musik. Und dann stellte sich heraus, das eine von ihnen Kyoka (lacht) ist. Ich liebe ihre Musik, was für ein Zufall.

Vermisst du Japan?
Ja, schon. Vor zwei Jahren war ich mal wieder da. Ich konnte im Club Air spielen, ein sehr netter Laden. Viele meiner Freunde waren da und sie waren so enthusiastisch, so leidenschaftlich im Bezug auf Ausgehen, Freunde treffen, Wiedersehen, wie man es in Berlin nie erleben würde. Das Essen ist toll, die Menschen sind freundlich. Ich bin in einen Music Store gegangen und wollte dort einen Synthesizer ausprobieren. Mir wurde sofort ein Stuhl gebracht, der Verkäufer sagte: „Los, setz dich hin, leg los, hier hast du Kopfhörer.“ Natürlich sind die Leute in Berlin auch ziemlich nett. Aber dort hast du das Gefühl, wirklich willkommen zu sein.
Hast du schon eigene Musik veröffentlicht?
Nein.
Warum nicht?
Ich produziere für mich selbst und habe nicht das Gefühl, irgendwas veröffentlichen zu müssen. Viele Leute denken, wenn du DJ bist, müsstest du auch Musik releasen. Aber für mich ist der Lernprozess, der technische Teil viel interessanter. Cool, wenn einer die Geduld hat, dort zu sitzen und Tracks fertigzustellen. Aber ich will lieber den Prozess kennenlernen, Dinge ausprobieren. Ich war eine Zeit lang blockiert, fühlte mich gar nicht danach, Musik zu machen. Ich denke, das lag daran, dass ich mir selbst zu viel Druck gemacht habe, mal etwas fertigzustellen. Jetzt habe ich angefangen, jeden Tag einen neuen Track zu machen. Mit diesem doch eher harten Ansatz ist der Spaß an meinen Synthesizern zurückgekommen.
Als ich noch als Journalistin gearbeitet und viel geschrieben habe, war das wirklich meine Passion. Den eigenen Artikel abgedruckt vor sich zu haben, hat mir das Gefühl gegeben, etwas erreicht zu haben. Bei Musikern ist das mit der eigenen Platte wahrscheinlich ähnlich. In Japan gibt es viele DJs, die keine Künstler sind. Dort schätzt man vor allem die technischen Skills und das Können als DJ. Auflegen und Produzieren werden dort als grundverschiedene Dinge verstanden. Oft genug sind Produzenten ja gar nicht die größten DJs.
Legst du unter deinem richtigen Namen auf?
Hier in Berlin ja. Früher hatte ich auch ein Alias, habe im Kollektiv gespielt. In Japan haben wir als Kollektiv einmal im Monat eine Party veranstaltet. Der Club war in Tokyo, der Wilden Renate hier in Berlin sehr ähnlich. Und wir haben als Lineup immer nur hingeschrieben: The Crew. Zehn Jahre lang haben wir das gemacht. Und damit längst erreicht, was wir uns je vorgenommen hatten.