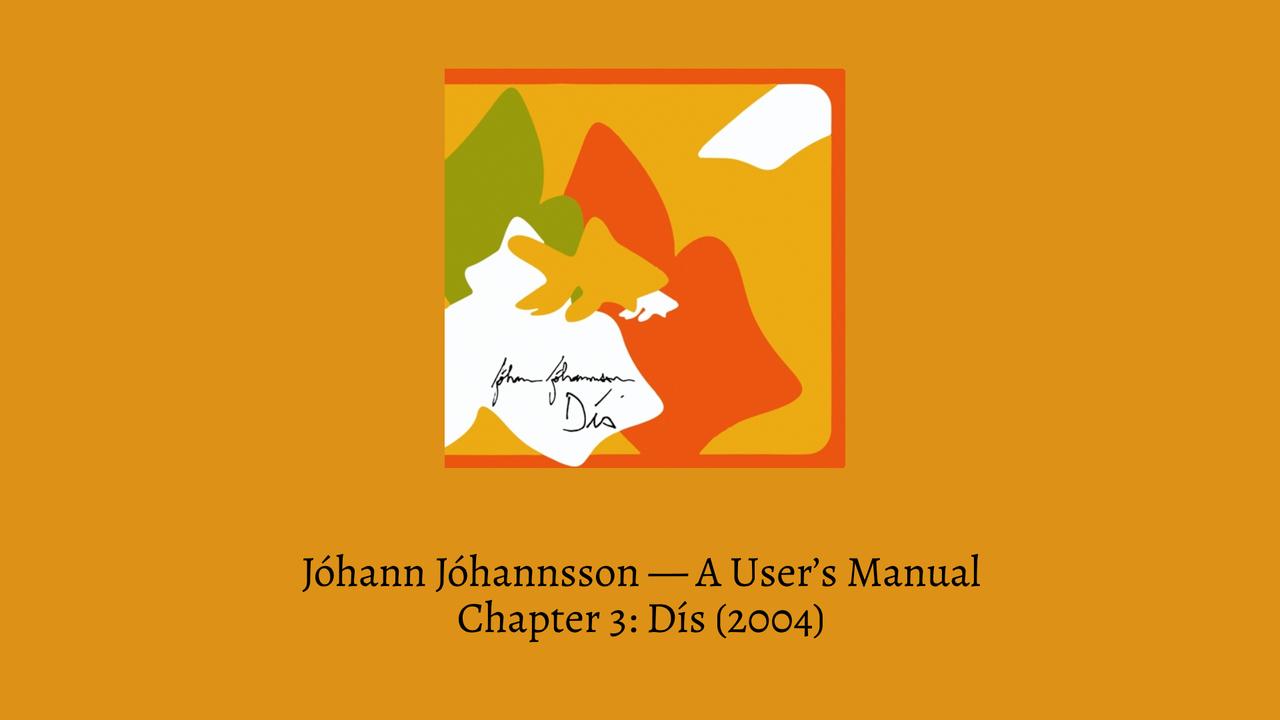Exzess ohne NebenwirkungenWarum Nils Frahms neues altes Album wichtig ist
21.4.2021 • Sounds – Kommentar: Matti Hummelsiep
Für Nils Frahm bedeutet die Pandemie eine Zäsur seiner Karriere: Seit über zehn Jahren begeistert er weltweit Menschen – auf seine ganz eigene Art. Zeit für einen Rückblick also. Genauer gesagt auf die Zeit, in der alles anfing. Denn sein aktuelles Werk „Graz“ besteht aus reinen Klavierstücken, die er schon 2009 aufnahm und die dann in der Versenkung verschwanden. Auf den Markt kam das Album am 29. März 2021, am Piano Day, den er 2015 selbst ins Leben gerufen hat. Eine Plattform, auf der Klavierfans und Pianist*innen zusammenfinden – und es werden immer mehr. Allein dieses Jahr fanden weltweit knapp 60 Konzerte per Livestream statt, von Erlangen über Hokuto bis New York. In Berlin übrigens nicht, obwohl Frahm Berlin mit ihrem Mythos als ewiger Hauptstadt des Technos mehr als gut tut.
Eine Sache irritiert erstmal: Überraschend hat Nils Frahm ein neues Album veröffentlicht – ganz ohne Werbetrommel. Dabei waberten gerade erst unzählige Ankündigungen, Interviews und Posts zu seiner aufwendig produzierten Konzertdokumentation „Tripping with Nils Frahm“ samt Live-Album durch Hörfunk und Online-Medien. Zeitlich gesehen kommt „Graz“ also komisch früh. Sei’s drum.
Es ist Pandemie, also eigentlich die beste Zeit, um einen Blick zurück zu werfen. Das dachte sich wohl auch Frahm. „Graz“ entstand bereits 2009 und bildet seinen musikalischen Status vor der steilen Erfolgskurve ab. Ein damals Mitte 20-Jähriger, mit dem einen oder anderen Zweifel belegt, ob das denn überhaupt was werden könne mit der Musik auf der Bühne.
Das Album selbst besteht eher aus Skizzen und Momenten: Mal zeichnen sie ein düsteres Bild – eine erdrückende, depressive aber anmutige Leere, bis Bewegung reinkommt, ohne auf der Suche nach etwas bestimmtem zu sein. Mal keimt Hoffnung auf, so etwas wie Aufbruch. Man muss schlicht ein verdammt guter Pianist sein, um sich und andere so in emotionale Gefilde gleiten zu lassen: „Ich höre darin eine deutlich jüngere Version von mir selbst, und viele der musikalischen Ausdrucksformen von damals könnte ich heute unmöglich nachmachen“, kommentiert er sein Album, das er im Rahmen einer Abschlussarbeit an der Kunstuniversität Graz aufgenommen hat. Sofort fällt der Blick aufs Tracklisting. „Went Missing“ und „Hammers“ sind mit dabei. Tracks, die es bis in aktuelle Gigs geschafft haben.

Foto: Sebastian Rieck
Frahm hat es geschafft, elektronischer Musik allgemein durch sein intuitives, jazziges, rauschhaftes und immer wieder so zerbrechlich intimes Spiel eine noch nie so gedachte Sentimentalität zu geben.
Und warum wurde es damals nicht veröffentlicht? Im Grunde war es zu klavierig. Das Konzept war nämlich ein anderes: Der Sound sollte experimenteller sein. Eindringlich, aber elektronischer, so wie er sich dann 2011 auf seinem Debüt „Felt“ niederschlug. Mit „Spaces“ gelang ihm 2013 der weltweite Erfolg – die Venues, in denen er spielte, wurden immer größer. Frahm hat es geschafft, elektronischer Musik allgemein durch sein intuitives, jazziges, rauschhaftes und immer wieder so zerbrechlich intimes Spiel eine noch nie so gedachte Sentimentalität zu geben. Und andersherum dem emotionalen, aber Sound-mäßig begrenztem Spektrum des klassischen Instruments durch die mal verzerrte, mal brachiale Elektronik neue Türen zu öffnen. Eine einmalige Mischung, manchmal eine Art Ping Pong, wenn er seinen analogen Fuhrpark auf das Klavier loslässt, und umgekehrt.
Damit trifft er einen Nerv, zieht Menschen in seine manchmal schon meditativ anmutende Klangwelt. Die Situation bei seinen Konzerten bestätigen das. Techno-Kids sitzen neben älteren Herrschaften oder Müttern mit Kindern. Messen lässt sich der Erfolg an Klickraten, aber auch an den Kommentaren der Fans. 2005 wurde Frahm bei den BBC-Proms in der ausverkauften Royal Albert Hall als einer der Pioniere in Sachen neuer Musik angekündigt – live im Radio. Solche Bemühungen, neue Strömungen, Talente oder gar ganze Genres abzubilden, sucht man hierzulande beim deutschen Pendant des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vergebens. Die Rede ist bei uns allenfalls vom „heimlichen Weltstar“ (Focus). Dann noch kurz die Mär der so genannten Neoklassik als geeignete Schublade erzählt, die sich offensichtlich schlecht informierte Journalist*innen ausgedacht haben. Fertig! Am Ende lässt sich festhalten: Irgendwie scheinen wir hierzulande die interessanten musikalischen Entwicklungen zu verpennen. Die Musik spielt im Ausland. Von der Anerkennung mal ganz abgesehen. Es wäre schön, könnte man sich Musik aller Art, außer Schlager, nicht nur auf Arte und bei Red Bull anschauen bzw. anhören.
Nils Frahm tut auch Berlin gut, weil er als Pate für eine bewusstseinserweiternde, aber exzessfreie Strömung steht – so gar nicht Berlin. Sie stellt sich nicht gegen, aber neben das „So lange wie möglich und das jede Woche“-Modell, für das Berlin ja eigentlich steht. Ausgang stets ungewiss. Nils Frahm ist Spiegelbild einer neuen, melancholischen Art des Musikrausches, auf fast schon demütige Art der Kunst gegenüber wo völlig verschiedene Genres zusammenkommen. Zwar immer noch technoides Erleben, aber eins, bei dem sich verblüffend unterschiedliche Menschen begegnen. Ein Gegenmodell zur vielfach kopierten Bretterbudenromantik, die schon etwas in die Jahre gekommen ist.
Was ihn so erfolgreich macht? Schwer zu sagen. Er selbst weiß es auch nicht. Schon immer wollte er Leute anstecken, sagt er, und wirke anscheinend wie ein Katalysator auf andere. Manche sagen nach Konzerten, er schaffe es, dass man sich voll und ganz auf ihn und seine Performance einlassen kann: ein meditativer, bisweilen tranceartiger Zustand, in dem nicht selten Leute anfangen zu weinen. Andere wiederum haben wieder mit dem Klavierspielen angefangen.