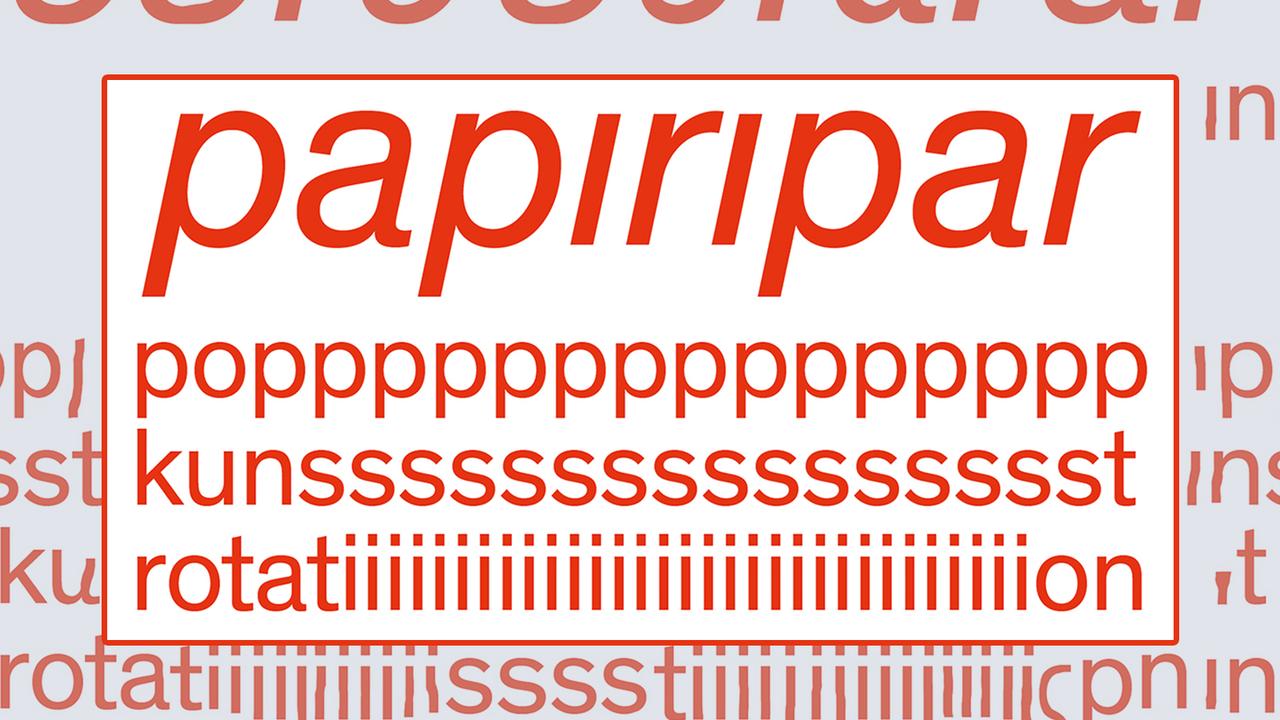Coming-of-Age und Ausbruch aus der KleinstadtRoosevelt im Interview über sein zweites Album „Young Romance“
18.10.2018 • Sounds – Interview & Fotos: Benedikt Bentler
Roosevelts zweites Album „Young Romance“, setzt direkt auf dem Pop-Entwurf seines Debüts von vor zwei Jahren auf. Noch ein bisschen schnörkelloser ist sein Sound geworden, organischer die Produktion. Grund dafür dürfte die ausgiebige Live-Erfahrung der letzten beiden Jahre gewesen sein. Aber Band hin, Konzerte her: Roosevelt bleibt das Soloprojekt von Marius Lauber, das sich mit „Young Romance“ in den Gefühlsduseleien Heranwachsender verliert. Aber das ist gewollt. Und das ist okay. Denn wie er sagt: „Popmusik braucht diese Blase.“
Zwei Jahre ist das letzte Treffen her. Was hat sich getan?
Wir sind vor allem als Live-Band gewachsen, haben ziemlich viele Backstage-Räume und Flughäfen gesehen. Und zum Glück ziemlich viele Leute vor der Bühne – also manchmal (lacht). Wir waren Ende 2016 zum ersten Mal auf USA-Tour. Und dann auf unzähligen Festivals in Osteuropa, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien. Dann die Tour in England. Was daran neu war: Wie komprimiert das alles stattfand. Sowohl die Album-Tour als auch die Festival-Saison danach. Vorher war man mal hier, mal dort, aber über Jahre hinweg, als special occasion.
Was nimmt man aus dieser Zeit mit?
Man hat ja immer die nächste Show in Paris oder London im Auge. Aber dann spielt man auf Festivals in Osteuropa – und die entpuppen sich unerwartet als die größten Festivals, auf denen man je gespielt hat. Das ist schon irre. Das Publikum dort war der Wahnsinn, in Südamerika war das ähnlich. Als Künstler verspürt man dort eine echte Dankbarkeit, weil das Programm nicht so übersättigt ist. Natürlich ist es auch cool, dass es in Berlin so viel Programm gibt, dass die Leute kritisch sind. Weil sich so vielleicht Perlen herauskristallisieren. Aber aus Künstlerperspektive ist es natürlich der Hammer, wenn du da ankommst und die Leute nicht erst noch überzeugen musst. Stattdessen geht es ab der ersten Minute ab. Das war fast schon surreal. Eine Band aus England oder Deutschland schaut dort nicht jeden Tag vorbei. Diese Euphorie nimmt man dankend an.
Und auch in die Produktion neuer Musik mit auf?
Einige Tracks, „Losing Touch“ oder „Shadows“ zum Beispiel, habe ich vom Songwriting her vielleicht schon mal so ähnlich gemacht. Aber die Produktion ist jetzt dynamischer. Nach der Tour ist vor der Tour – deshalb klingt das Album wahrscheinlich Band-lastiger. Das erste basierte noch mehr auf Samples und Beats. Hier habe ich mehr Drums gespielt, es gibt mehr organischen Ursprung hinter dem Processing.
Im Studio ist Roosevelt aber nach wie vor ein Soloprojekt?
Genau. Ich glaube, das ist auch die Idee von Roosevelt. Beim Livespielen ist es allerdings genauso. Das ist mein Baby und da gibt es keine Diskussion, wenn ich live etwas anders machen will. Es geht nicht darum, die beste Version zu machen. Ganz im Gegenteil: Mir ist immer klar, dass es noch eine bessere oder cleverere Art und Weise gäbe, etwas zu machen. Ich will es aber trotzdem. Das hat etwas Egoistisches. Aber es gehört dazu, dass ich das machen möchte, wie ich das fühle. Ob Snare im Studio oder E-Bass auf der Bühne ist da egal.
So lange du loyale Musiker in deiner Band hast.
(Lacht.) Die sind das langsam gewohnt. Natürlich bringen die auch ihren eigenen Style rein, und für den feiere ich sie – deshalb sind sie schließlich dabei. Das sind gute Leute, keine Maschinen.
„Young Romance“ von Roosevelt ist beim Berliner Label City Slang erschienen.
Wovon handelt „Young Romance“, abseits des Offensichtlichen?
Der Titel ist entstanden, als ich einem meiner Kumpels die neuen Demos gezeigt habe. Der meinte: Das klingt ja voll romantisch. Wir haben anfangs drüber gelacht, aber so wurde „Young Romance“ zum Arbeitstitel. Ich wollte das erst nicht als Titel, mir war das zu witzig, fast schon ironisch. Aber dann hieß dieser Ordner die ganze Zeit „Young Romance“ und je mehr Texte ich fertig hatte, desto mehr dachte ich: Passt irgendwie. Mit ein bisschen Distanz beschreibt es total gut, worum es in diesen Texten geht. Die Lyrics behandeln diese Jahre zwischen 16 und 20. Ja, es ist eine Coming-of-Age-Platte. Es handelt von Ausbruch aus der Kleinstadt – aber ohne großen Pathos.

Es ist immer noch relativ abstrakt gehalten und unterstützt die Musik. Vielleicht bin ich aber auch selbstbewusster im Umgang mit meinen Texten geworden, deshalb liegt mehr Fokus auf ihnen. Deshalb heißt das Album nicht „Coastal Sounds“ oder so. Der Spotlight liegt auf den Texten. Für Leute, die den Hintergrund nicht kennen, kommt das vielleicht nicht so rüber, aber für mich nimmt der Titel sich gar nicht mal so ernst. „Young Romance“ macht vor allem aus der Außenperspektive Sinn. Aus Sicht von jemandem, der sagt: Am Ende schreibst du eh immer nur über dieses Young-Romance-Thema (lacht).
Also ist Roosevelt nicht die ernsthafte Sehnsuchtsfigur des Teenagers im Liebeskummer?
Die kann es ja durchaus sein. Das ist das Interessante an Popmusik. Die Dinge können ambivalent sein. Die Bedeutung kann für jemanden eine völlig andere sein als für mich. Wenn jemand etwas in den Texten hört, dann ist das für denjenigen die Wahrheit. Es gibt ja diese „misheard Lyrics“, bei denen Leute jahrelang gedacht haben, in einem Song geht es um das oder das. Und nur diese subjektive Interpretation verleiht einem Song Bedeutung. Obwohl ich das nicht zu 100 Prozent ernst meine, kann es für jemand anderen genau das sein. Und das ist nicht falsch.
Braucht Popmusik eine politische Dimension?
Ich glaube, Politik muss auch in der Popkultur existieren. Aber ich finde, es muss genauso diese Blasen geben, in denen das nicht zum Thema gemacht wird.
Den Biedermeier.
Quasi, ja (lacht). Gerade weil Politik so omnipräsent ist und Leute beschäftigt, muss die Popmusik auch Blasen bieten, in denen sich die Leute daraus ausklinken können. Mit meiner Musik wollte ich schon immer diesen Raum schaffen, in dem Leute sich verlieren können. Es wird allerdings schwerer und schwerer, sich dem Drumherum zu entziehen. Ich habe viel darüber nachgedacht. In meiner Musik würden politische Themen meiner grundsätzlichen Idee entgegenstehen, ich wollte eben keine politische Botschaft rüberbringen.
Manche Themen sind für mich auch gar nicht Politik, sondern Menschenverstand. Dass man zum Beispiel hilft, wenn Menschen im Meer ertrinken. Das ist mein Anspruch an Common Sense und dafür stehe ich auch ein. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich ein politischer Rahmen ergibt, in dem meine Musik stattfindet. Man hat schließlich Reichweite. Aber vor etwa zehn Jahren, als ich noch bei Beat!Beat!Beat! gespielt habe, hätte man keinem Fan sagen müssen, dass Nazis kacke sind.
Und: Wenn man das noch nie gemacht hat, ist es gar nicht so einfach, den künstlerischen Ansatz für diese Dinge zu finden. Aber natürlich beschleicht mich irgendwie das Gefühl, dass auch unter meinen Facebook-Fans AfD-Wähler sind. Und das steht meinen Ansichten komplett entgegen. Damit richtig umzugehen, steht noch aus.
Wer Roosevelt live sehen und hören möchte, hat am 24. Oktober im Astra Kulturhaus in Berlin die Chance dazu.