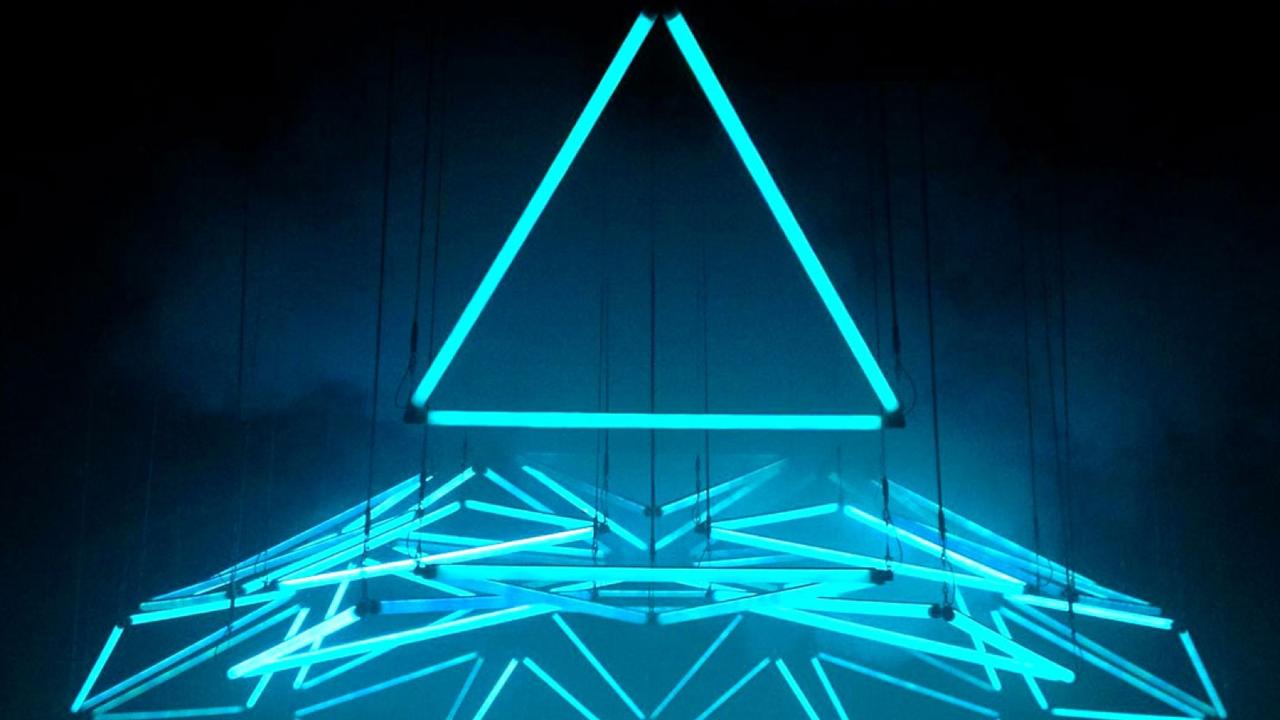Under Neon Loneliness, Motorcycle EmptinessBuchrezension: Die neue Einsamkeit von Diana Kinnert
16.6.2021 • Kultur – Text: Jan-Peter Wulf
Einsamkeit ist überall, hat Diana Kinnert festgestellt: Bei Alten und bei Jungen, auf dem Land, in der Stadt, unter Menschen und in Isolation. Mit ihrem Buch unterzieht sie ein oft tabuisiertes Phänomen einer breiten Analyse – vom Städtebau übers Smartphone bis zu Taylor Swift. Jan-Peter Wulf hat das Buch gelesen.
Die Autorin ist so ziemlich das Gegenteil von dem, wie man sich von außen vermutet und betrachtet (doch was heißt das schon) eine Person vorstellt, die Einsamkeit kennt. Diana Kinnert ist Unternehmerin und Start-up-Entrepreneur, Publizistin, Aktivistin und nicht zuletzt Politikerin, kurz: Sie ist mega vernetzt. Dass ausgerechnet sie sich mit diesem Thema beschäftigt, ist keinesfalls Koketterie, sondern aus persönlicher Erfahrung (Tod der Mutter und weiterer Nahestehender, innere Abschottung gegen die vielen Menschen um sie herum, „Nichtbegegnung meines Schmerzes“, Flucht in Exzess, Liebschaften statt Beziehungen etc.) begründet und stößt im Prinzip gleich mitten in die Sache hinein: Einsamkeit können wir alle kennen. Kennen wir vielleicht sogar alle, nur wissen wir es manchmal nicht. Wir haben es, so nämlich Kinnerts These, heute mit neuen Formen der Isolation zu tun. Längst nicht mehr sind nur „die Alten“, das tradierte Kollektivsymbol für Vereinzelung, Betroffene. Leben wir heute noch die Idee des Gemeinwesens? Leben wir heute noch in einer Gesellschaft? Nicht die Individualisierung, findet Kinnert und da kann man ihr nur beipflichten, wenn man nicht gerade Thatcher heißt oder in der FDP sein politisches Zuhause (sprich: seine Singlewohnung) gefunden hat, stehe für die Idee einer Gesellschaft, sondern ihr Antonym, also Kollektivismus.
Eine verlorene Generation?
Doch dem geht’s gerade nicht gut. Die größten Zuwächse bei den Telefonseelsorge-Anrufen haben die 30- bis 45-Jährigen, die eigentlich doch mitten im Leben stehen sollten. Nähe, diese wissenschaftlich belegte Lebensnotwendigkeit, ist für viele fern und, klar, die praktisch berührungslose Zeit seit März 2020 hat das alles noch einmal auf Steroide gesetzt. Kinnert verwendet den Begriff soziale Rezession und wie sich diese auswirken wird, langfristig, wird sich noch zeigen. Unter anderem und ganz besonders bei jungen Menschen: Feiern, Ausgehen, Cornern – der Verzicht auf bzw. das Verbot dieser Dinge wurden vor dem Hintergrund einer Pandemie und ihrer Bekämpfung mithin als Erste-Welt-Probleme abgetan, so Kinnert. Doch sie spricht sich vehement dafür aus, das Problem, das aus der Unterdrückung dieser natürlichen Verhaltensmuster entsteht, zu erkennen und anzuerkennen. Früher lauteten die Jugendwörter des Jahres, die von Langenscheidt/Pons gekürt werden, Yolo, Läuft bei dir, I bims oder Ehrenmann/-frau. 2020: lost. Justin Bieber singt 2020 von seiner Einsamkeit und Isolation, Taylor Swift oder Demi Lovato schlagen deutlich ernstere Töne an und werden zu Stimmen einer Kohorte, die die Soziologie nun schon als „verlorene Generation“ tituliert. Klar: Diese Themen waren schon immer dem Coming-of-age zueigen. Nur gibt es heute nicht einmal mehr Flächen, Orte, Menschen, an denen man sich mit ihnen reiben kann.
Diana Kinnert, das merkt man, hat sich in das Thema reingehängt. Die aktuelle Popkultur hat sie ebenso gescannt wie viele Studien und reichlich Theorie gelesen. Robert Putnam und Richard Sennett fährt sie unter anderem auf, um ihre Thesen zu belegen. Dass sie zwischenzeitlich auch die stets irrlichternden Ulf Poschardt und Norbert Bolz zitiert: geschenkt. Sie beschäftigt sich mit der Einsamkeit der alleine im Raum sitzenden, essenden und trinkenden Figuren in den Bildern Hoppers (dessen berühmtestes Bild hat im Lockdown übrigens eine noch tristere Neuinterpretation bekommen).
Die Dystopie einer Beziehung wie in „Her“ (2013) brauche es gar nicht, wo Dating so viel massiv einfacher geworden, nur eben kein Enabler für Beziehungen geworden ist und zu Konsum statt Intimität führe. Da ist sie dann ganz nahe bei Eva Illouz. Nähe ohne Nähe, reibungslose Emotionen, Gentrifizierung der Gefühle. Kinnert zieht die Kreise weit: Die neue Einsamkeit hat mit Deliberalisierung, Globalisierung und Digitalisierung zu tun. Der heutige Neoliberalismus habe das menschliche Maß verloren, konstatiert sie. Das vermeintliche Teamwork entlarvt sie mit Sennett als perfide Strategie, sich hinter der Optimierung des Produkts einzureihen.
Orientierungslosigkeit mache die Subjekte zu Strandgut im hyperflexiblen Kapitalismus, tradierte „elterliche“ Werte wie Verantwortung, Verlässlichkeit oder Verbundenheit reduziere das Berufsleben der Generationen Y und Z auf kollaborative Tools für lose Verknüpfungen, wir sehen uns im Slack. Das Smartphone, das ja auch das Cover ziert, identifiziert sie in einer etwas langatmigen Analyse als zentrales Element für das zum Scheitern verurteilte Nähe-Distanz-Spiel. Für die „Fernanwesenheit“, wie es die Trendforschung mal genannt hat, die ja zugleich eine Nahabwesenheit ist.
Nicht mal Non-Places brauchen wir noch
Wo Orte der Begegnungen wie Marktplätze abgeschafft sind und nicht mal deren Epigonen, Malls und andere Nichtorte, heute noch gebraucht werden, man sich einfach überhaupt gar nicht mehr treffen braucht, sind wir dann in der Stadt der totalen Vereinzelung angekommen, die Phänomene wie Hikikomori – totale Selbstisolation – oder Mokbang – anderen (alleine) beim Futtern zuschauen – zeitigt, aber auch eine scheinbar offene Stadt wie Berlin (und wie geschlossen war sie in den letzten anderthalb Jahren) und ihre Menschen trifft. Wie stehen Intimität und Stadt zueinander? Urbanes Leben, das seien nicht nur die stets sichtbaren Säulen, sondern das sei auch das weniger auffällige Innenleben. Was, wie sie am sozialgeographisch bestens dokumentierten Beispiel des Deindustrialisierungs-Opfers Glasgow anführt, zu einem früheren Tod der Stadtbewohner:innen führt, wenn der Städtebau nicht auf Transformationen reagiert und „sozialräumliche Disparitäten“ verstärkt. Mit Dieter Puhl hat Kinnert auch gesprochen: Die Menschen vermissen einen Platz im Leben, so seine Feststellung. Und Platz ist dabei sowohl eine Aufgabe als auch ein Ort.
Die neue Christdemokratie?
Kinnerts primäre Leistung ist nicht, dass das alles neu ist, dass diese neue Einsamkeit überrascht. Sondern, dass sie das alles einmal zu Papier gebracht hat und der Welt außerhalb der soziologisch-pädagogischen Bubble zuführt. Welches Fazit zieht sie selbst daraus? Zum Beispiel, dass wir dem „Community-Kapitalismus“ ein Fick dich ins Gesicht sagen, eine regional kontrollierte Wirtschaft aufbauen sollen. Orte der Begegnung schaffen, neue Strategien für Teilhabe entwickeln, das Zeitalter der Einsamkeit in eines der mentalen Gesundheit ändern. Sie führt einige pragmatische Beispiele an, wie Plauderkassen statt Selbst-Checkout oder genossenschaftliche Dorfläden, die diesen so wichtigen Begegnungsort zu neuem Leben erwecken würden, doch sie ist nicht naiv. Anti-Einsamkeit lasse sich nicht vorschreiben, schließt Kinnert. Eine Erforschung der Ursachen, eine Debatte, interdisziplinäre Betrachtung und letztlich sogar eine Reform des Gesundheitsbegriffs schlägt sie vor.
„Die neue Einsamkeit“ ist eine breit angelegte, sehr lesenswerte Analyse unserer Gegenwart. Und klingt mitunter erstaunlich sozialistisch dafür, dass Kinnert aktives Mitglied der CDU ist. Einer Partei, in der man sich mit Themen und Forderungen, wie die Autorin sie aufruft und stellt, bisweilen doch recht einsam fühlen muss? Was aber freilich wieder nur eine vermutende Betrachtung von außen ist.
„Die neue Einsamkeit“ von Diana Kinnert (Co-Autor ist Marc Bielefeld) ist bei Hoffmann & Campe erschienen, hat 448 Seiten und kostet 22 Euro. Es gibt auch eine Hörbuch-Version sowie einen Podcast: