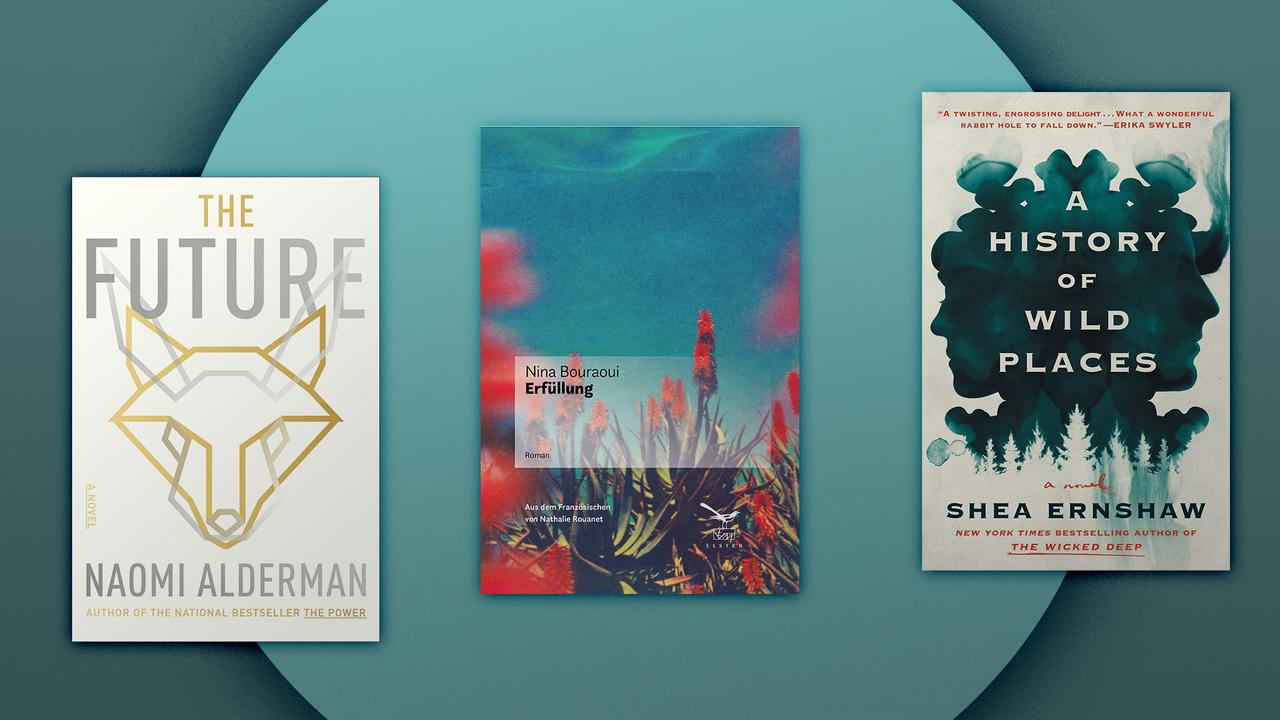Pageturner – September 2024: Dystopisches in 4KLiteratur von Paul Lynch, Tochi Onyebuchi und Emma Straub
2.9.2024 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Booker-Price-Gewinner Paul Lynch projiziert in „Prophet Song“ den Abriss der Welt auf seine irische Heimat. Tochi Onyebuchi nimmt in „Goliath“ das in den Blick, was wir in wenigen Jahren mit unseren Bausparverträgen finanzieren werden: die Flucht. Und Emma Straub fragt sich in ihrem Roman „This Time Tomorrow“, was Zeitreisen mit uns machen könn(t)en.
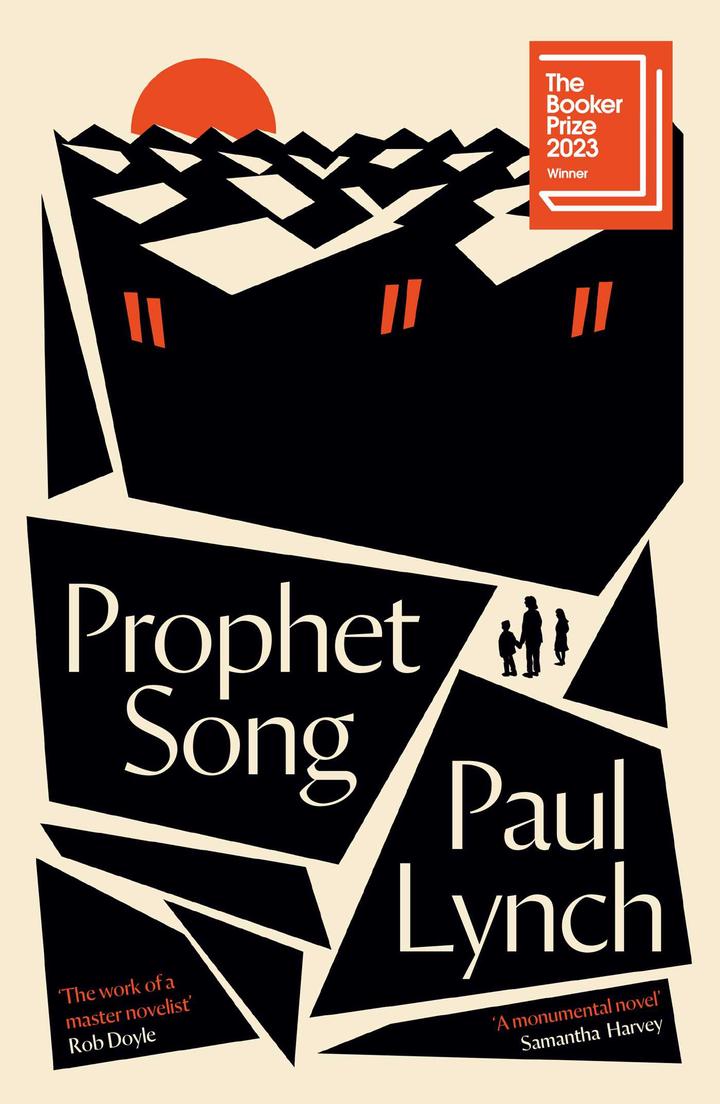
Prophet Song (Affiliate-Link) | Das Lied des Propheten (Affiliate-Link)
Paul Lynch – Prophet Song (OneWorld, 2023)
Dublin schien mir nie ein naheliegender Ort für einen spekulativen Roman zu sein. Zu katholisch, zu viel Vergangenheit, zu wenig Zukunft. Das ist natürlich Blödsinn, denn für eine ernsthaft furchterregende Dystopie wie „1984“ oder „The Handmaids Tale“ braucht es keinen Futurismus. Auch heutzutage nicht. Denn von der Düsternis und Unerbittlichkeit der Vision her betrachtet ist „Prophet Song“ des Iren Paul Lynch seinen Vorbildern mindestens ebenbürtig. Was den vorgestellten Zivilisationsbruch unter Absenz jeglicher satirischer Leichtigkeit angeht, ist sogar „The Road“ nicht weit. Dennoch auffällig ist die komplette Abwesenheit jeglicher zeitgenössischer Technologie.
Es gibt zwar TV-Geräte, Autoradios und Flugreisen, Mobiltelefone, Drohnen und wohl auch das Internet, Überwachungskameras oder Computer. Aber sie spielen exakt keine Rolle als Handlungsträger, was Lynchs Alternativ-Irland weniger heutig als viel mehr wie aus dem Erscheinungsjahr von Orwells oder Atwoods Visionen wirken lässt. Oder wie eine im Geiste der neuen Autoritären wiedergeborene DDR der Siebziger. Totalitäre Regime sind eine permanente überzeitliche Gefahr. Sie brauchen keine Hochtechnologie, um zu funktionieren – nur Entschlossenheit und Brutalität: Das ist wohl die Botschaft hier. Und es ist ein in jüngster Zeit vermehrt benutztes Stilmittel in dystopischen Romanen. Wohl auch, um zu verhindern, in fünf oder zehn Jahren schon überholt zu wirken. Was Lynchs Roman allerdings dann tatsächlich beunruhigend macht, ist die schiere Nähe zu aktuellen Entwicklungen in so vielen Teilen der Welt. Vor allem denen, wo man es sich nie vorstellen konnte (oder wie langsam klarer wird: durchaus konnte, aber nie wollte). Wie der Würgegriff von Bürokratie und Sonderexekutive langsam enger wird, wie individuelle und gesellschaftliche Freiheiten erst unauffällig, dann forciert wegfallen und von nahezu lückenloser Arbeits- und Lebensverwaltung ersetzt werden, wo Widerstand immer unwahrscheinlicher und aussichtsloser wird.
Der Roman stellt die wieder und wieder aktuellen Fragen: Wann wird es unerträglich? Wann müssen wir weg, bevor es zu spät ist? Können wir einfach so weg, und wohin dann? Was müssen wir zurücklassen? Was passiert mit denen, die wir verlassen, mit Freunden, Familie, Kollegen und Nachbarn? Auch die unangenehmen Wegschau-Fragen werden gestellt: Sind wir als weitgehend unpolitische Familie überhaupt betroffen? Was geht uns die ganze Politik schon an, wir sind ja Wissenschaftler? Ist es schlimmer wegzugehen und das eigene Umfeld im Stich zu lassen oder da zu bleiben und auf bessere Zeiten zu hoffen? Dass die Schließung totalitärer Systeme nie absolut sein kann, Flucht oder Widerstand möglich sind, ist ein weiterer Punkt, den auch dieser Roman durch das zeitlich schwer einzugrenzende Setting plausibel machen kann. Der Preis allerdings – und da ist der Roman von gnadenloser Konsequenz –, den man an individuellem und kollektiven Schmerz und Verlust zahlen muss, ist immens.
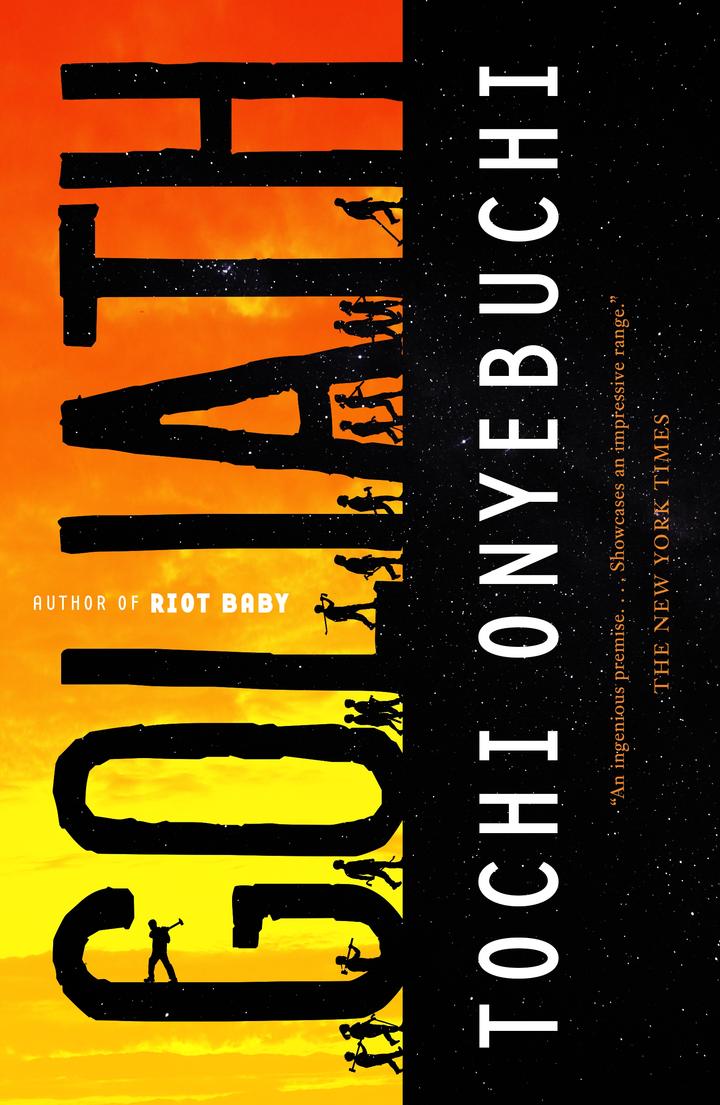
Goliath (Affiliate-Link)
Tochi Onyebuchi – Goliath (TorDotCom, 2022)
Es gibt sie noch, die guten Dinge. Es ist erschreckend wie folgerichtig, dass in einer Zukunft, in der diejenigen, die es sich leisten können und von der verstrahlten, vergifteten, verseuchten Erde in die Weltraumkolonien flüchten – Elysium-Style – und dort körperlich, genetisch und neurologisch optimiert und cyborgisiert werden, doch das heimelige Gefühl der alten Sachen nicht missen wollen und sich das irdische Handwerksgut in ihre neuen Gated Communities nachliefern lassen. Für dieses Nachsenden sorgen – unter Einsatz von Leben und Gesundheit – die Abrissfirmen, Entrümpler, Scouts und Schrottverwerter. Sie machen die den Großteil der Dagebliebenen aus, bewohnen noch die schrumpfenden Städte, die sich leerenden Viertel und entkernen gleichzeitig die Städte. Verschiffen, was im Outer Space noch einen Wert hat, von Kupferrohren über alte Holzdielen und Treppengeländer zu seltenen Tieren und Pflanzen, gut verpackt in die Kolonien.
Die vor Ort Gebliebenen, die meist nicht anders konnten, weil arm, krank, immobil, abhängig, ohne Ausbildung und ohne die Mittel sich verbessern zu lassen, genau sie kannibalisieren ihre eigene Lebenswelt für die wohlhabenden Neuanfangenden im All. Die Verbliebenen und die wenigen Rückkehrer mit speziellen Gründen versuchen, in den brutaler werdenden Umgangsformen und den leerer werdenden Städten einen Rest Menschenwürde und Lebensqualität zu erhalten – zumindest solange die Strahlungsbarrieren noch aufrecht erhalten werden. Im Umland lässt sich ohne Radioaktivität hemmende Körpermodifikation nicht mal mehr überleben, schon gar nicht leben.
Tochi Onyebuchi erzählt diese klassische Post-Apokalypse ohne eigentlichen Apokalypse-Event. Es ist eher ein langsames Vermodern in postindustriellem Brachland, eine ultimative „Rust Belt“-Werdung, als multiperspektivische Elegie oder melancholisches letztes Aufbäumen mit grimmigem Humor. Der Impuls, irgendwie klarkommen zu müssen mit einer Situation, für die sie selbst am wenigsten können, ist für die prekären und meist nichtweißen Protagonist:innen kein neuer oder ungewohnter Umstand: Sie kennen dieses Leben seit Generationen. Onyebuchi, der ansonsten Fantasy und Comics (etwa „Black Panther“) für ein Heranwachsenden-Publikum schreibt, macht in seinem ersten großen Roman für Erwachsene (die tolle Novelle „Riot Baby“ vom vergangenen Jahr war eher noch „Young Adult“-konform) keine Kompromisse, was die Komplexität und kaleidoskopische Weite der Raum- und Zeitebenen seiner Erzählung angeht. Langsames Lesen wird allerdings belohnt. Nicht nur mit zahllosen nur ganz leichten Extrapolationen aktueller Trends von Opioiden und Policing über das „For-Profit“-Gefängnissystem bis zur Gentrifizierung. Sondern auch mit den wundervollen Schilderungen einer in pittoreske Ruinen zerfallenden Zivilisation, grandios ausgemalt in den Farben von Rost und Knochen, von altem Holz und letzter Hoffnung.
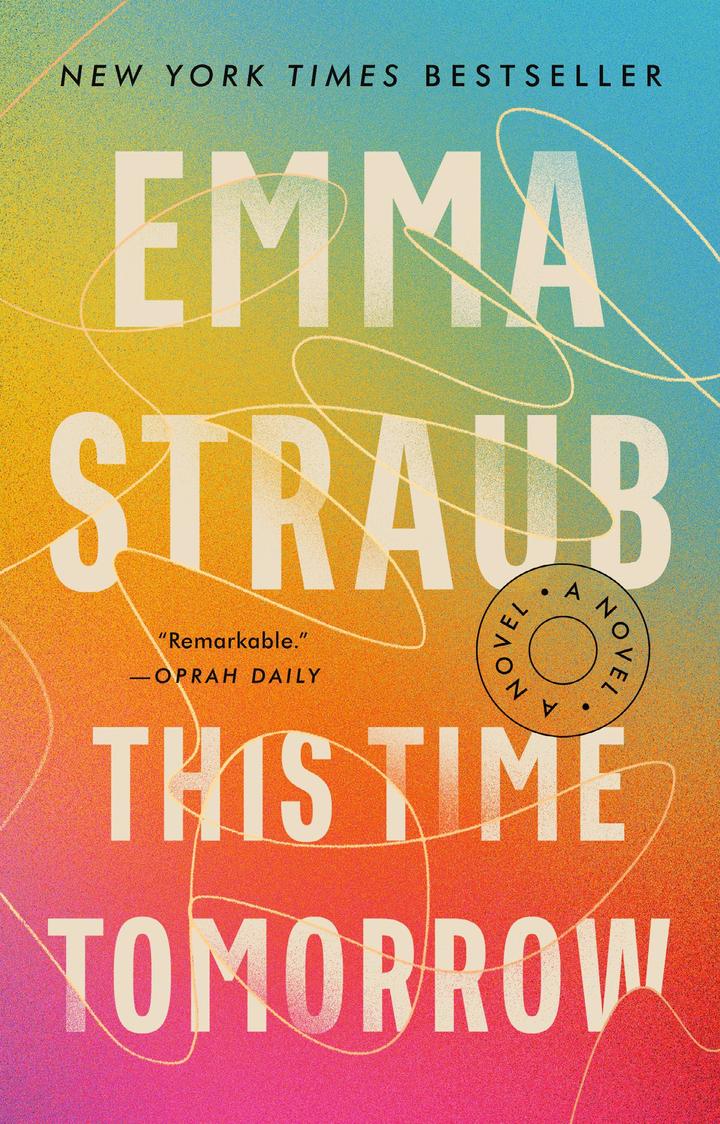
This Time Tomorrow (Affiliate-Link)
Emma Straub – This Time Tomorrow (Riverhead Books, 2022)
Ah ja, Zeitreisen werden nie alt. Die New Yorker Buchhändlerin und Autorin Emma Straub hat das selbstredend bestens verstanden, und mit „This Time Tomorrow“ ist ihr eine vielleicht nicht extrem originelle, aber doch sehr charmante Variation einer der beliebtesten Zeitreisetropen gelungen: ein trippiger Trip zurück zu einem früheren Selbst und in den eigenen jugendlichen Körper.
Alice, der Erzählerin von Straubs Roman, gelingt dies mit dem Tardis-artigen Geräteschuppen ihres Vaters sogar reproduzierbar, immer für 24 Stunden, immer zu ihrem sechzehnten Geburtstag, wenn auch mit der bittersüßen Wendung, dass sich die Lebensumstände bei der Rückkehr durch die Entscheidungen damals nur oberflächlich ändern lassen. So bleibt der Vater in der Gegenwart doch immer sterbenskrank, selbst wenn es der Tochter in der Vergangenheit gelingt, ihn dazu zu überreden, mit Rauchen aufzuhören und weniger Hotdogs zu essen oder wieder mit der abwesenden Mutter zusammenzukommen.
Erzählungen von Zeitreisen beschäftigen sich letztlich immer mit der Frage, was ein gutes Leben ist oder gewesen sein könnte, was ein erfülltes Leben ausmacht, was dem Leben Sinn gibt. Hier ist es spezifisch die Frage nach dem Umgang mit der Familie, mit den Dingen, die ungesagt blieben, mit dem In-die-Hand-Nehmen des eigenen Lebens. Die Antworten Straubs sind melancholisch, Glück immer komplex und weder der Vorsatz, alles anders zu machen noch alles so beizubehalten, ändern die je eigene innere Verfasstheit fundamental. Wie sollte es auch anders sein? Denn sonst könnte man aus Büchern ja gar nichts lernen über das Leben. Eine Frage, die nicht aufgeklärt wird, und die mich verfolgt: Die zugelaufene Katze Ursula lebt bereits einige Jahre im Haus, als die Protagonistin ihren 16. Geburtstag feiert, und wenn sie ihren 40. feiert immer noch. Ist also in Wirklichkeit Ursula die Zeitreisende, die Zeitpilotin, und die Menschen nur Passagiere – oder aus Katzensicht: Gepäck?