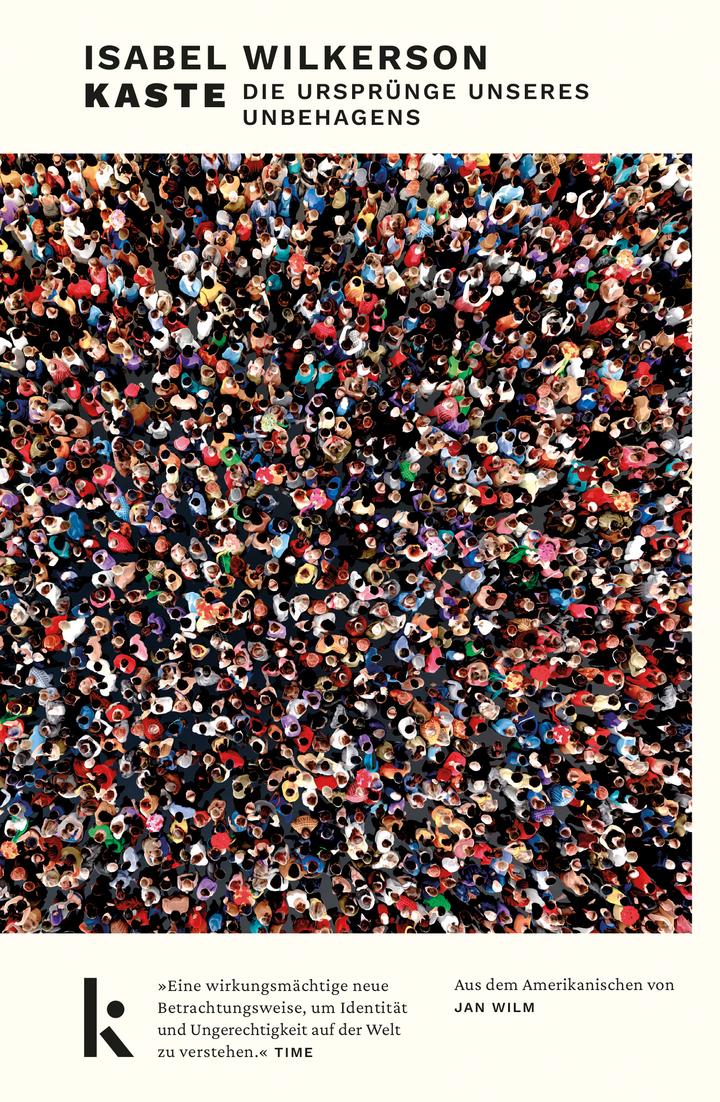Pageturner – Oktober 2024: Realität(en)Literatur von Claire Dederer, Isabel Wilkerson und Frank Bruni
7.10.2024 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Claire Dederer untersucht in „Monsters“ künstlerische Werke vor dem Hintergrund ihrer historischen Entstehung – und was eine etwaige Neubewertung und der Umgang mit dieser Diskrepanz bedeutet. Auch Isabel Wilkerson beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Kastensystem besteht jedoch nach wie vor, sagt sie – und das hat Auswirkungen. Frank Bruni wirft in „The Art Of Grievance“ einen analytischen Blick auf das Phänomen des Unrechts.
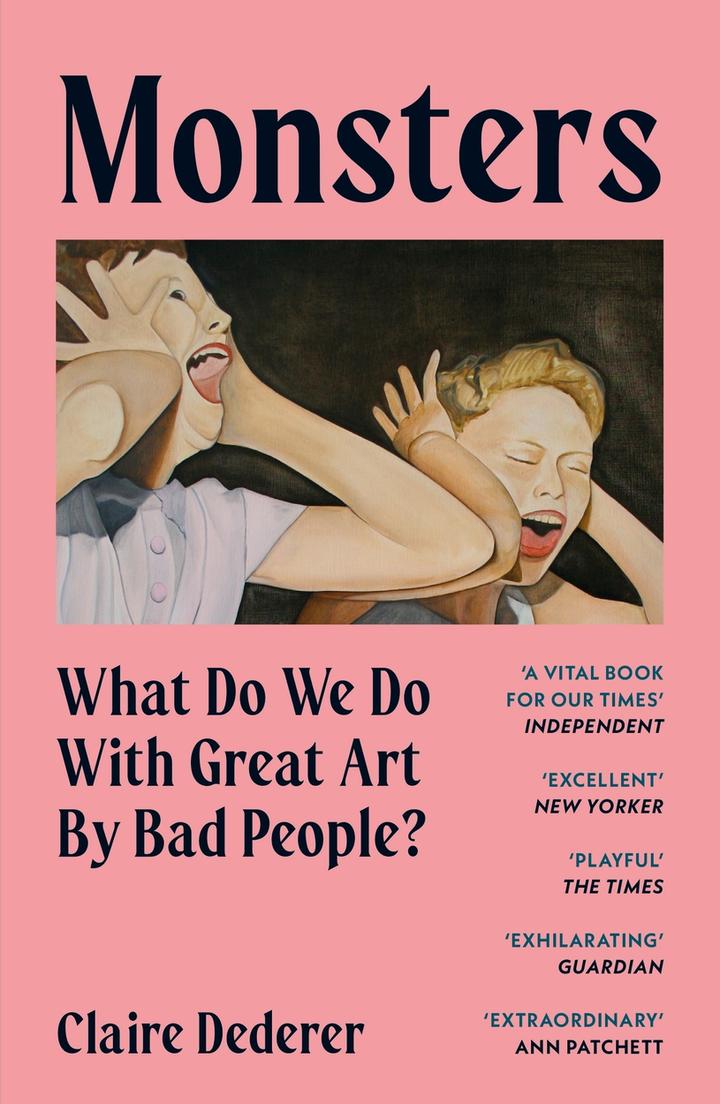
Monsters (Affiliate-Link) | Genie oder Monster (Affiliate-Link)
Claire Dederer – Monsters (Sceptre, 2022)
Oh ja, so ein ethischer Leitfaden für den persönlichen wie allgemein-gesellschaftlichen Umgang mit „problematischen“ Künstlern und Künstlerinnen (wobei erstere klar überwiegen), ja das wäre echt mal eine super Sache. Wo verläuft die Grenze zwischen Leben und Werk, ab wann wird die künstlerische Arbeit, werden die entstandenen Artefakte durch die Verfehlungen des Menschen diskreditiert? Was macht den Genuss eines Werkes ethisch nicht mehr hinnehmbar oder persönlich unerträglich? Lassen sich die bösen Akte gegen die gute Kunst aufrechnen? Und falls ja, wie gewichtet? Ist es strukturell prinzipiell dasselbe oder vergleichbar, einen transfeindlich auslegbaren, unbedachten Biologismus zu äußern oder eine Minderjährige unter Drogen zu setzen und zu vergewaltigen? Wie hältst du es mit der allgegenwärtigen sexuellen Gewalt, mit Frauenschlägern und Femizid, mit den Queer-Hatern, mit den Faschisten, mit den Rassisten und den Antisemiten? Was, wenn die Täter auch Opfer sind? Sind Drogen, Unwissen oder Vernachlässigung mildernde Umstände? Oder die Zeit selbst? Wie kommt es, dass (immer noch!) sogar die Wahrnehmung der Taten gegendert ist, dass Männer als Predatoren gesehen werden, die öffentlichen Urteile außer bei den brutalsten niederträchtigsten Taten noch vergebbar scheinen, aber Frauen (noch immer) schon übergroßer Ehrgeiz krummgenommen wird, vor allem wenn dieser mit tendenzieller Vernachlässigung der Familie oder der Kinder einhergeht?
Die „New York Times“-Literaturkritikerin Claire Dederer geht den Themenkomplex persönlich an, stellt sich diesen Fragen als partielles Memoir in Abgleich mit der eigenen Biografie und den spezifischen eigenen Erfahrungen. Das funktioniert in der Hinsicht, dass der Ekel und die Empörung angesichts der Gewalt nachvollziehbar wird, aber zugleich auch der allzu menschliche Impuls, von einem Thema überfordert zu sein und eigentlich nur in Ruhe gelassen werden zu wollen. Ein Impuls, der in dem resignierten Zitat eines Bekannten auf den traurigen Punkt gebracht wird: „If we give up the antisemites, we'll have to give up everyone.“ Oder, anderes jüngeres Beispiel, oft gehört: „Rammstein fand ich noch nie gut.“ Nichts Genaueres nicht wissen wollen, ist aber kein Ausweg – das macht Dederer klar. Also versucht sie dem Dilemma durch das erneute Schauen der Filme, dem nochmaligen Lesen der Bücher, dem Wiederhören der Musik zu begegnen, was sich mit dem Wissen um die Untaten geändert hat, was es mit ihr gemacht hat. So gelangt Dederer vom „Wir“ der ausgehenden Fragen sehr rapide zum „Ich“ mit der ihr jederzeit bewussten Gefahr, sich am Spektakel der eigenen verlorenen Unschuld zu erbauen. Das passiert tatsächlich eher selten, der Weg zurück vom „Ich“ zum „Wir“ scheint durch diese Nahbarkeit allerdings oft verstellt.
So bleibt meist das Unbehagen. Was früher mal als edgy und provokant oder normal „für damals“ als lässlich für unbelehrbare Geniemännerkünstler gesehen wurde, all das lässt nun als einziges Gefühl noch ein Unbehagen zurück. Sogar im Ansatz, die kontaminierte Kunst doch bitte „rein ästhetisch“ zu betrachten (das wurde ihr immer wieder nahegelegt, meist von älteren Tweed-Männern). Wie auch immer das gehen soll. Es funktioniert nicht, das Unbehagen bleibt. Ob das individuelle Unbehagen allerdings als ethischer Leitfaden dienen kann? Es mindert nicht die Leistung Dederers, sich all der makelbehafteten Kunst noch mal auszusetzen und sich dabei analytisch selbst zu beobachten.
Isabel Wilkerson – Kaste (Kjona, 2023)
Gibt es einen grundlegenden Begriff, ein grundlegendes System der Unterdrückung, das verschiedene Ausformungen von Ungleichheit erklären kann? Eine Klammer, die uns Klasse, Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit und andere Ungerechtigkeiten erklären kann? Nun, für die US-amerikanische Journalistin, die wie Dederer für die „New York Times“ schreibt, sind es Folgeerscheinungen von perpetuiertem Machtgefälle, das sich im Sammelbegriff der „Kaste“ manifestiert. Also die Idee einer gesellschaftlich über Generationen fortgeschriebenen angeborenen Hierarchie. Man wird in eine bestimmte Gruppe hineingeboren und ererbt damit zufällige Eigenschaften, die ein soziales System, ein System der Machterhaltung bestimmter Gruppen weiterführt. Diese Eigenschaften können körperliche Merkmale sein wie Hautfarbe, gesellschaftlich tradierte Merkmale wie die familiäre Abstammung, Klasse, Religion oder Volkszugehörigkeit.
Wilkerson argumentiert empirisch – mit Studien, beispielhaften historischen und zeitgenössischen Fällen offensichtlichen gesellschaftlich gedeckten Unrechts und persönlichen Erfahrungen, die sie als soziale Aufsteigerin und Schwarze Frau in Amerika machen musste. Zur Erläuterung des Kastenprinzips werden drei spezifische Ausformungen herangezogen: der vorwiegend auf Hautfarbe bezogene Rassismus in den USA, das offiziell abgeschaffte, aber soziokulturell immer noch extrem wirkmächtige Kastenwesen in Indien und der mörderische Antisemitismus des nationalsozialistischen Deutschlands. Nach Wilkerson dient die Einführung oder Fortführung eines Kastensystem dem Erhalt eines Systems von Ungleichheit. Und die Folgen sind brutal und mörderisch. Nicht nur in den offensichtlichen und gut dokumentierten Fällen.
Zudem wirkt das System Kaste lange nach, sozial wie psychosomatisch und epigenetisch – sogar in die Körper nachfolgender Generationen hinein. Paradoxerweise gilt das sogar für die dominanten Gruppen, die im Kastensystem in der Position der Eliten agieren. Um so mehr und um so schädlicher für Leib und Leben gilt das für die als untergeordnet und minderwertig angesehenen Gruppen. Ein besonders perfider Aspekt aller Kastensysteme wird von Wilkerson dabei spezifisch herausgearbeitet. Wie ein gefühlter oder behaupteter Mangel dazu dient, dass sich die Mitglieder der Kasten jeweils als Rivalen um begrenzte Ressourcen sehen, die sie für sich und ihresgleichen mit allen Mitteln sichern müssen, sodass Neid und Konkurrenzdenken auf allen Ebenen – aber besonders schädlich wiederum auf den deklassierten – dazu dienen, das System zu stabilisieren. Für Wilkerson auch der Grund für das Wahlergebnis von 2016 (und womöglich 2024): Warum sollte sonst sehenden Auges ein Mensch in das höchste Amt der USA gewählt werden, dessen Politik der großen Mehrzahl gerade auch seiner Wähler:innen absehbar mehr schaden als nutzen wird?
Dieser Aspekt des Kastensystems erklärt eventuell auch, was ich das „Rückkehr nach Reims“-Problem nennen möchte: die Abkehr von der eigenen Herkunft, bis hin zur Ablehnung und Verachtung der eigenen Gruppe, sobald man es geschafft hat, aus dieser (meist unter Schmerzen und persönlichen Verlusten) „aufzusteigen“. Für die Beispiele USA und Indien legt Wilkerson das vehement und meist auch plausibel dar. Für den Judenhass der Nationalsozialisten ist es nicht mal ansatzweise adäquat und auch nicht schlüssig – selbst wenn Wilkerson mit dem Einfluss von „Jim Crow“ auf die Nürnberger Gesetze argumentiert. Es ist generell das Problem des Buches, dass die angelegten analytischen Kriterien nicht immer sehr präzise sind, und dass komplexere Zusammenhänge, etwa der moderne auf Israel bezogene Antisemitismus, oder der Rassismus gegenüber asiatischen oder lateinamerikanischen Migranten, im Erklärungsansatz „Kaste“ nicht vollständig aufgehen. Abseits dieser Auslassungen und Ungenauigkeiten ist Wilkersons Konzept der verallgemeinerten Kaste durchaus hilfreich, um Parallelen zwischen verschiedenen Weisen von Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch aufzuzeigen. Speziell ihre Darstellung der über Generationen reichenden Fortschreibung der Kastensysteme, selbst dann, wenn sie nicht mehr so heißen und nicht mehr als solche wahrgenommen werden. Ihr Fazit bezüglich dessen, was erreicht werden kann, ist daher eher zurückhaltend. Es braucht Empathie, die Fähigkeit, sich in die Lage anderer Menschen aus anderen Gruppen hineinzuversetzen (etwas, das jede Art von Kastensystem aktiv zu unterbinden sucht). Ja sogar eine radikale Empathie, die sich gegenüber dem Schmerz der Anderen öffnet. Wir können die Erfahrungen der anderen Menschen nicht machen, daher müssen wir uns immer wieder dazu bringen, ihre Menschlichkeit anzuerkennen und Gemeinsamkeiten suchen. Das ist eine Praxis, eine Übung für jeden Tag. Nichts, das automatisch passieren würde. Das ganz Einfache, das oft das Allerschwierigste ist.
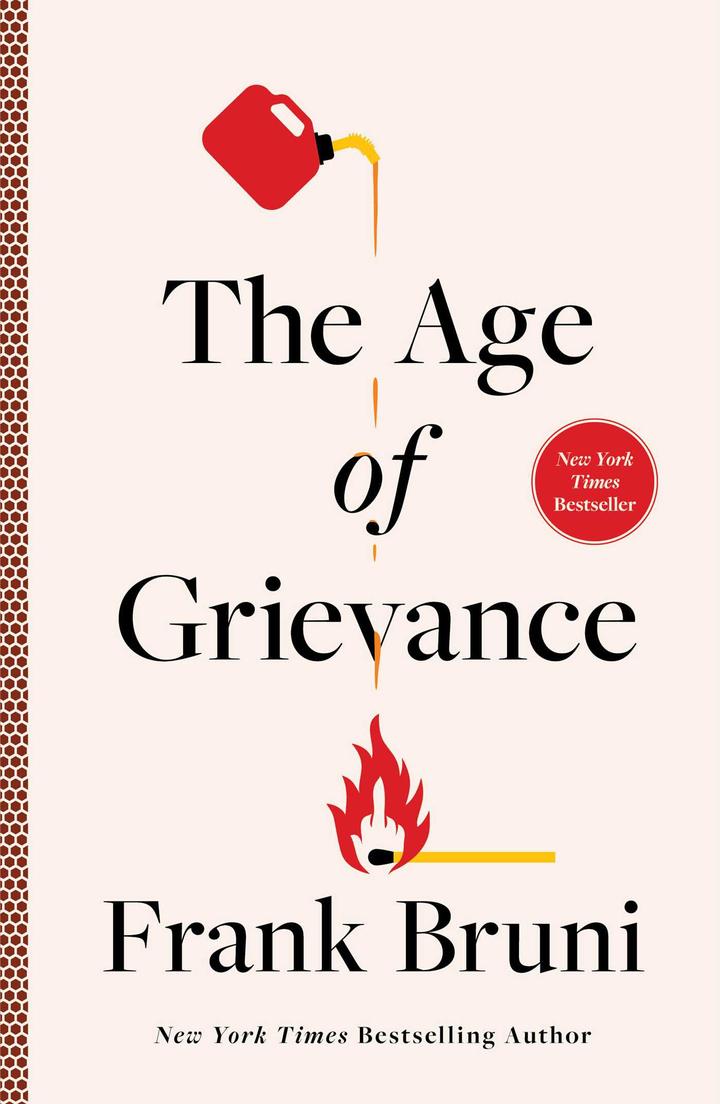
The Art Of Grievance (Affiliate-Link)
Frank Bruni – The Age of Grievance (Avid Reader Press, 2024)
Ricky Gervais hat es in, ich glaube es war „After Life“, mal so oder ähnlich zugespitzt: „Nur weil du hier das Opfer bist, hast du noch lange nicht recht.“ Dass nun aber ausgerechnet Klagelautstärke und Opferstatus zum primären Bewertungskriterium für die Legitimität von Beschwerden über Unrecht aller Art (gefühltem wie realem) geworden sind, ist ein Phänomen, das in den vergangenen Dekaden deutlich zugenommen und sich in den verschiedensten sozialen Milieus und politischen Lagern breit gemacht hat. Vor allem in solchen, die es eigentlich nicht nötig hätten und die vor Privilegien strotzen. Frisch ernannte US-amerikanische Bundesrichter etwa, die sich aufgrund ihrer Ansichten zur Abtreibung von einer vermeintlich übermächtigen medialen Meinungshoheit diskriminiert sehen.
Frank Bruni, Journalistik-Lehrer, Kolumnist und Gastrokritiker bei der, ihr ahnt es schon, „New York Times“, kann zahllose solcher Beispiele aus allen möglichen Zusammenhängen liefern und versucht in „The Age of Grievance“ eine zwar durchaus wütend-alarmierte, aber fast durchweg psychologisch-feinsinnige Analyse des Phänomens, dass dem, der am lautesten (und/oder zuerst) „Unrecht“ brüllt, am ehesten geglaubt wird, und der womöglich hinterher am wahrscheinlichsten auch Recht bekommt. Dass Meinungen durch Empörung und die Performance erlittenen, gefühlten oder auch nur behaupteten Schmerzes validiert werden, also wörtlich verstanden einen Wert bekommen. Dieses selbst erfüllende Wahrwerden über Volumen ist an sich eine klassische rhetorische Strategie; dass sie zunehmend und vor allem in den USA als politisch und moralisch valide wahrgenommen wird (und eben unmittelbaren Erfolg zeitigt), jedoch relativ neu und nach Bruni ein böser Glitch der US-amerikanischen Politik. Ein Fehler im System, der allerdings weit über ein eng politisches Verständnis hinaus zu einem globalen kulturellen Problem geworden ist.
Was einmal im Internet war, lässt sich nicht mehr so einfach zurückholen. Denn die Nebenwirkungen und die sozialen Kosten dieser Erfolgsgeschichte sind immens. Nicht nur werden legitime Anliegen von strategischen ununterscheidbar und dadurch von Fakten losgelöst, gleichgemacht und entwertet. Die gesellschaftlichen Effekte sind beinahe noch gravierender. Gräben werden vertieft, Positionen, über die vor wenigen Jahren noch Konsens herrschte, plötzlich unversöhnlich. Kommunikation wird schwieriger bis unmöglich, überhaupt die Möglichkeit eine Lösung finden: Ansätze zur Problemlösung, die auf Konsensorientierung, Kompromissbereitschaft und generell auf Pragmatik setzen, werden immer weniger realistisch, manchmal nicht einmal mehr vorstellbar. Das je eigene Unglück zum Maß aller Dinge zu machen und eine Identität herum zu konstruieren, individuelle Ethik oder Gruppenmoral entlang gefühlter oder realer Benachteiligung zu organisieren, erzeugt tatsächlich selbst wieder immenses (und immer reales) Unglück. Solange das Kalkül des angesammelten Unglücks, der angetanen Gewalt, der aufgestauten Wut erfolgsversprechender scheint als Selbstreflexion, Kommunikation und Pragmatismus (oder gar Altruismus), wird sich daran so schnell nichts ändern. Dabei wäre es ein gar nicht so unüberwindlicher erster Schritt, sich einfach einzugestehen, das die Dinge meist kompliziert sind. Oder dass Bescheidenheit eine Tugend ist.