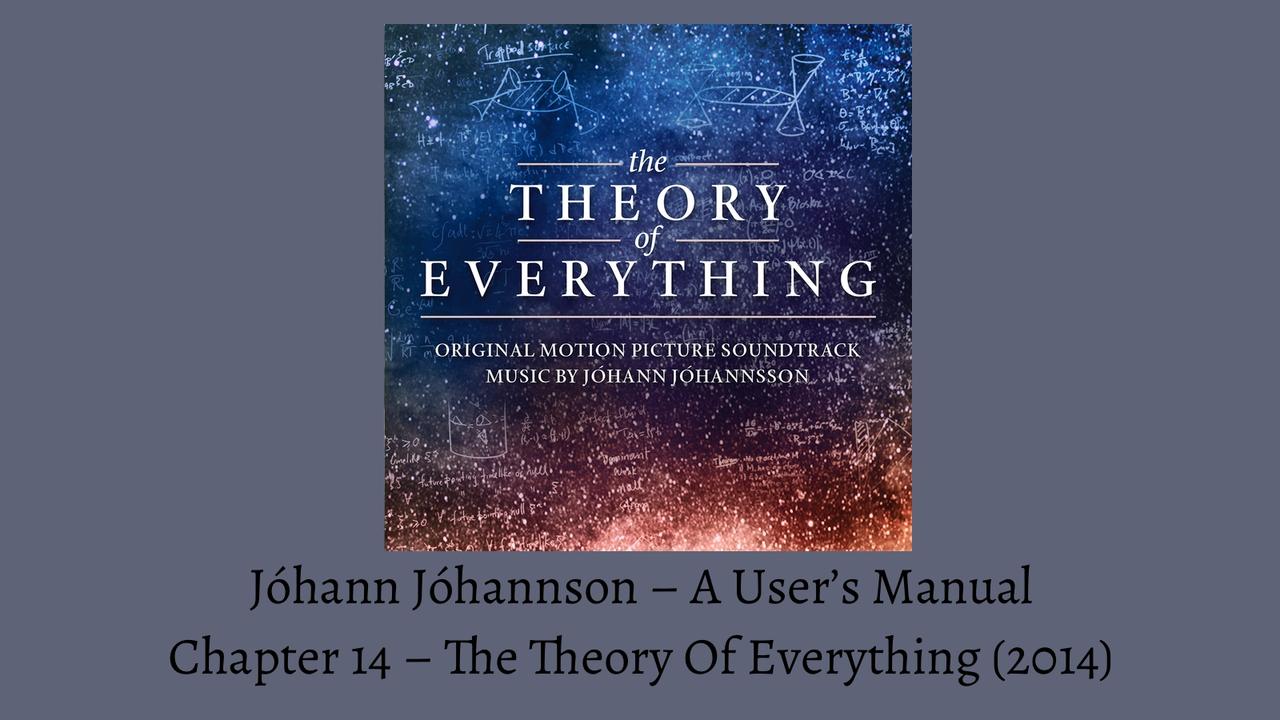Pageturner – März 2023: Straße, Leben, AnarchieLiteratur von Behzad Karim Khani, Dinçer Güçyeter und Eva Demski
1.3.2023 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Behzad Karim Khani schreibt, wie Berlin-Neukölln rappt. Dinçer Güçyeter reflektiert die „Gastarbeiter“-Realität in der niederrheinischen Provinz. Und Eva Demski träumt sich in die Lebensrealität von Anarchist:innen auf der Suche nach einem möglichen Konnex für das Heute. Frank Eckerts Literaturempfehlungen für den März 2023.

Hund Wolf Schakal (Affiliate-Link)
Behzad Karim Khani – Hund Wolf Schakal (Hanser Berlin, 2022)
Vom hiesigen Zeitungsfeuilleton wurde Behzad Karim Khani, studierter Medienwissenschaftler, Autor und Bar-Betreiber in Berlin, jüngst bereits zum Idealtypus eines neuen Hipsters ausgerufen. Also jung, clever, versiert in Klassik und neuester Popkultur, schöngeistig und geschäftstüchtig zugleich. Was ihn für die nachrückende Generation im deutschen Kulturbetrieb besonders interessant macht, ist, dass er in den Themen des Deutschrap zu Hause ist, über die Tropen der Straße schreibt, über Erfahrungen mit Krieg, Gewalt, Armut, Ausgrenzung und Kleinkriminalität, die den meist biodeutschen vermutlich wohl behütet aufgewachsenen Feuilletonist:innen fehlt – das dann aber im Duktus der extremen Verfeinerung umsetzt.
Seine Sprache ist bildreich und poetisch, Gegenteil der heiser kehlig rausgepressten Instant Messages des aktuellen HipHop- Mainstreams. Khanis Debütroman „Hund Wolf Schakal“ macht denn auch alles richtig, um dieses „authentisch“ gezeichnete Bild der Neuköllner Blocks feinironisch zu unterlaufen und es doch gleichzeitig zu bestätigen. Die Motivation des straßigen Rap, an Orten und Situationen gewesen zu sein, die krass genug waren, um unbedingt weg zu wollen, um groß zu träumen, um ein besseres Leben zu erstreiten – by all means necessary. Genau diese vor allem im deutschen Rap zu oft zum puren Klischee geronnenen Aufstiegsfantasien nimmt Khani wiederum selbstironisch und in lyrisch reicher Sprache auf, um sie fragmentiert und vielfach gespiegelt als Meta-Authentizität wiederzugewinnen, ihnen ihre Würde zurückzugeben.
So könnte „Hund Wolf Schakal“ vielleicht tatsächlich ein neues „Als wir träumten“ (Clemens Meyer) werden, die gebrochene Macker-Romantik ist jedenfalls schon mal sehr korrekt. Also alles richtig gemacht fürs Feuilleton und dabei doch „real“ geblieben. Für eine bessere Gentrifizierung. Wirklich guter Roman.

Unser Deutschlandmärchen (Affiliate-Link)
Dinçer Güçyeter – Unser Deutschlandmärchen (Mikrotext, 2022)
Ein Gabelstaplerfahrer aus Nettetal holt die Schönheit und Theatralik zurück in die deutsche Sprache. In autofiktionalen Lebenserzählungen – ausgerechnet –, die so grau und trist sind wie die niederrheinischen Winter, in denen sie sich abspielen, die von enttäuschten Hoffnungen, lebensweltlicher Enge und fehlenden Perspektiven erzählen. Den Geschichten der Frauen seiner Familie, als „Gastarbeiter“ aus der Provinz Anatoliens in die deutsche gekommen. Um dann doch wieder zwischen patriarchaler Tradition, Sprachlosigkeit, Krankheits- und Geldsorgen eingeklemmt zu bleiben. Was soll denn die Familie denken? Die Nachbarn? Die Deutschen?
Erzählt wird aber auch vom sich Einrichten, vom Klarkommen mit den Umständen, vom Erkämpfen kleiner Freiräume. Von Lücken, die in der zweiten Generation, der Dinçer Güçyeter selbst angehört, größer werden, aber noch nicht wirklich offen sind. Er will ein anderes Leben, will Theater machen, Gedichte schreiben, macht aber doch erst mal was „Solides“, eine Ausbildung im Metallfachbetrieb und nimmt letztlich eine Arbeit als Gabelstaplerfahrer an, der er bis heute nachgeht. Nicht zuletzt, um den Kleinverlag für Lyrik zu finanzieren, den er seit einigen Jahren betreibt. Es gibt eben mehr Arten der Prekarität als unmittelbare ökonomische Armut.
Eine Sprache zu haben für das, was man erlebt und denen eine Stimme zu geben, die keine haben: Das ist ein Unterschied, das macht einen Unterschied. Ich wiederhole mich hier sehr gerne: Deutschland braucht mehr Arbeiterkinderliteratur. Deutschland braucht vor allem mehr Arbeiterkinder, die nicht mehr bereit sind, das für sie vorgesehene Leben auszufüllen. Die etwas anderes wollen, nicht unbedingt mehr, nicht unbedingt den schwarzen Mercedes (aber doch ja, denn dann schon auch), aber eben auch Poesie, Kunst, Theater. Dinçer Güçyeter ist einen ganz anderen Lebensweg gegangen als etwa Annie Ernaux oder Edouard Louis. Er ist dageblieben bei seinen Leuten, seiner Familie, seiner Klasse und hat damit ganz andere Entfremdungserfahrungen und Anpassungsschmerzen durchgemacht als Louis oder Ernaux. Die Sprache, die er für sich und seine Erzählerinnen entwickelt hat, ist aber ähnlich klar und präzise, ähnlich poetisch.

Mein anarchistisches Album (Affiliate-Link)
Eva Demski – Mein anarchistisches Album (Insel Verlag, 2022)
Eine persönliche Reise durch die Geschichte, zu den Anarchist:innen und Anarchen unternimmt Eva Demski hier, als Bilanz einer fünfzig Jahre alten und bis heute anhaltenden Faszination am Freigeistigen und Libertären, einem Gefallen an Menschen, die das allfällige „Du musst“, „Du darfst nicht“ und „Du sollst“ in Frage stellen, die alle Arten von religiösen, politischen, verwandtschaftlichen, hobbyistischen Gemeinschaften scheuen, sobald sie genötigt werden, in ihnen aufgehen zu müssen. Und die notorisch „Warum“ fragen.
Demski – bekannt für Reiseliteratur, Frankfurt-Stadtführer, Katzenbücher und Gartengeschichten, auch Herausgeberin von Joseph Roth – bindet die Portraits wichtiger Anarchist:innen an ihre eigene Lebensgeschichte. Das gibt dem Buch einen leichten und freundlichen Charakter, trotz der oft tragischen und bitteren Biografien der Portraitierten. Was die beschriebenen Lebenswege in Theorie und Praxis ausmachte, von der Hobo-Queen „Boxcar Bertha“ bis zum russischen Aristokraten Kropotkin, war neben der grundsätzlichen Ablehnung von Dogmen und fixen Ideologien oft eine Liebe zu allem Schönen, Achtung vor menschlichem und tierischem Leben, Abwesenheit von Neid und Machtgier, eine unstillbare Neugier auf Andere und Anderes, eine Lust auf das Ausprobieren neuer Lebensformen, ein starker Wille zur Selbstorganisation, der tiefe Respekt vor jeder Art von Arbeit (inklusive dem, was früher in abschätziger Absicht „Frauenarbeit“ genannt wurde) und die Ablehnung von Gewalt als Mittel die eigenen Vorstellungen durchzusetzen.
Damit das klar ist: Es ist definitiv kein anarchistischer Akt, seine leere Bierdose auf den Gehweg zu werfen, auf dass jemand anderes den Müll wegmacht. Und Gewalt propagierende Egomanen und Umstürzlergrüppchen sind es schonmal gar nicht. Eigentlich selbstredend, dass keine der Portraitierten die Anarchie ohne Brüche oder Widersprüche leben konnten. Hochinteressant sind die Versuche, ein gutes Leben zu finden, allemal – also das gute Leben erstmal nur für sich selbst, aber doch eigentlich immer gleich für alle. Es gibt einige spannende Lebenswege zu lesen, von der russisch-jüdischen Emigrantin Emma Goldmann in den USA zu den anarchistischen Uhrmachern im Schweizer Jura Mitte des 19. Jahrhunderts (die Uhrenmarken, die aus diesem Kollektiv hervorgingen gibt es – abzüglich der Anarchie – heute noch). Die Sommer der Anarchie waren immer kurz. Aber wie der Sommer kehren sie wieder.