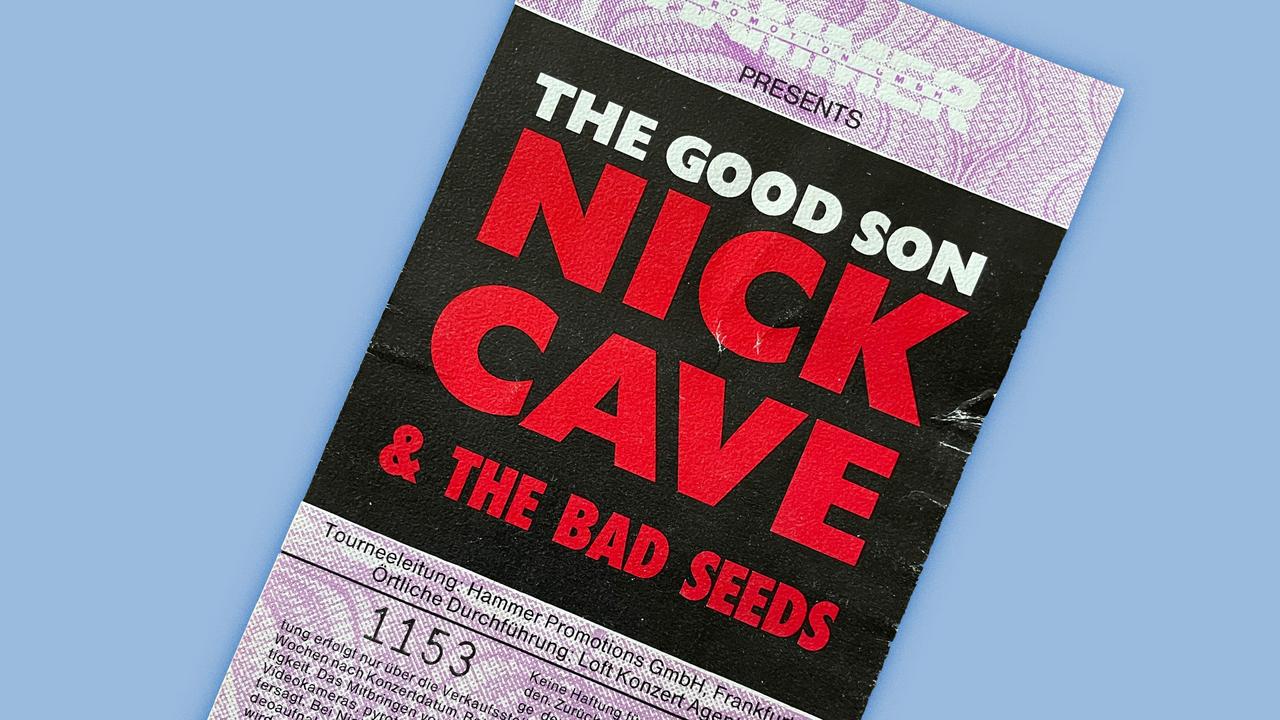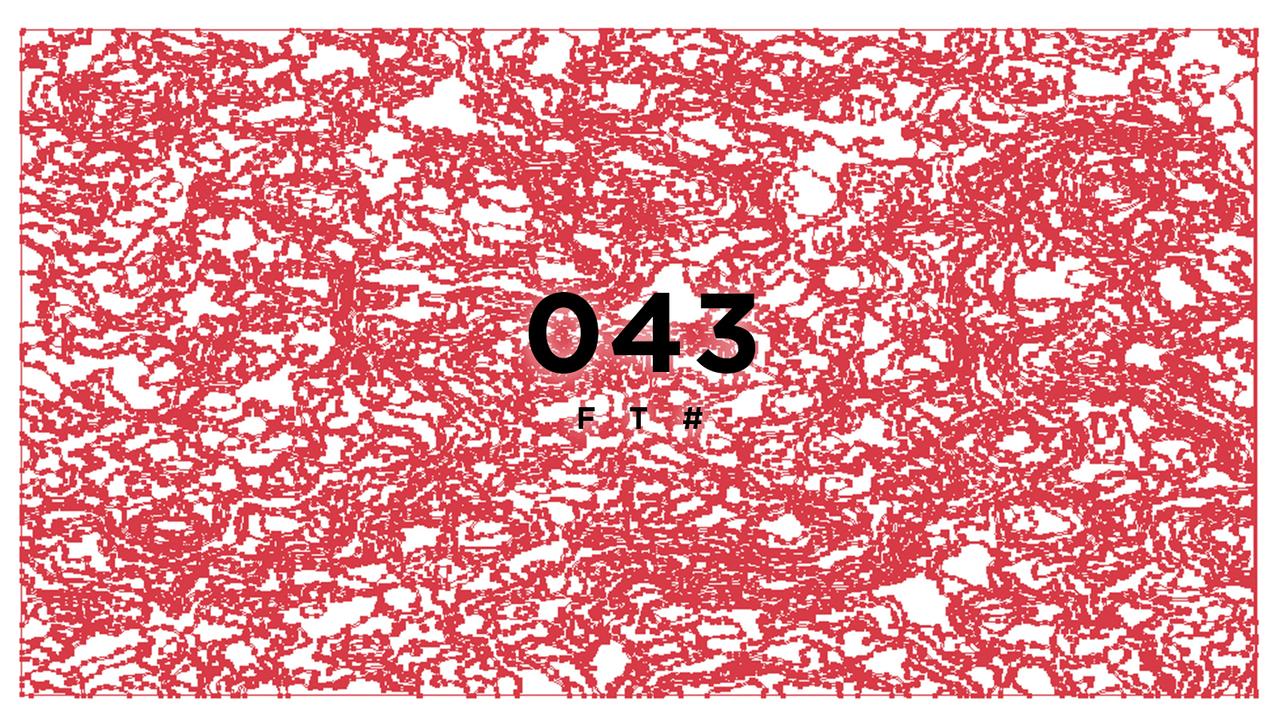Pageturner – Literatur im September 2021Karine Tuil, Zeruya Shalev, Sarah Pinsker
6.9.2021 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Wer schreibt, der bleibt. Vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist der Pageturner und versorgt uns jeden Monat mit Reviews seiner literarischen Fundstücke. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Für den beginnenden Herbst stehen drei große Themen an: Wie eine Tat ein Leben zerstören kann, wie sich Gewalt und Schmerz über Generationen in Körpern einschreiben und in Verhaltensweisen vererben und wie familiärer Zusammenhalt, sozialer Druck und gesellschaftliche Spaltung wirken.

Menschliche Dinge (Affiliate-Link)
Karine Tuil – Menschliche Dinge (Claassen)
Die üppigen Romane von Karine Tuil setzen sich gerne als Sittengemaälde des gegenwärtigen Frankreich in Szene, auch gerne genau dort, wo es wehtut. Tuil greift aktuelle Geschehnisse auf und verdichtet sie zu einer Art Reportage-Fiktion. Nach Banlieues und Islamismus ist es in „Menschliche Dinge“ eine #metoo-Geschichte von Macht und sexualisierter Gewalt vor dem Hintergrund des französischen Elitesystems im großbürgerlichen Paris: kurz nach Weinstein, Strauss-Kahn und der Kölner Silvesternacht. Der verwöhnte, zum Erfolg gedrillte Sohn eines Medienstars mit Duzfreunden in der Politik und die gesellschaftlich unerfahrene Tochter orthodoxer Juden begegnen sich auf einer Party, und es kommt zu den 20 Minuten, die für ihn ein zwangloser One-Night- Stand waren, und für sie ein Trauma, eine Vergewaltigung, die ihr jegliche Zuversicht und Freude am Leben nimmt.
Die Story, deutlich angelehnt an die „Campus-Vergewaltigung“, die sich 2016 an der amerikanischen Elite-Uni Stanford ereignete, zerfällt in zwei ungefähr gleich lange Teile. Die Vorgeschichte, eine recht schonungslose Bestandsaufnahme der ethischen Verwahrlosung des Pariser Bürgertums – und der Gerichtsverhandlung, in der der Fall von allen Seiten beleuchtet wird. Die erste Hälfte ist dabei nicht gerade frei von Stereotypen und Klischees, die zweite dagegen exzellent recherchiert und detailpräzise nacherzählt.
Wie eine Tat ein Leben zerstören kann, wie sie auch heute noch mit Milde und Nachsicht behandelt wird, wenn der Täter ein vielversprechender junger Mann aus gutem Hause ist, dessen Zukunft über die einer als durchschnittlich angesehenen jungen Frau gestellt wird, arbeitet Tuil deutlich heraus. Die Empörung darüber ist in den ausgleichenden, alle Seiten gleichermaßen anhörenden Schilderungen des Romans doch immer zu spüren – trotz oder gerade wegen der juristischen Detailfülle und Objektivität an einem Thema, bei dem es keine Objektivität geben kann.
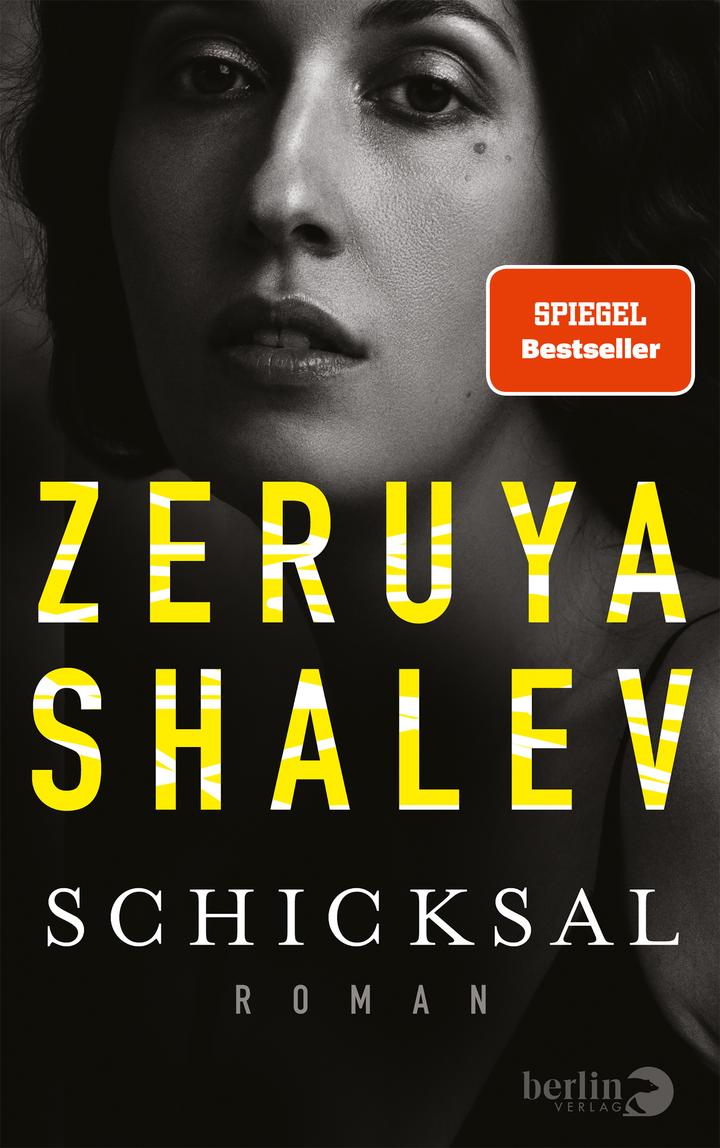
Schicksal (Affiliate-Link)
Zeruya Shalev – Schicksal (Berlin Verlag)
Wie sich Gewalt und Schmerz über Generationen in Körpern einschreiben und in Verhaltenweisen vererben, bildet die subkutanen Unterströme der Erkenntnis, die Zeruay Shalevs epischen Familienroman „Schicksal“ durchmessen. Emotional großzügig und zum Glück ohne allzuviel Pathos erzählt Shalev mit hintergründigem Humor und wenig Bitterkeit vom nicht mehr so glücklichen Alltag einer modernen zeitgenössischen zweiten Ehe mit Kinderpatchwork-Anhang. Die klimatische Tiefenanalyse eines familiären Befindlichkeits- und Beziehungsgeflechts ist etwas, das Shalev mit einer Präzision (und Gnadenlosigkeit) beherrscht wie kaum jemand sonst.
In „Schicksal“ steht das Beziehungshack im größeren politischen Kontext der Staatsgründung Israels, dem Hintergrund so vieler bis heute akuter Konflikte und Konfrontationen. Shalev erzählt das nicht entlang der offiziellen Historie, sondern über und mit der weitaus weniger bekannten Geschichte der militanten revisionistischen Splittergruppe der „Lechi“. Die sah es als dringlichste Aufgabe an, das britische Mandat in Palästina zu bekämpfen – sogar angesichts des Zweiten Weltkriegs – und nach der Staatsgründung Israels im Untergrund ohne Scheu die Mittel und Werkzeuge des Terrorismus gegen Dinge und Menschen zu verwenden.
Die so veflochtene Groß- und Klein-Geschichte wird um zwei Frauen herum entwickelt: um die 19-jährige Rachel, erste Frau des Lechi-Kämpfers und späteren renommierten Universtätsprofessors Meno, und um dessen ungeliebte Tochter Atara. In langsamen und komplizierten, vorsichtigen Gesprächen finden sie heraus, wie Meno vom aufrechten Widerständler zu dem jähzornigen selbstgerechten Haustyrannen werden konnte, dem Atara in ihrer Kindheit ausgesetzt war. Was mit der Kränkung der Illegalität und fehlenden Anerkennung als Freiheitskämpfer zu tun hat, mit dem jahrzehntelangen Druck und Zwang zu schweigen, lügen und zu verheimlichen. Und mit dem Schmerz über all die Toten und die verlorenen Freundschaften. Wobei nichts davon als Entschuldigung herhalten darf.
Wie Atara im beinahe permanent gewordenen Verkehrsstau zwischen Haifa und Jerusalem nach und nach erkennen wird, dass die toxischen Verhaltensmuster in ihrer zweiten Ehe mit der Vergangenheit zu tun haben könnten, sich aber nie monokausal darauf beschränken, ist interessant und spannend zu lesen – und sehr gut gemacht. Die eigentliche Meisterschaft Shalevs besteht allerdings in der Beobachtung der kleinen Gesten, der Missverständnisse und Beleidigungen, der Trigger und mikroskopischen Aggressionen, aber auch der Reste an Liebe in dieser modernen Familie. Wie subtil und fein das herausgearbeitet ist, macht den Roman erst groß.
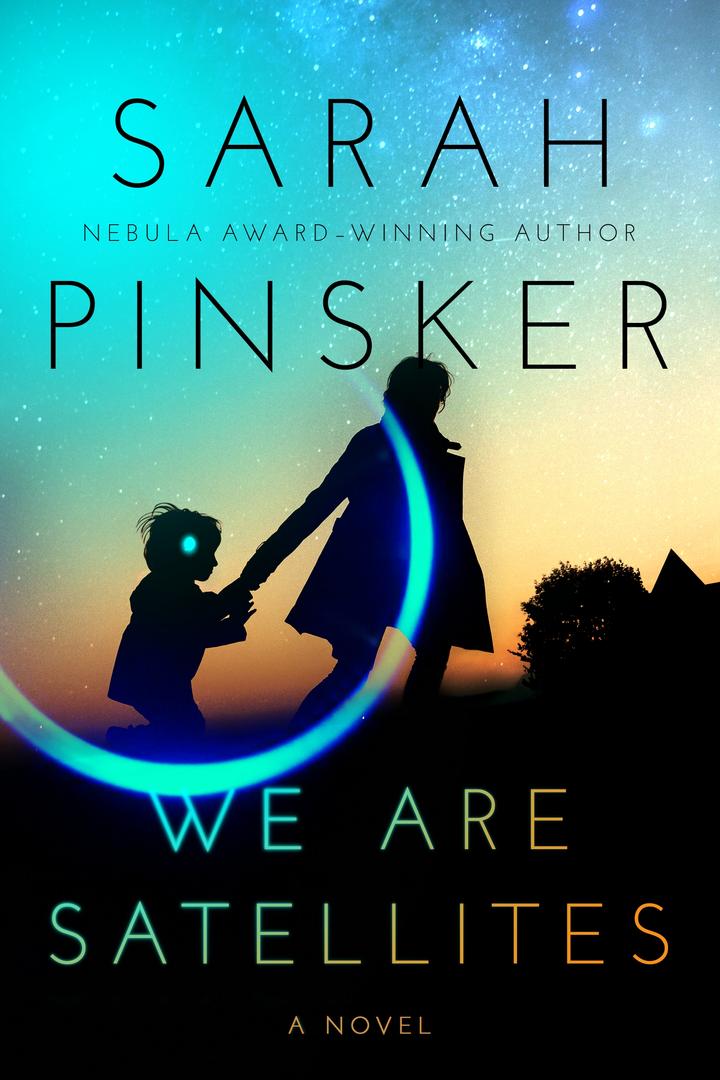
We Are Satellites (Affiliate-Link)
Sarah Pinsker – We Are Satellites (Berkley)
Familie und Technologie sind immer ergiebige Themen der spekulativen Literatur, für Sarah Pinsker allerdings durchaus neues Territorium. Ihren Debütroman und vor allem ihre Kurzgeschichtensammlung „Sooner or Later Everything Falls into the Sea“ mochte ich wie kaum etwas anderes in der Science Fiction der vergangenen Jahre. Weil Pinsker es verstanden hat, ihre Erfahrungen in Riot-Grrrll-Indie-Bands und queerem Feminismus in eine überaus überzeugende Vision näherer Zukünfte zu packen, die die Gegenwart immer höchst plausibel extrapolieren, gerne milde dystopisch sein dürfen, aber vor allem bodenständig punkig, indie und queer.
Auf Apokalypse und „Girl-in-Band“ verzichtet Pinsker in „We Are Satellites“ zugunsten der exakten realistischen Schilderung des ziemlich normalen Alltags einer modernen Familie aus zwei Müttern und zwei Kindern. In diesen unspektakulär liebevollen Familienverbund bricht unverhofft eine neue Selbstoptimierungtechnologie ein, ein Implantat, das die Aufmerksamkeit erhöht und die User über eine Verbesserung der Informationsverarbeitung und Wahrnehmungsverwaltung wirklich multitaskingfähig macht. Es erhöht nicht die Intelligenz an sich, sondern die Effizienz von Arbeit und Lernen. Kein Wunder also, dass dieser sogenannte „Pilot“ erst von Student*innen und Schüler*innen (und im Militär) gehypt wird und dann langsam aber unvermeidlich im Mainstream der Arbeitswelt ankommt.
Pinsker variiert diese Thematik clever, indem sie nicht irgendwelche fiesen Glitches, Rebound-Effekte oder böse Absichten der Technologie ausbreitet (also keine Black-Mirror-Episode erzählt), sondern die Auswirkungen eines weitgehend funktionalen und nicht schlechten Produktes von einem Hersteller ohne finstere Hintergedanken – einer „guten“ Technologie, deren Anwendung sogar staatlich gefördert wird, falls man sich die Prozedur nicht leisten kann – auf eine eben ganz und gar normaldurchschnittliche Familie darlegt. Die vier Mitglieder dieser sehr US-amerikanischen Kleinfamilie, aus deren Perspektiven Pinsker erzählt, wird von diesem neuen Technologie-Imperativ auf eine harte, beinahe existenzielle Probe gestellt. Sohn David ist freiwilliger Early Adopter, Mom Julie (Sachbearbeitrin) eher gleichgültig, aber mit dabei, als es für den Job unverzichtbar wird. Ma Val (Sportlehrerin an der hiesigen Highschool) ist deutlich skeptisch gegenüber derart invasiver Technologie, und Tochter Sophie Epileptikerin – sie darf das Implantant aus medizinischen Gründen nicht erhalten. So entsteht ziemlich rapide eine technische Klassengesellschaft, im großen Sozialen wie im Kleinen der Familie.
Wie familiärer Zusammenhalt, sozialer Druck und gesellschaftliche Spaltung, die aus der eigentlich unschuldigen „guten“ Technologie folgen und wirken, entfaltet Pinsker skrupulös und subtil. Sie fragt zum Beispiel wiederholt, ob und wie weit ein aktivistischer Widerstand gegen etwas, dass der Mehrheit tatsächlich nützt und produktiv ist, gerechtfertigt werden kann. Und besonders ungewöhnlich für ihr Genre ist die Liebe, menschliche Wärme und allzu menschliche Fehlerhaftigkeit der Figuren zueinander und generell. Ihre Entwicklungsfähigkeit, Offenheit und ihre akkurate Psychologie sind im spekulativen Genre immer noch zu selten. Dabei ist gerade die Liebe und ein tiefer Humanismus, die dieser durchaus sehr traurigen Geschichte eine hoffnungsfrohe Note geben.