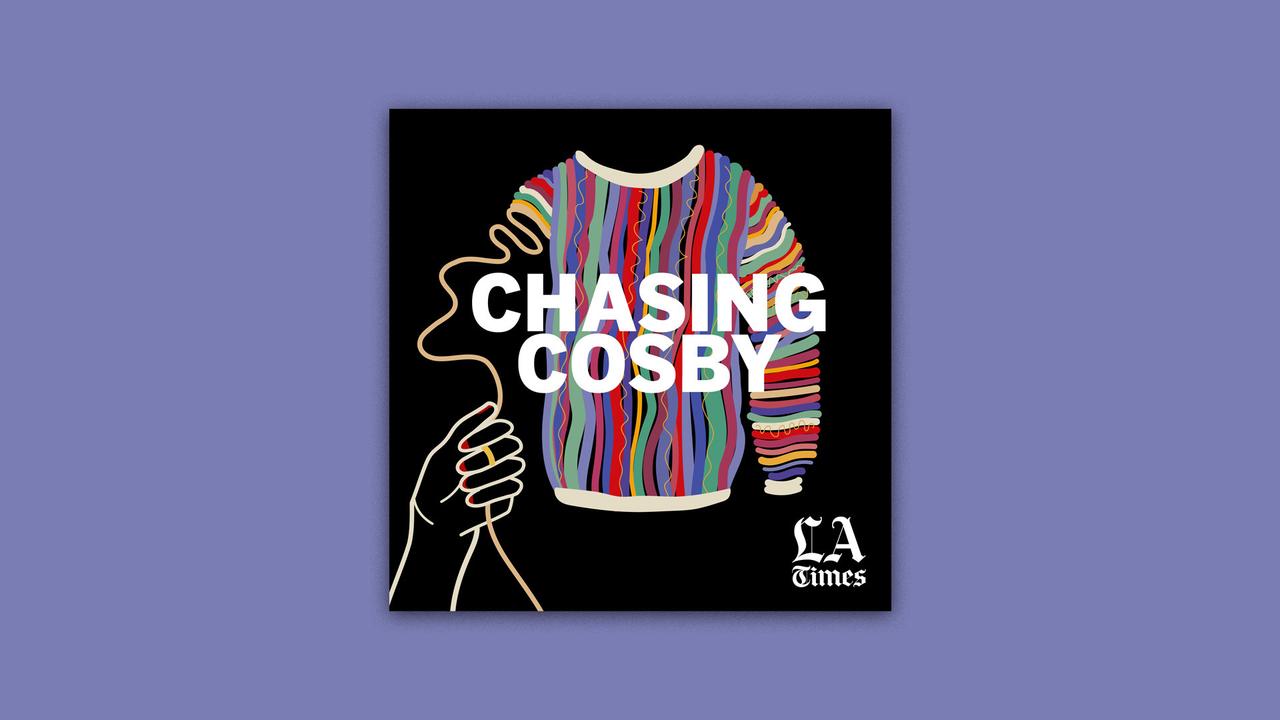Pageturner: Literatur im Mai 2020William Gibson, Emma Braslavsky, Sarah Colombo
4.5.2020 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Wer schreibt, der bleibt. Vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist der Pageturner und versorgt uns jeden Monat mit Reviews seiner literarischen Fundstücke. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Für den Mai dreht sich alles um das Konzept der Dystopie – was sonst wäre angemessen in der aktuellen Lage. Cyberpunk-Erfinder William Gibson spielt in „Agency“, dem zweiten Teil seiner „Peripheral“-Trilogie, erneut mit der Relevanz der Raum-Zeit-Kontinuums. Emma Braslavsky schreibt mit „Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten“ eine Vision über menschenähnliche Roboter und verweist Ian McEwan auf die Plätze. Und Sarah Colombo gießt in „Subterranean“ die Serie „Black Mirror“ in eine literarische Dringlichkeit.
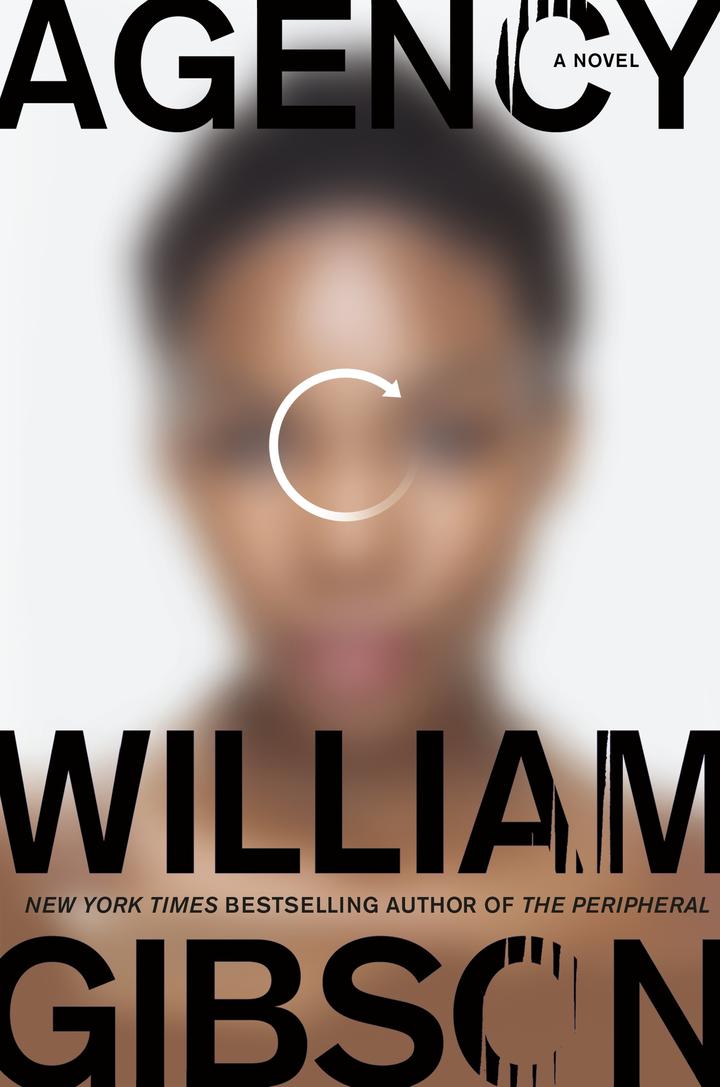
Agency (Affiliate-Link). Die deutsche Übersetzung erscheint im September 2020.
William Gibson – Agency (Viking)
Die Faustregel für Trilogien lautet: Der erste Teil ist der populärste, der zweite der spannendste (und oft beste) und im dritten Teil kommt alles zusammen zu einem (hoffentlich) plausiblen Abschluss. William Gibson ist ein Virtuose der Trilogie, er hat praktisch nie etwas anderes gemacht. Wir befinden uns somit im mutmaßlich mittleren Teil der „Peripheral“-Reihe. „Agency“ spielt im selben Multiversum, in einer nahen Zukunft, in der durch eine ominöse plötzlich aufgetauchte Quantenmaschine Zeitreisen möglich sind – in der einzig plausiblen Weise, die die Vielwelten-Variante der Quantentheorie erlaubt, nämlich der Zeitreise von Information. Die Vielwelten-Hypothese geht davon aus, dass jede Änderung eines Quantenzustand (der kleinstmöglichen Änderung überhaupt) ein neues alternatives Universum öffnet, dass also in jeder Femtosekunde unfassbare Mengen an potentiellen Universen entstehen.
Diese werden zugänglich, wenn Information den Zeitstrahl rückwärts reist, also eine Art Informations-Wurmloch in eine spezifische alternative Vergangenheit geöffnet wird. Diese Verbindung ist durch Gibsons Quantenmaschine stabil und kann Bilder und Text in beide Richtungen schicken, aber auch per Telemetrie z.B. Drohnen oder Avatare (die „Peripherals“) in der jeweils anderen Zukunft/Vergangenheit steuern. Auf die Konsequenzen eines solchen Eingriffs in einen derart stabilisierten Zeitkanal („stub“, Stummel genannt) auf die Gegenwart und Zukunft muss allerdings sorgfältig geachtet werden. Es sind ja echte Welten mit nicht weniger echten Menschen als im „big stub“ – der Zukunft, von der alles ausgeht, selbst wenn das Ganze virtuell, wie ein avanciertes Game daherkommt. Es gibt dementsprechend staatliche und private Institutionen, die nichts anderes machen. „Agency“ spielt in einem Stub, in dem Hillary Clinton die Wahl gewonnen hat und der Brexit abgewendet wurde, dafür aber an der syrisch-türkischen Grenze eine atomare Eskalation droht.
Die mittelerfolgreich als „App-Whisperer“ beschäftigte Verity bekommt die KI Eunice als Prototyp einer neuen Digi-Assistentin zum testen und merkt sehr schnell, dass hinter dem vorlauten UI viel mehr steckt, als ein Deep Learning Bot. Zusammen müssen die beiden nichts Geringeres als die Welt retten, ihre spezielle, die aber politische und soziale Auswirkungen auch auf den Big Stub in der Zukunft haben könnte. Wie erwähnt ist der Einstieg in den zweiten Teil eines Triplets leichter. Es ist möglich, tiefere Geschichten zu erzählen, muss aber noch nicht alles erklären und zusammenweben. Genau deswegen gefiel mir „Agency“ auch einen Tick besser als „The Peripheral“, trotzt dessen bodenständigeren Settings (eine „working poor trailer park“-Gegenwart vs einer von Oligarchen und Mafias kontrollierten Hi-Tech-Zukunft). Bin sehr gespannt auf den letzten Teil, der hoffentlich keine drei Jahre braucht.
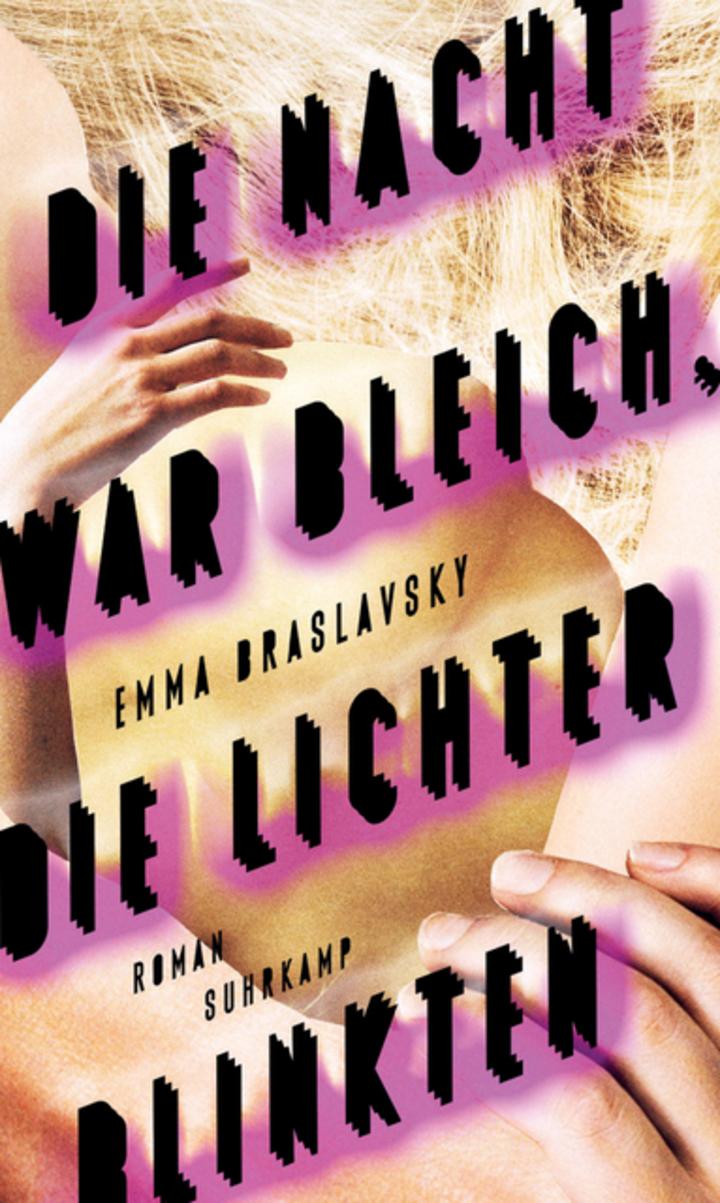
Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten (Affiliate-Link)
Emma Braslavsky – Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten (Suhrkamp)
Kurz nach Ian McEwans „Machines Like Me“ erschien diese deutsche Nahe-Zukunft-Spekulation über menschenähnliche Roboter, die sich motivisch bei „Real Humans“ und „Westworld“ bedient. Das Thema liegt wohl in der Luft. Hier heißen die künstlichen Menschen sogar Hubots wie in Real Humans. Emma Braslavskys Roman spielt im Boomtown gewordenen Berlin, weil dort das Potential von Hubots als Lebenspartner und Sextoys am schnellsten erkannt, legalisiert und kommerziell erschlossen wurde. Gleichzeitig grassieren Einsamkeit und Gleichgültigkeit. Selbstmord und Drogen, gerne kombiniert, sind die mit Abstand häufigsten Todesursachen. Die Geschichte, die sich in dieser hochglanzpolierten wie tristen Welt abspielt, wird von zwei Figuren erzählt, Lennard – einem egomanischen Möchtegernkünstler und erfolglosen Jungunternehmer – und Roberta, Hubot-Arbeitskraft, Datenanalystin und Ermittlerin im LKA, Abteilung für ungeklärte Suizide.
Das Thema dieses Dystopie-Subgenres ist selbstredend das Wesen der Menschlichkeit. Was macht uns zu Menschen, was zu Maschinen? Hier noch mit einem explizit feministischen Twist. Was macht mich zur Frau, zum Mann? Eingepackt in eine Krimihandlung: Lennard bringt sich im psychedelischen Drogenrausch um, Roberta sucht nach Verwandten, die die anfallenden Beerdigungskosten übernehmen. Die wesentliche Handlung ist allerdings eine innere. Die oft holprige Person-Werdung und Frau-Werdung Robertas, die keine Mensch-Werdung sein kann, denn der Restunterschied bleibt jederzeit und manchmal schmerzhaft klar. Ausgerechnet die kryptischen bis poetischen Tagebuch-Kritzeleien Lennards dienen Roberta als Kristallisationskeim ihrer Persönlichkeit. Auch die Gegenbewegung gibt es. Goran, ein nach Mads Mikkelsen in seinen besten Jahren modellierter Türsteher-Hubot, versucht seine Persönlichkeit loszuwerden, indem er seinen Source Code systematisch mit Viren sabotiert. Bei erwachsen Geborenen wie den Hubots sieht eine Coming-of-Age-Geschichte eben ein wenig anders aus als bei Menschen. Im direkten Vergleich mit McEwans Roman ist Braslavskys sowohl unterhaltsamer als auch philosophisch tiefer. Wo McEwan sich für Familie und Beziehungen interessiert, untersucht Braslavsky die Komplexitäten von Identität, vor allem ihre Sackgassen.
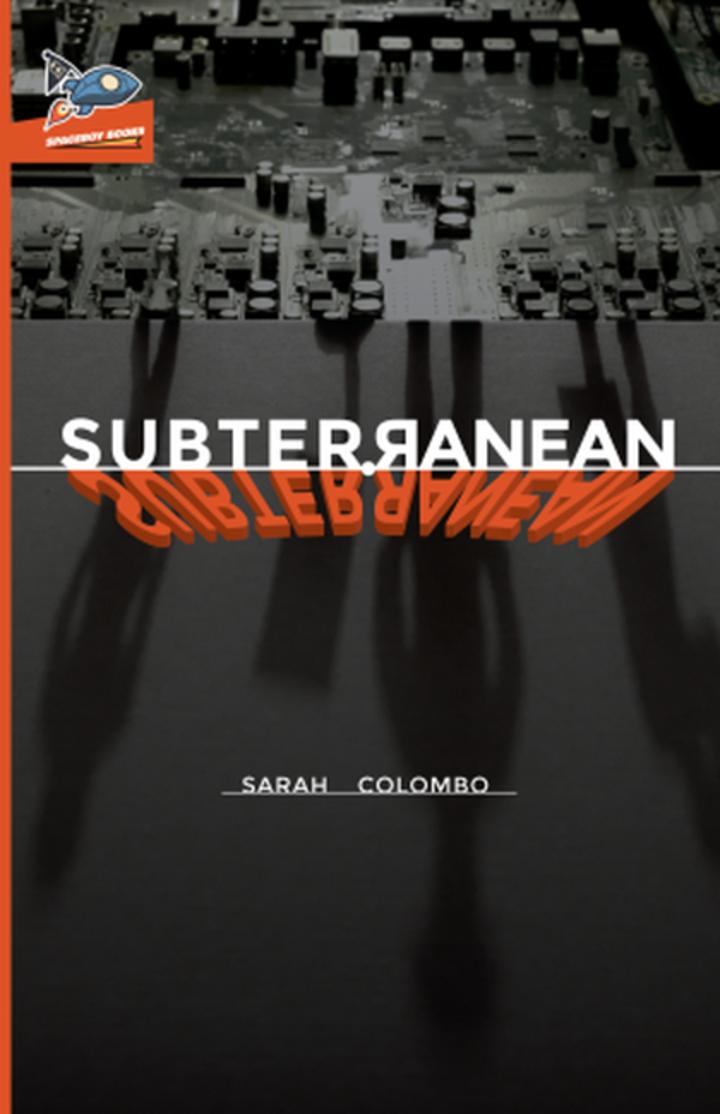
Subterranean (Affiliate-Link)
Sarah Colombo – Subterranean (Spaceboy Books)
Ich muss es immer wieder erwähnen: Spekulative Literatur, alles zwischen Science Fiction, Fantasy, modernen Märchen und „High Brow“-Dystopien macht heuer so viel Spaß und Sinn wie Dekaden nicht mehr. Das Debüt der US-Amerikanerin Sarah Colombo ist da keine Ausnahme. „Subterranean“ knallt wie eine exzellente „Black Mirror“-Folge gekreuzt mit einem jüngeren William-Gibson-Roman. Eine nahe Zukunft, die zugleich hochtechnologisch wie retrofiziert ist. Von der Vergangenheit, hier die Rave- und Grunge-Neunziger, besessen und komplett in die shiny Lebensverbesserungstools der Gegenwart eingebettet.
In dieser vollständig von Apps gesteuerten Welt ist Offline gehen nicht vorgesehen, denn die verbliebene Arbeit der Menschen besteht darin, ständig mit den allgegenwärtigen Screens zu interagieren, „sozial“ zu sein und „Content“ zu generieren. Den Rest erledigen Maschinen. „Subterranean“ erzählt die unwahrscheinliche Liebesgeschichte zwischen Ronnie, der in dieser Welt aufgeht, und Hil, die reich genug ist, um sich temporär und partiell aus dem System auszuklinken. Colombo erzählt vom endgültigen Verschwinden Hils und Ronnies unbeholfener Suche nach ihr als schnell getaktete Roadnovel, als Adventure-Game und chillischarfe Social-Media-Satire. Der Trip führt in die zerfallenden Outskirts, zu 90er-Ravenostalgikern und „X-Files“-Gläubigen, zu einer „Henri-David Thoreau Unplugged“-Community, zu einer südkoreanischen Agentur für virtuelle Freunde, wo sie in eine deutlich düsterere Verschwörungskiste hineingezogen werden. Also ein SF-Actionroman mit leicht fiesem Twist auf den Spuren von Jonathan Lethem und Thomas Pynchon (Vineland, Dark Fiber). Aber jetztzeitiger, jugendlicher, präsenter.