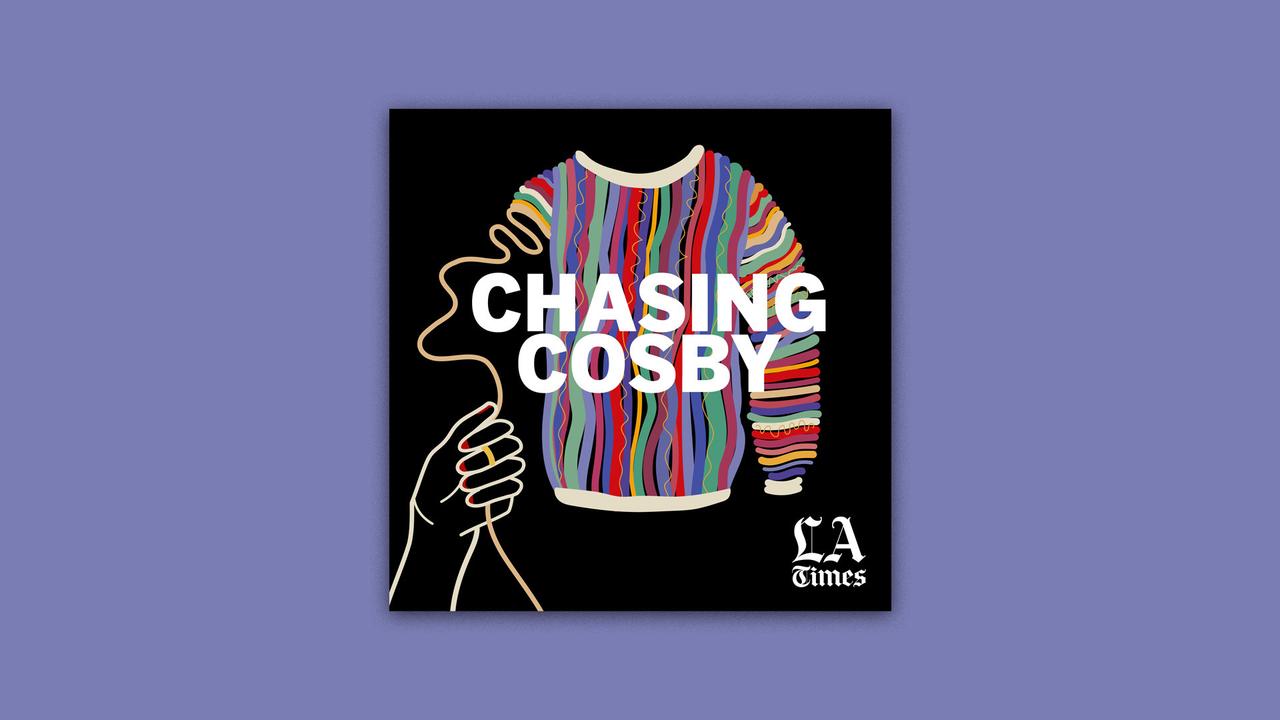Pageturner: Literatur im Juni 2020Lene Albrecht, Deniz Utlu, Mareike Fallwickl
29.5.2020 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Wer schreibt, der bleibt. Vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist der Pageturner und versorgt uns jeden Monat mit Reviews seiner literarischen Fundstücke. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Für den Juni pickt unser Autor drei Romane über hausgemachte und vorprogrammierte, vor allem aber desolate Zuständen, die mehr oder weniger das Zwischenmenschliche angehen. Lene Albrecht arbeitet in „Wir, im Fenster“ ein Verschwinden in Berlin auf. Das Sujet ist bei Deniz Utlu in „Gegen Morgen“ ähnlich, wenn auch vollkommen anders gelagert. Und Mareike Fallwickl blickt in „Das Licht ist hier viel heller“ in eine Familie, die in der Auseinandersetzung zwischen Weggehen und Dableiben schon längst zerbrochen scheint.
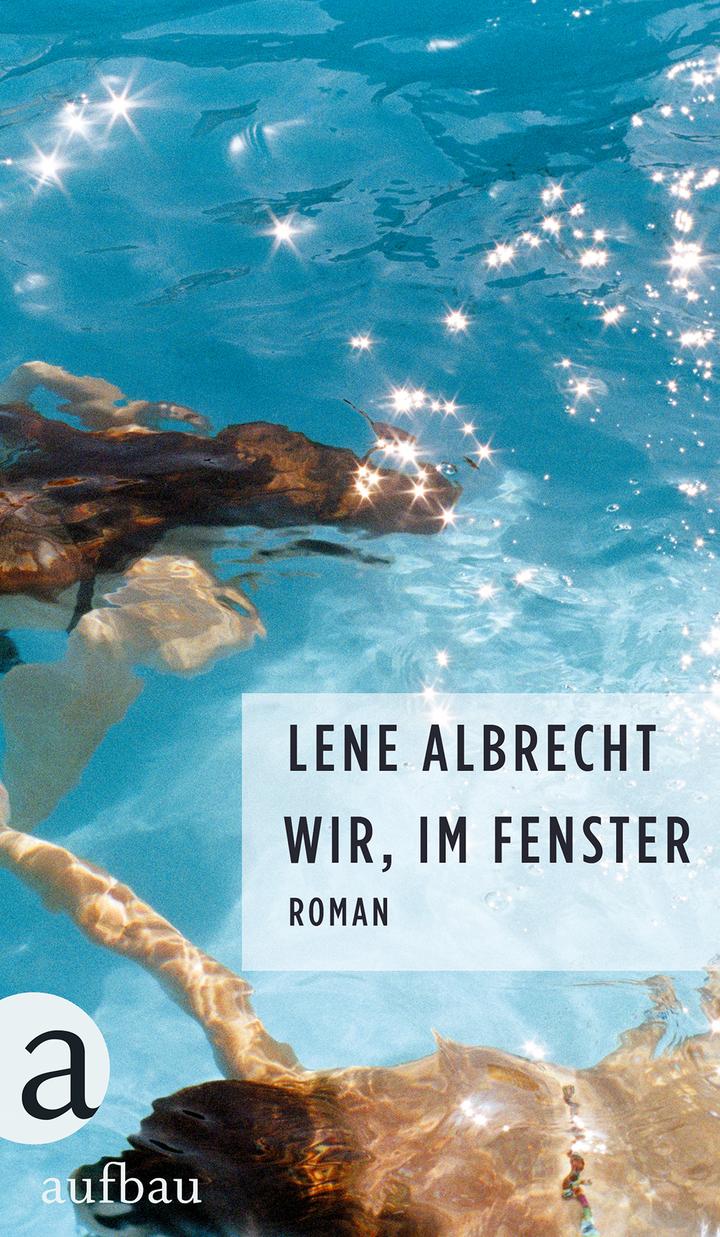
Wir, im Fenster (Affiliate-Link)
Lene Albrecht – Wir, im Fenster (Aufbau Verlag)
Ein Berliner Nachwenderoman mit Coming-Of-Age-Flavor, ein nicht gerade seltenes Sujet in diesen Tagen. Lene Albrecht gibt den bekannten Berlin-Topoi – Brachgelände, Leerstand, improvisierte Orte der Gemeinschaft, Möglichkeiten, Freiheiten, Bohemeleben, aber auch relative und absolute Armut, Verwahrlosung, Brutalität, Drogen und Alkohol – einen eigenwilligen Ton. Ihre Sprache ist gleichsam einfach und direkt, „straßig“, wie in manchen Bildern verdreht, verrutscht wirkend.
„Wir, im Fenster“ folgt der innigen Freundschaft der Erzählerin Linn mit Laila, eine große Liebe unter Mädchen, die manchmal noch Kinder sind. Eine Beziehung, die abrupt endet als Laila von einem Tag auf den nächsten verschwindet. Anderthalb Dekaden später versucht Linn der dahinter liegenden Geschichte nachzuspüren, mit allen Lücken, Selbsttäuschungen, Sackgassen und Neuerfindungen einer fragilen und zutiefst unsicheren Erinnerung. Wie das Geschehene hier rekonstruiert wird, ähnelt mehr einem zerrenden gewaltsamen Entwirren eines Erinnerungsknäuels als einer wohlsortierten Proust’schen Madeleine. Lailas Verschwinden hatte Vorahnungen, Indizien und Anzeichen, die sich nur retrospektiv verdichten. Die „Wahrheit“ ist unspektakulär, traurig und leicht schäbig von Teenager-Grausamkeit und Gleichgültigkeit angefressen.
Es ist also weniger das „was“ als das „wie“ des Erzählens, welches in diesem Buch fasziniert. Die Melange aus Zartheit, Zärtlichkeit und dumpfer Härte, aus Hypersensibilität und Ignoranz, Ennui und künstlicher Aufregung, die für das Erwachsenwerden doch so typisch sind, ist in diesen fragmentarischen Erinnerungen irre gut getroffen. Sie wirkt sehr wahr, nah, lebendig.

Gegen Morgen (Affiliate-Link)
Deniz Utlu – Gegen Morgen (Suhrkamp)
Ein weiterer Roman über ein Verschwinden. Ein weiterer Roman über Berlin. Ein weiteres Dokument unsicherer Erinnerung, flirrender und schwebender Fragmente. Das Zusammenlesen mit Lene Albrechts „Wir, im Fenster“ bietet sich also an. In Deniz Utlus zweitem Roman „Gegen Morgen“ wird allerdings keine Coming-Of-Age-Story erzählt, sondern von den irrlichternden Befindlichkeiten Jungerwachsener aus einem recht unhippen studentischen Milieu, das später zu spießigen Wannabe-Jungunternehmern wird. Es verschwindet auch keine BFF sondern Ramón, ein on/off-WG-Mitbewohner. Ein recht eigenartiger oft eher unsympathisch gezeichneter Kiffer und Schnorrer, ein Besserwisser, der als ewiges fünftes Rad am Wagen agiert. Auch der Erzähler Kara tickt ganz anders als Albrechts Heldinnen. Ein Volkswirtschaftler, der die Welt mit den quantifizierenden Kausalbeziehungen suggerierenden Formeln der Makroökonomie zu begreifen zu machen sucht. Der Geschmack der Vergeblichkeit, der solchen Welterklärungsversuchen in Metaphern des rationalen immer eigen ist, übersetzt sich bei Kara in Melancholie. Der Nähe und Eindeutigkeit meidende, unzuverlässige Ramón fungiert als Gegengewicht. Einer der einfach irgendwie immer mit dabei ist, aber eigentlich nie etwas beisteuert, außer vielleicht eine abweichende Meinung.
Abgesehen von dem, was sie in Erinnerungsfragmenten taten und sagten, erfährt man von den Figuren praktisch nichts. Sie haben keinen expliziten Hintergrund (oder besser den Berlin-generischen von zugezogenen mittlere-Mittelschicht Sprösslingen aus westdeutschen Kleinstädten). Sie haben keine kulturelle Identität und keine Herkunft, allenfalls lassen manche Namen türkische Eltern vermuten – was aber für die Handlung komplett irrelevant ist. Bei Ramón wird etwa in einer Begegnung mit Nazi-Schlägern eine dunkle Hautfarbe und krauses Haar angedeutet, aber auch das spielt bis auf diese Episode überhaupt keine Rolle. Alle Figuren sind trotz ihrer Freundschaften und Liebesbeziehungen isolierte kalte Sterne, deren Trajektorien sich hin und wieder kreuzen. So verschwindet Ramón immer wieder aus dem Leben von Kara und seinen Freunden, taucht wieder auf und verschwindet irgendwann endgültig. Kara macht sich einige Zeit später auf die Suche, wohl aus dem ungreifbaren Gefühl heraus, dass der flatterhafte Ramón etwas ist oder hat, dass ihm dem rationalen erfolgreichen beziehungsfähigen Typen fehlt.
Utlu erzählt von diesem Verschwinden in wohlsortierter bis kunstvoller Sprache und einer vielschichtigen Konstruktion. Allerdings bleibt er auf Distanz zu seinen Figuren. Dieser Roman fühlt sich schon sehr kühl an. Er glitzert und funkelt am Firmament, wie die einsamen Sterne seiner Protagonisten.

Das Licht ist hier viel heller (Affiliate-Link)
Mareike Fallwickl – Das Licht ist hier viel heller (Frankfurter Verlagsanstalt)
Die Salzburger Autorin Mareike Fallwickl hat ein wohlentwickeltes Gespür für Zeitgeistiges. Ihr Debüt „Dunkelgrün, fast schwarz“ arbeitete entlang der Brüche des Provinzlebens, der großen Lebensfragen um das Dableiben-vs-Weggehen. Diese spielen auch in ihrem zweiten Roman „Das Licht ist hier viel heller“ eine Rolle, aber die akutesten Fragen drehen sich hier um Generationengerechtigkeit und Gender mit deutlicher #metoo-Ansprache. Bei Fallwickl handelt es sich hier um das Gegenteil von Bandwagonjumping. Ihre Figuren sind einprägsame, wenn auch nicht gerade angenehme Zeitgenossen.
Im Falle des Bestsellerautors Wenger, der nach ein paar beruflichen und privaten Rückschlägen (sein seit der Neunzigern eingeübtes Schreibrezept funktioniert nicht mehr, seine „Trophy Wife“, die für ihn ihr Studium aufgegeben hat, verlässt ihn für ihren Personal Trainer und macht Karriere als Fitness-Influencerin), Selbstmitleid und Verwahrlosung kultiviert, ist ein hochgradig unangenehmer Charakter, der Name legt nahe, sich den ähnlich klingenden Schlagersänger als Vorlage vorzustellen. Wenger ist ein neureicher Kotzbrocken und ein altmodischer Macker, notorischer Fremdgeher und Egomane. Familie ist für ihn vorwiegend Dekor. Die knapp vor der Volljährigkeit stehende Tochter lädt als zweite Erzählerin des Romans schon eher zur Identifikation ein. Ihr Kampf um Aufmerksamkeit der desinteressierten Eltern, ihre beginnende Selbstreflexion als superpriviligiertes, verwöhntes, aber eher wenig geliebtes Promikind ist spannend mitzuerleben. Fallwickl lässt lange offen, worauf die beiden so unterschiedlichen Charakterstudien hinauslaufen und ob sie irgendwohin konvergieren. Die ungelenken und kaum ernst gemeinten elterlichen Wiederannäherungsversuche verlaufen jedenfalls ziemlich katastrophal.
Ein Katalysator für Veränderung sind die poetischen und wütenden Briefe, die in unregelmäßigen Abständen in der neuen Wohnung des Vaters ankommen. Sie sind an den Vormieter gerichtet, geschrieben von einer Salzburger Buchhändlerin, die schon mit dem Vater zu tun hatte und in einer Lebens- und Beziehungskrise Salzburg gen Mittelmeer verlassen hat. Die Briefe katalysieren die Leben der beiden Protagonisten allerdings ganz anders als erwartet. Keine #metoo-Katharsis mit moralischer Läuterung beim Vater und kein simples Happy End bei der Tochter, sondern der viel lebensnähere Triumph von cleverem Opportunismus beim Vater und – ganz anders die vorsichtige Wiederverbindung der Tochter mit der Welt durch einen vorläufigen Ausstieg aus dieser (the millenial way mit gut gefülltem Trust Fund und Kunsthochschul-Auslandsstipendium). Obwohl niemand so richtig bekommt was sie verdient hätten (im guten wie im schlechten), entlässt einen der Roman erstaunlich zufrieden mit den Geschehnissen. Einfache Moral und Gerechtigkeit, simple Wahrheiten sind hier nicht zu bekommen. Was dem Thema nur angemessen ist.