Pageturner: Literatur im Dezember 2018Joshua Ferris, Rachel Cusk und Sheila Heti
14.12.2018 • Kultur – Text: Frank Eckert, Illustration: Susann Massute
Wer schreibt, der bleibt. Das gilt vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das – er ist unser Pageturner. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. In dieser Folge geht es um die neumodisch altmodischen Kurzgeschichten rund um mittelspießige New Yorker von Joshua Ferris, um die den Alltag dokumentierenden Beobachtungen von Rachel Cusk und um Sheila Hetis metadiskursische Auseinandersetzung mit der Fragen aller Fragen: Kinder, ja oder nein?
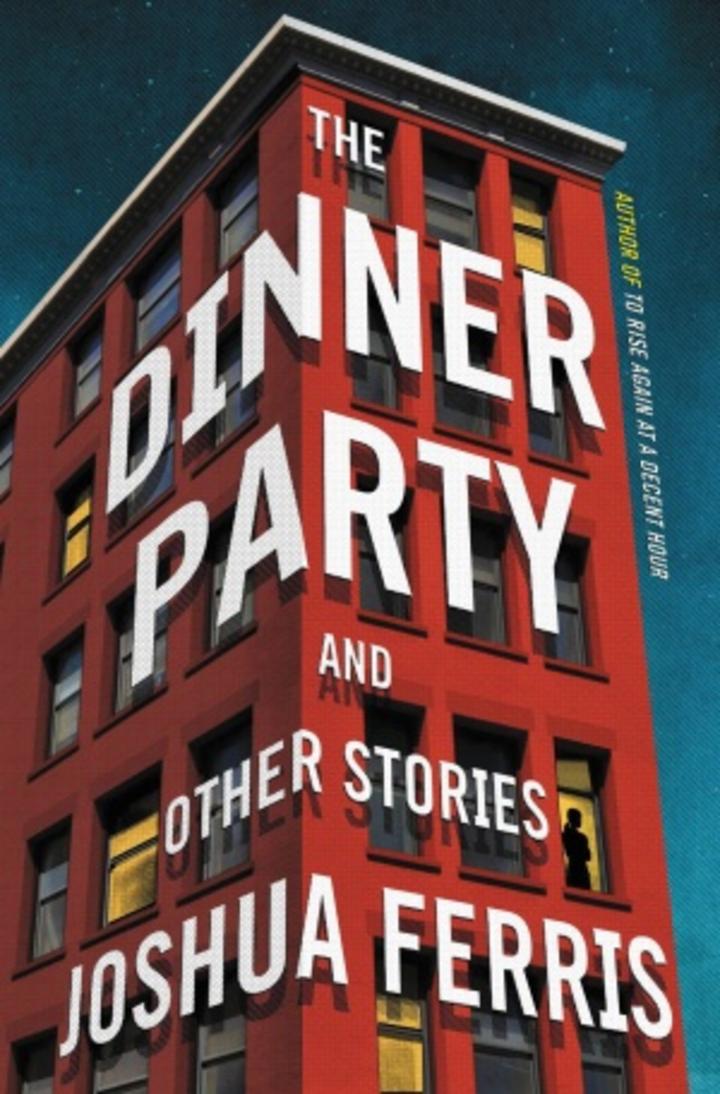
Die deutsche Übersetzung ist unter dem Titel Männer, die sich schlecht benehmen bei Luchterhand erschienen.
Joshua Ferris – The Dinner Party and Other Stories (Little, Brown and Company)
„Love and Marriage, Love and Marriage, They go together like a Horse and Carriage.“ Beim Lesen dieser neumodisch altmodischen Short Storys musste ich mehr als einmal an Frank Sinatras alten Klepper denken. Die Geschichten spielen eindeutig im Hier und Jetzt, fühlen sich aber in den geschilderten gesellschaftlichen Umständen älter an, vielleicht auch zeitloser. So, als wäre Mad Men nie zu Ende gegangen. Sie drehen sich mit wenigen Ausnahmen um das Auseinanderfallen von Ehen, Liebschaften und Beziehungen im Milieu gebildeter, mittelerfolgreicher, mitteljunger, mittelspießiger, mitteloptimierter, mitteldepressiver und seit nicht allzu langer Zeit auch nur so mittelhipsterischer New Yorker. Also größtenteils fest verpaarte heterosexuelle weiße Menschen, die eher zu Dinnerpartys, ins Multiplex-Kino oder in Biergärten als in Clubs gehen. Die über das Kinderkriegen ebenso nachdenken wie über das Ausbrechen aus den sich verfestigenden Lebensstrukturen (in kleinem oder ganz großem Stil), und die immer weniger Freunde haben als Netzwerk-Connections. Diese Szenerie urbaner, gebildeter und liberaler Neo-(Klein-)Bürgerlichkeit seziert und zelebriert Ferris ohne Häme. Die Innenschau dieser egostarken besser gestellten jung verheirateten Jungspießer nervt mitunter doch ordentlich, lässt aber hin und wieder auch erstaunliche Einblicke zu. Etwa wenn in „The Breeze“ aus dem Nachdenken darüber, was wohl mit einem „perfekten“ Frühlingstag anzufangen sei, diverse experimentell-existenzielle und immer böse endende Szenarien erwachsen. Solch urbane Befindlichkeiten und Atmosphären auf den Punkt zu bringen – darin ist Ferris wirklich exzellent.

Die gleichnamige deutsche Übersetzung ist bei Suhrkamp erschienen.
Rachel Cusk - Kudos (Faber)
Nach „Outline“ und „Transit“ ist „Kudos“ der vorerst wohl letzte Band, in dem Rachel Cusk ihre höchst spezielle metapersönliche Form des Geschichtenerzählens auslotet. Die Protagonistin in allen drei Bänden ist eine leidlich erfolgreiche und im Literaturbetrieb halbwegs etablierte Schriftstellerin, deren persönliche Umstände an Cusks Leben orientiert sind, aber (und das ist das Besondere an diesen Büchern) im Text überhaupt keine Rolle spielen. Die Erzählstimme hält sich praktisch vollkommen aus dem Text heraus. Sie gibt nur wieder, was andere Menschen ihr erzählen, ist als „Ich“ ansonsten aber weitgehend unsichtbar. Es ist also eine Prosa, die sich querstellt zu den gerade so erfolgreichen „Ultra-Ich-Sagern“ wie Knausgård. Offenbar aus der bitteren Erfahrung mit ihren zwei quasi-autobiographischen Büchern über Eheleben und Kinderkriegen hat Cusk die biographische Erzählerin aus diesen Texten als aktive Persönlichkeit herausgeschrieben.
Die Erzählerin hört zu, gibt das wieder, was zufällige Begegnungen (wie der Sitznachbar im Flugzeug), Freunde, oder Bekannte ihr erzählen, fragt höchstens mal nach. Die sieben, acht Geschichten, die so wiedergegeben werden, sind dabei höchst kunstvoll arrangiert und nach Art von Novellen um ein alles veränderndes Lebensereignis des Berichtenden arrangiert. Es wäre wohl kein wesentlich schlechteres Buch geworden, wenn Cusk die Geschichten als separate Kurzgeschichten erzählt hätte. So sind sie in eine vage Rahmenhandlung eingebunden (die Erzählerin besucht eine Literaturtagung in einem nicht näher benannten Ferienort irgendwo im südlichen Europa, vermutlich Portugal). Der große Vorteil gegenüber separaten Novellen ist, dass Cusk die Erzählungen, wie es in direkter Rede eben immer mal vorkommt, unterbrechen oder abbrechen kann, ohne fünf britische Pfund ins Postmoderne-Sparschwein stecken zu müssen, also ein fragmentiertes und unvollständiges Erzählen ohne Reue praktizieren kann. Und wie sie das tut, ist nicht weniger als großartig.
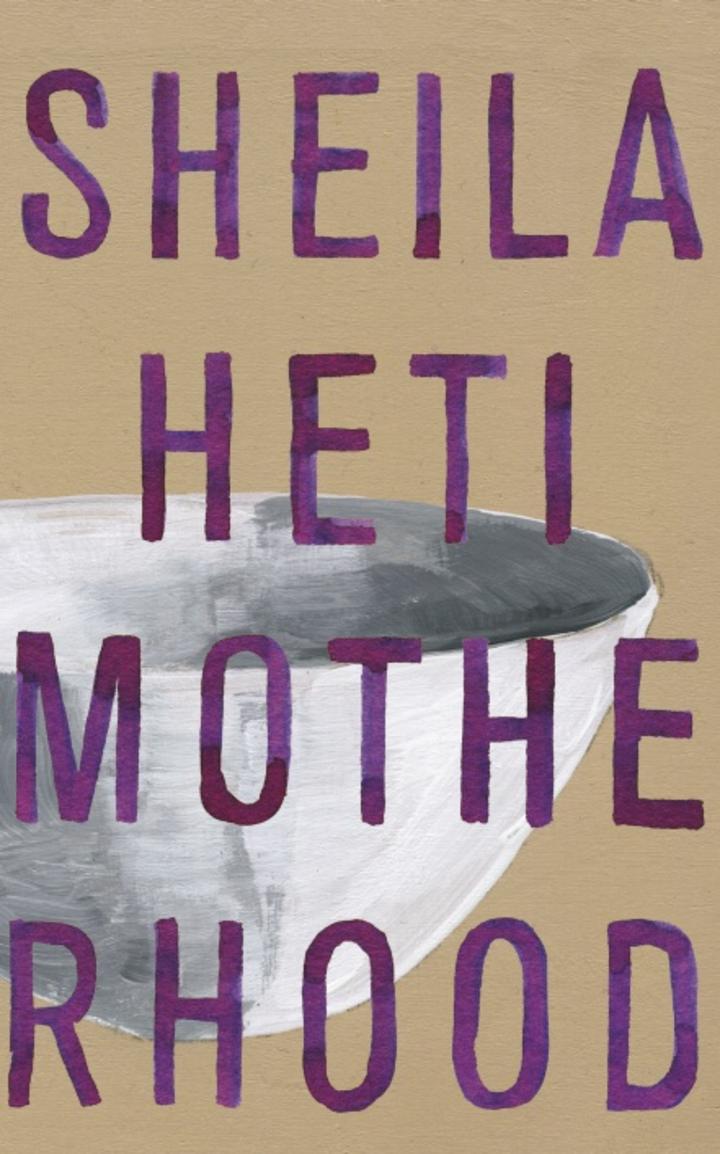
Die deutsche Übersetzung erscheint am 19. Februar 2019 unter dem Titel Mutterschaft bei Rowohlt.
Sheila Heti - Motherhood (Harvill Secker)
Da ist sie wieder, die – wie Rebecca Solnit es so schön formulierte – „Mutter aller Fragen“: „Was? Du willst keine Kinder?“ Eine privat-familiäre Entscheidung zu einem Thema, das zur Zeit ideologisch umkämpft ist wie kaum ein anderes. Dementsprechend vorsichtig geht Sheila Heti mit ihrer persönlichen Betroffenheit um. Der Text ist in mehrere Lagen Metadiskurs eingepackt und verknüpft das Ganze dann noch mit esoterischen (Tarot) und semiesoterischen (I-Ging) Auswürfel-, Denk- und Schreibexperimenten. Dazwischen gibt es aber immer wieder brillante Passagen von schmerzhafter Klarheit. Bezeichnend ist, dass Heti, die mal zu den passiv-aggressiven Späthipstern der „New Sincerity“-Szene (Miranda July, Tao Lin) gezählt wurde, angesichts der persönlichen Betroffenheit und Unsicherheiten hier komplett auf Ironie verzichtet, was sie von ihren literarischen peers deutlich absetzt. Gegen Ende dieses (subjektiv sehr) langen Buchs findet die autobiografische Erzählerin (die wohl mit Heti weitestgehend identisch ist, aber ganz sicher bin ich mir da nicht) in den Biografien ihrer Mutter und Großmutter für sich plausible Gründe, ihre eigentlich schon lange feststehende Entscheidung gegen Kinder zu rationalisieren. Gegen alle Einwände, seien sie ideologischer („Als jüdische Frau musst du dich fortpflanzen, sonst haben die Nazis gewonnen“) oder küchenpsychologischer Natur („Ohne Kinder sind Frauen (und Männer) egozentrisch, verantwortungslos, entwickeln sich nicht weiter, bleiben emotional auf Kinderniveau“).
Zwischen den zahlreichen und ausführlichen Schilderungen ihrer ziemlich uninteressanten Träume, den Eso-Ausflügen und den kleinlichen Streitereien mit ihrem Boyfriend braucht es einige Willenskraft, hier durchzuhalten. Aber es lohnt sich. Wenn die Erzählerin dann jedoch ernsthaft über ihr Thema nachdenkt und ihre Prioritäten sortiert, ist es meist großartig und tatsächlich ziemlich ungeschönt ehrlich. Heti füllt Solnits kurzen theoretischen Essay über die „Mother of all questions“ mit individuellen Details und macht ihn psychologisch plausibel. Das ist die nicht wegdiskutierbare Stärke dieses Textes. Durch den wenig hilfreichen Rest muss man als Leser einfach durch. Es lohnt sich allemal.






