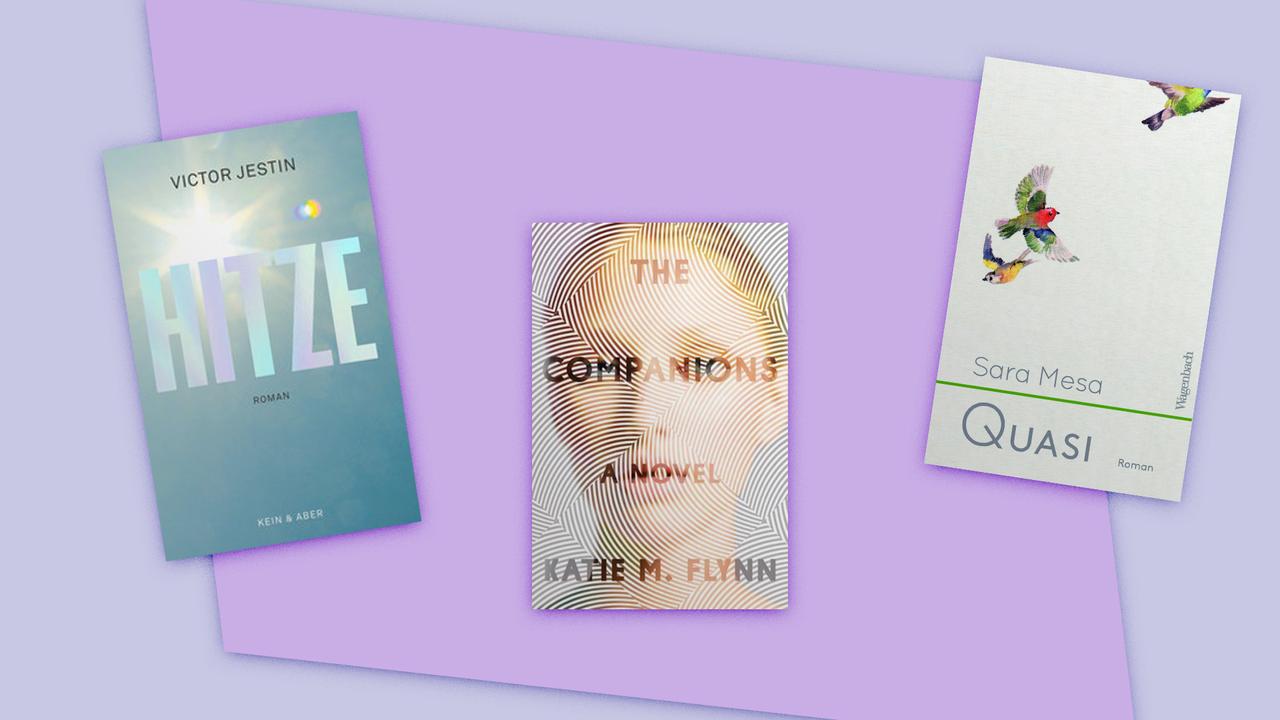Pageturner – Literatur im Dezember 2020Emmanuelle Bayamack-Tam, Mike McCormack, David Mitchell
2.12.2020 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Wer schreibt, der bleibt. Vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist der Pageturner und versorgt uns jeden Monat mit Reviews seiner literarischen Fundstücke. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Im Dezember empfiehlt er Emmanuelle Bayamack-Tam, Mike McCormack und David Mitchell. Eine Kommunen-Dystopie, einen großen Wurf im Stil von James Joyce in nur einem Satz und den neuesten Coup des literarischen Fantasy-Überfliegers. Es geht um Musik. Passt.
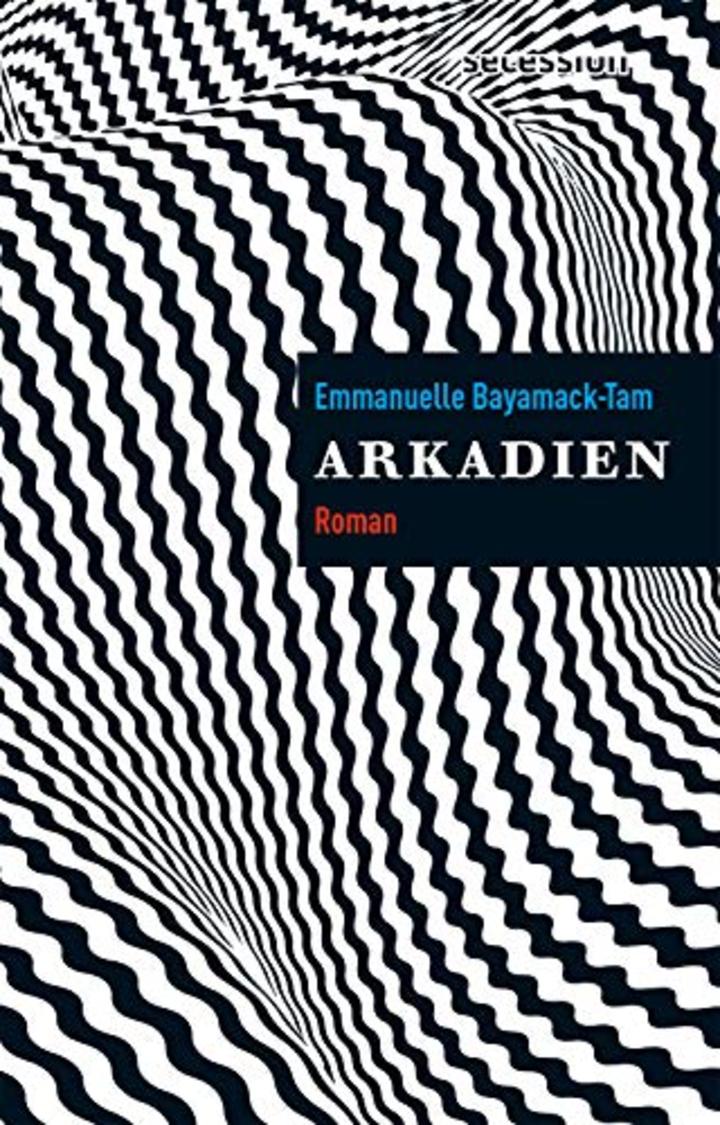
Arkadien – Affiliate-Link
Emmanuelle Bayamack-Tam – Arkadien (Secession)
Omnia vincit amor. Liebe besiegt alles. Sogar eine Kindheit unterm Alu-Hut. Ins „Liberty House“, einer ehemaligen Klosterschule für Mädchen und jetzt neuzeitlich Selbstversorger-Kommune, haben sich die hypersensible, gegen Elektrosmog und auch sonst gegen alles allergische und schwer depressive Mutter, der Blumen liebende Vater, die exzentrisch egomanische Ex-Model-Großmutter, mit der sechsjährigen Farah zurückgezogen, um in einer internetfreien Post-Hippie-Idylle zu leben. Finanziert von einer exzentrischen steinalten Millionärin. Als Farah sich mit 14 unsterblich in Arkady verliebt, den spirituellen Führer der Kommune, setzt das eine interessante Dynamik in Gang, die nicht dem erwarteten Drama-Schema folgt und doch dramatisch endet. Farah ist intersexuell, verharrt im weder-noch und lernt, durchaus nicht ohne Schmerzen, dies als genetische Gabe anzunehmen. Als Selbstverständlichkeit, nicht als Mangel oder Syndrom. So entsteht eine Utopie von (durchaus auch sexuellem) „Companionship“, wie sie Donna Haraway sich nicht besser hätte vorstellen können. Man darf der Normalität eben niemals trauen. Und doch bleibt diese Utopie prekär und temporär. Sowohl in der vorsichtig tastenden Suche Farahs nach einer Identität, die nicht nur ihr Geschlecht und ihren Körper betrifft. Die äußeren Umstände und die uneingestandenen inneren Konflikte der Kommune setzen dem ebenfalls zu. Dieser derb zarte eigenwillige Roman endet mit gemischten Gefühlen, einer Art inversen Emanzipation – aber mit der tröstlichen Gewissheit, dass es Liebe wirklich gibt.
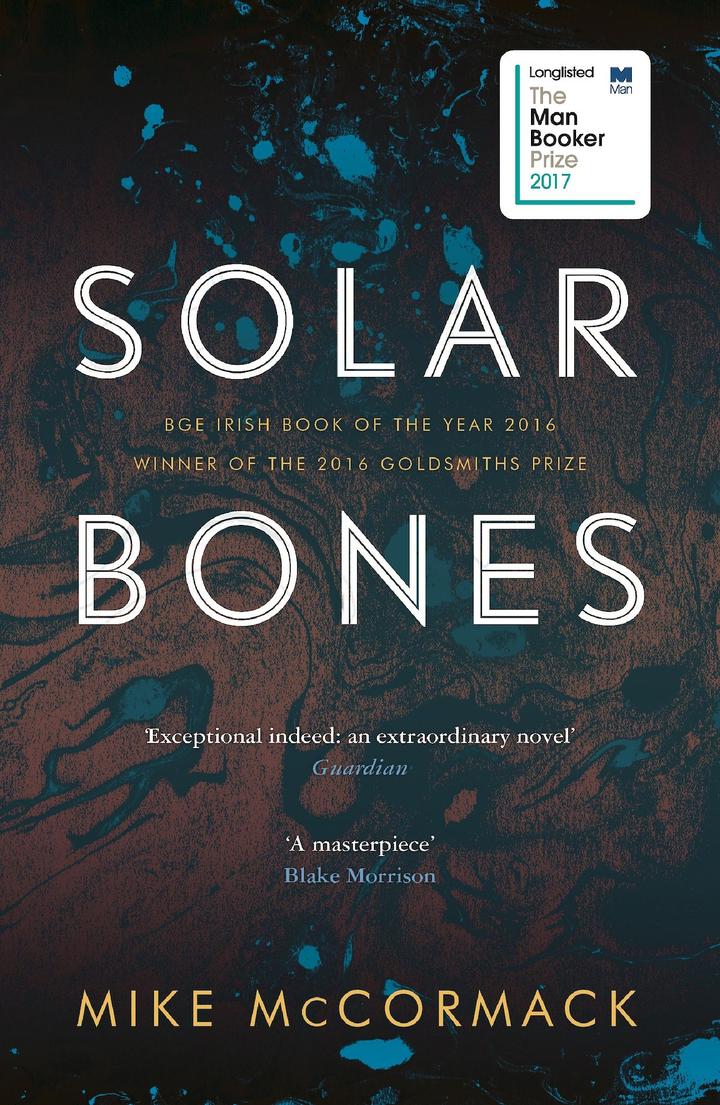
Solar Bones – Affiliate-Link | Ein ungewöhnlicher Roman über einen gewöhnlichen Mann – Affiliate-Link
Mike McCormack – Solar Bones (Canongate)
Der Ire Mike McCormack ist der experimentelle Liebhaber des Morbiden in der Morbides liebenden irischen Literaturwelt. Was formale Modernismen angeht, ist „Solar Bones“ auf jeden Fall ganz weit vorne. Das Buch ist ein einziger Satz, der von Assoziation zu Erinnerung zu Assoziation springt und wieder zurück. Und das, ohne deswegen besonders sperrig oder schwer lesbar zu sein. Es ist der zweite November, der Tag der Toten, an dem die Membran zwischen dem Lebenden und dem Vergangenen besonders durchlässig ist. Ein Mann mittleren Alters, Ingenieur beim Bauamt, steht in der Küche seines Hauses in irgendeinem Kleinstadt-Vorort. Er schaut aus dem Fenster und erinnert sich – an sein Leben, an seine Lieben, an Belangloses und die großen Themen des Lebens. Im Pathos und hohen Ton wie in der Alltäglichkeit der Begebenheiten, die reminisziert werden, generell in der poetischen, manchmal philosophisch grundierten, manchmal derben Sprache ist es fast unmöglich, nicht an den prominentesten Schreiber des Landes zu denken. Vor allem zu Beginn rufen die „Solar Bones“ James Joyces „Dubliners“ in Erinnerung, insbesondere „The Dead“, diese täuschend einfache aber Familien-, Generationen-, Stand- und Landesgeschichte umgreifende Story unendlicher Melancholie. McCormacks Geschichte ist aber definitiv von heute, in der Sprache wie in den ebenfalls täuschend trivialen Gedankensprüngen des Protagonisten. Ein krasser Trip durch ein Leben, das man profan nennen müsste, wäre sein Protagonist nicht so ein aufmerksamer sensibler Mensch, der die charakterlichen Klischees seines Berufs immer wieder widerlegt. Es ist gleichermaßen eine wunderschöne, leicht morbide Geistergeschichte. Es gibt einiges zu verstehen, aber das ist nicht die Stärke dieses beeindruckenden Romans. Es gilt vielmehr, sich einfach im Gedankenstrom treiben zu lassen, aufzunehmen und anzunehmen, was vorbeikommt, ohne es festhalten zu wollen.
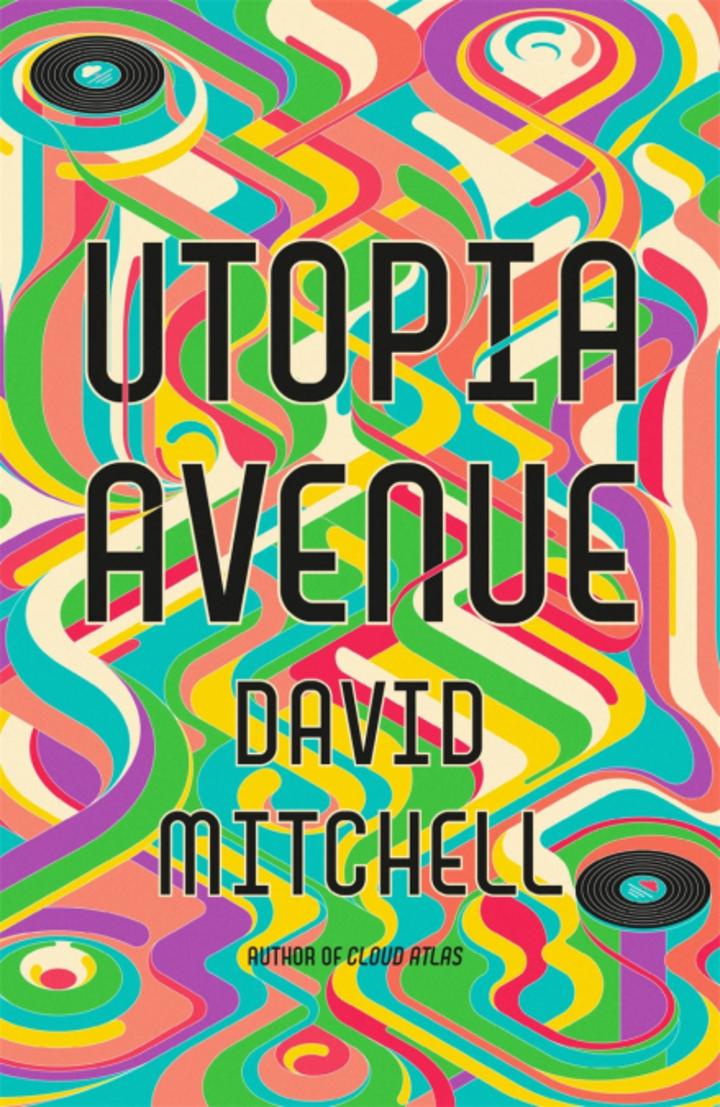
Utopia Avenue – Affiliate-Link
David Mitchell – Utopia Avenue (Sceptre, 2020)
Ein straight und chronologisch erzählter Roman über den Aufstieg und Fall einer knapp am Weltruhm vorbeigeschlitterten psychedelischen Rockband namens „Utopia Avenue“ in London, Ende der sechziger Jahre, von David Mitchell? Jein, die Ballade von der Band und die zahllosen Episoden und Cameos ungefähr aller legendären Rock-, Folk- und Blues-Stars der Swinging Sixties machen schon den größeren Teil der (nur) 555 Seiten aus. Die Mitchell-üblichen Querverbindungen zu seinen anderen Büchern fehlen allerdings keineswegs, hier ein wenig „Cloud Atlas“, da etwas „The Bone Clocks“ und einiges an „The Thousand Autumns of Jacob de Zoet“, dieser interessanten Mischung aus historischer Fiktion (der Roman spielt in der holländischen Exklave Deshima im Japan des späten 18. Jahrhunderts) und Fantasy (mit Seelenwanderung, guten und bösen Unsterblichen und jeder Menge quasi-wissenschaftlichem Brimborium). „Utopia Avenue“ liefert sogar so etwas wie einen Abschluss einiger offen belassener Handlungsfäden in den Tausend Herbsten und den Knochenuhren. Leider verdichtet sich die Band-Historie nie zu einer ernsthaft faszinierenden Gesamtgeschichte, so dass das Buch trotz Unmengen von zeittypischen Vignetten im Ambiente der Londoner Swinging-Sixties und clever eingestreuter Anachronismen sehr langatmig wirkt. Mitchell kann schreiben (ich würde das mal als „gehobener Mainstream“ in Fantasy bezeichnen), und er kann formidabel fabulieren, das ist keine Frage. Nur franst hier die Erzählkunst zu oft in belanglose Anekdötchen mit toten Rockstars ab. Muss man nochmal erzählt bekommen, dass die New Yorker Freiheitsstatue in echt viel kleiner ist, als sie auf Bildern wirkt? Leider wird das Thema und die nette Geschichte mit ihren sympathisch planlosen Akteurinnen und Akteuren so etwas verschenkt.