Pageturner: Literatur im Dezember 2019Elvia Wilk, Carmen Buttjer, Jackie Thomae
4.12.2019 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute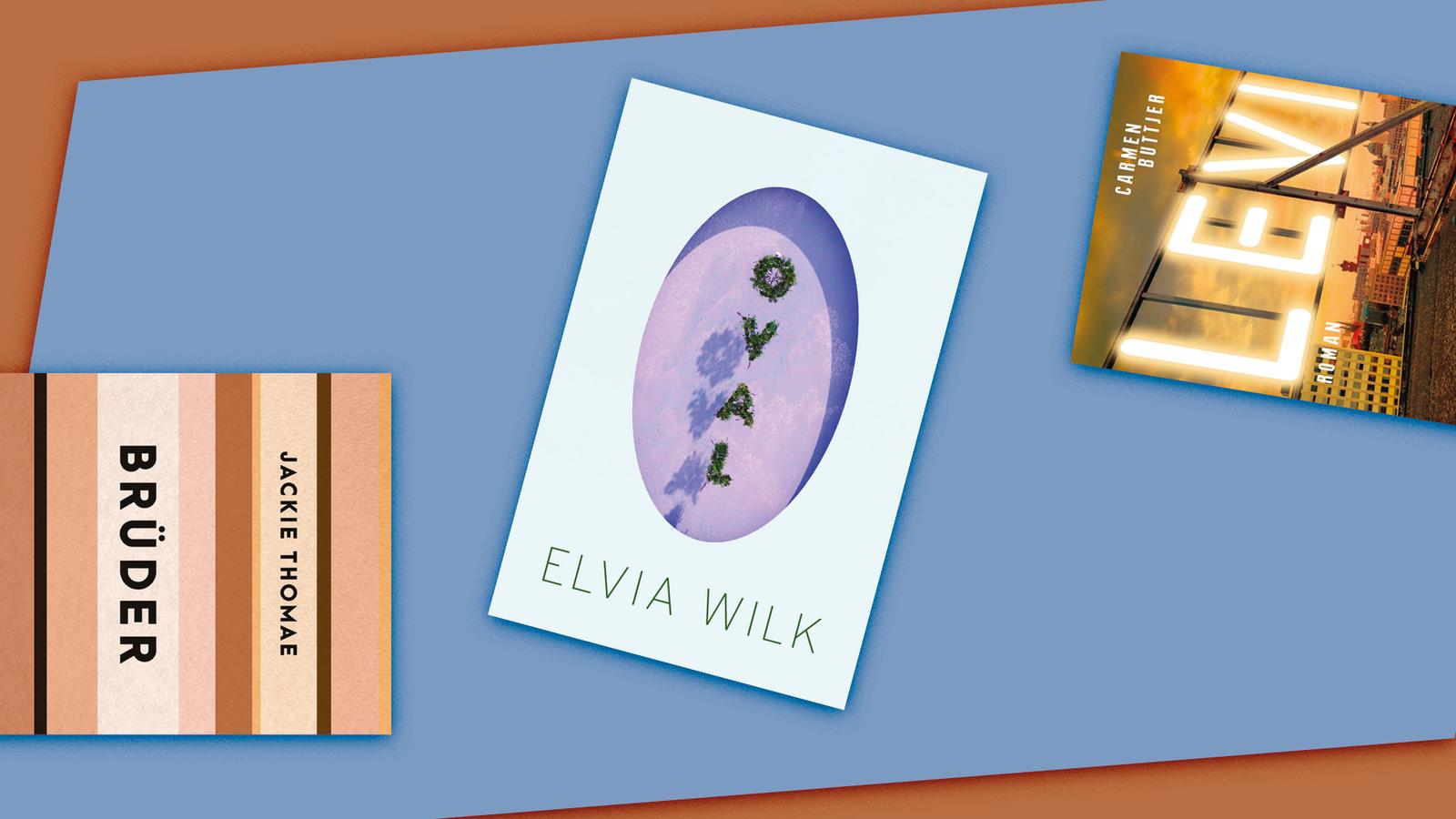
Wer schreibt, der bleibt. Das gilt vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist unser Pageturner. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Für den Lesestoff im Dezember blickt Eckert zunächst Elvia Wilks Berlin-Dystopie „Oval“, die zwischen Großkonzernen und neuen Drogen gar nicht so dystopisch, sondern eher real erscheint. Auch Carmen Buttjer lässt ihren Roman „Levi“ in Berlin spielen, sucht in der Sommerhitze aber nach den stillen und wichtigen Geschichten zwischen Trauer und Vergessen. Und dann ist da noch „Brüder“ von Jackie Thomae. Auch dieses Buch streift Berlin, dreht sich dabei jedoch um Identitätsfragen zweier Halbbrüder aus der DDR, deren Vater zufällig nicht weiß war. Die Fremde hat so viele Gesichter. Und hört auch mit dem Ende eines Systems nicht auf.

Oval (Afflilate-Link)
Elvia Wilk – Oval (2019)
Berlin in einer nahen Gegenwart. „Peak Oil“ und „Peak Rent“ sind bereits durch, und wer sich die Stadt noch leisten kann sind Corporate Executives und Trust Fund Kids, gerne US-amerikanische Expats, die dem Versprechen der Stadt nachgezogen sind, hier ein kreatives Partyleben zu führen. In einer Umgebung, die einerseits vollständig von transnationalen Konzernen und NGOs kontrolliert wird (hier mit sprechenden Namen wie „Finster Corp.“ und „RANDI“), andererseits vom Versprechen auf Nachhaltigkeit und psychosozialer Gesundheit umgetrieben wird, einer Art post-neoliberalen agilen „Zukunftsverantwortung Lite“.
Die beiden Hauptfiguren: Erzählerin Anja, elternvermögende Deutschamerikanerin und Wissenschaftlerin in der R&D Abteilung von Finster, und Louis, Expat aus dem mittleren Westen der USA, Pressesprecher für den disruptiven Think-Tank Basquiatt, ebenfalls Finster-owned. Die beiden wohnen 100 % sustainable im Living-House-Project „The Berg“, das langsam zu Dysfunktionalität verrottet – hauptsächlich weil sich die Bewohner nur ungenügend an die Nachhaltigkeitsvorgaben halten. Anja forscht an Pilzen, aus denen durch gerichtete Evolution und Biomodulation Baustoffe werden sollen, letztendlich selbstwachsende Häuser. Louis‘ Institut entwickelt eine Pille (die titelgebende Oval), die temporären Altruismus hervorruft. Anjas Projekt wird trotz oder wegen des absehbaren Erfolgs abrupt eingestellt und ihre Abteilung in obszön gut bezahlte Bullshit-Jobs abgeschoben. Währenddessen „leakt“ Louis‘ Oval, das prompt zur Berliner Partydroge Nr.1 wird, mit ungeahnten Reboundeffekten.
Elvia Wilk, ebenfalls US-amerikanische Expat in Berlin und Autorin für diverse Kunst- und Lifestyle-Publikationen, hat ihr Debüt als spekulative Farce angelegt, die extrem tiefenscharf in die finsteren Untiefen der Sustainable-Corporate-Welt hineinsieht, und die ultimative Ökonomisierung von Emotionen und Kreativität heraus seziert. Wilks Protagonist*innen sind allesamt super smart, super cool, identitätsfluid und selbstverständlich neoliberalismuskritisch, selbstironisch und bis in den innersten Wesenskern „complicit“ mit der Situation, eben weil sich jede(r) für ungemein subversiv und disruptiv hält. So sind die ersten zwei Drittel des Buches die Loops und Iterationen dieser um sich selbst und ihre Beziehungen kreisenden Bessergestellten schwer erträglich, bis langsam klar wird, wie alles zusammenhängen könnte und der Ton dunkler wird (aber immer mit einem souveränen Smile im Gesicht, uns kann ja nichts passieren). Denn letztlich dürfte auch der apokalyptische heiße Abriss der Stadt nur eine minimalinvasive disruptive Maßnahme im Rahmen der unternehmerischen Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit sein. Eine Business Solution, die Berlin von Obdachlosen und veralteter Bausubstanz „befreit“ und durch Gewünschteres ersetzt.
Was Menschen umtreibt, die in solchen Corporate Creative Filterblasen leben, kennt der Roman bis ins kleinste Detail: die Nöte und Worries der abgesicherten kosmopolitischen „Anywheres“ zwischen Tokenism, Privilege Shaming, Gym-Body Politics und Object Oriented Ontology. Das macht den Text weniger zu spekulativer Fiktion als zu einem superschlauen, superkalten und superzeitgeistigen Zeitdokument. „You're so of the moment“ sagt einmal ein Charakter zum anderen. Das gilt ganz besonders für den Roman selbst. Gut möglich, dass das Buch ähnlich schlecht altert wie „Bright Lights, Big City“ oder „Bonfire of the Vanities“, aber gerade eben jetzt ist es definitiv was zu lesen, um die Gegenwart (des wohlhabend jungsmarten Westens) zu verstehen.
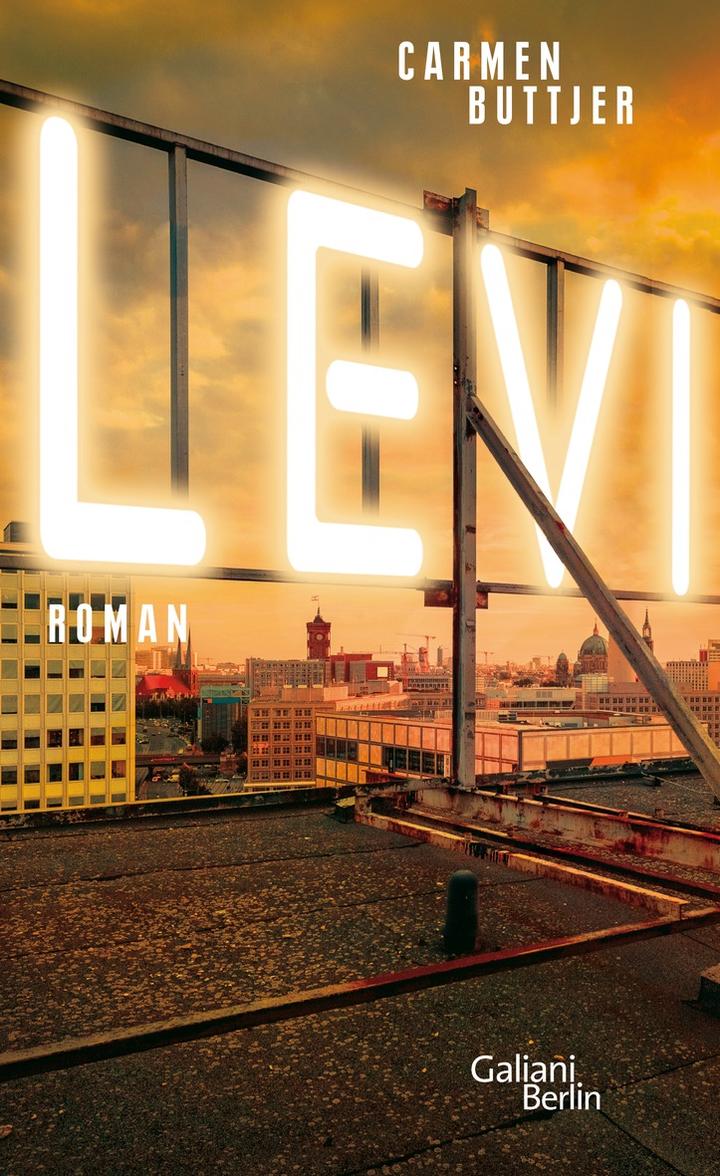
Levi (Affiliate-Link)
Carmen Buttjer – Levi (2019)
Noch ein Berlin-Roman. Einer, der in so ziemlich jeder Hinsicht das Gegenteil von Elvia Wilks „Oval“ darstellt. Mit ein wenig magischem Realismus zwar, aber nicht spekulativ, ziemlich jetztzeitig, aber schwer melancholisch in Erinnerungen vertieft. Vor allem nicht über-clever geschwätzig, sondern vielmehr langsam, behutsam und sanft. Erzähler und Hauptfigur ist der elfjährige Levi, der mit dem gewaltsamen Tod seiner Mutter umgehen muss. Der Vater, mit dem Levi nicht wirklich kommunizieren kann, ist keine Hilfe. So klaut er auf der Beerdigung die Asche der Mutter und reißt von Zuhause aus. Gar nicht weit weg, nur auf das Dach seines Wohnhauses, wo er bei vierzig Grad im Schatten zeltet – es ist einer der Hitzesommer der vergangenen Jahre. Hilfe und Verpflegung bekommt er von zwei Hausgenossen, Vincent, einem tagträumerischen Drifter und Spieler, und dem Kioskbesitzer Kolja aus dem EG, einem traumatisierten ehemaligen Kriegsreporter und Fotografen aus Prag und zweiter Erzähler des Romans.
Es geht im Buch also um Trauer und Erinnerung, um das Metaphorische am Leben erhalten und Vergessen seiner Lieben, zudem um das Scheitern von Kommunikation, das nicht miteinander Reden (können). Vor dem omnipräsenten lebensnah geschilderten Hintergrund der stickigen, überhitzten und langsam vor sich hin rottenden Stadt versuchen die Protagonisten, mit sich und ihren Verlusten klarzukommen. Das ist ganz langsam und unspektakulär erzählt, mit großer Sympathie für die beschädigten Leben und ihren unbeholfenen Umgang mit dem Tod. Ein wunderschön geschriebener „slow burner“, der im Gegensatz zu so manch anderer cooler Hauptstadtliteratur lange nachhallt. Ein interessanter Aspekt der Erzählung ist, dass die Familie, um die es geht, offenbar jüdisch (und wohl auch gläubig) ist, dies aber im ganzen Roman nicht die geringste Rolle spielt. Diese hundertprozentige Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens im Deutschland von heute hat gegen alle Evidenz eine beinahe utopische Qualität.
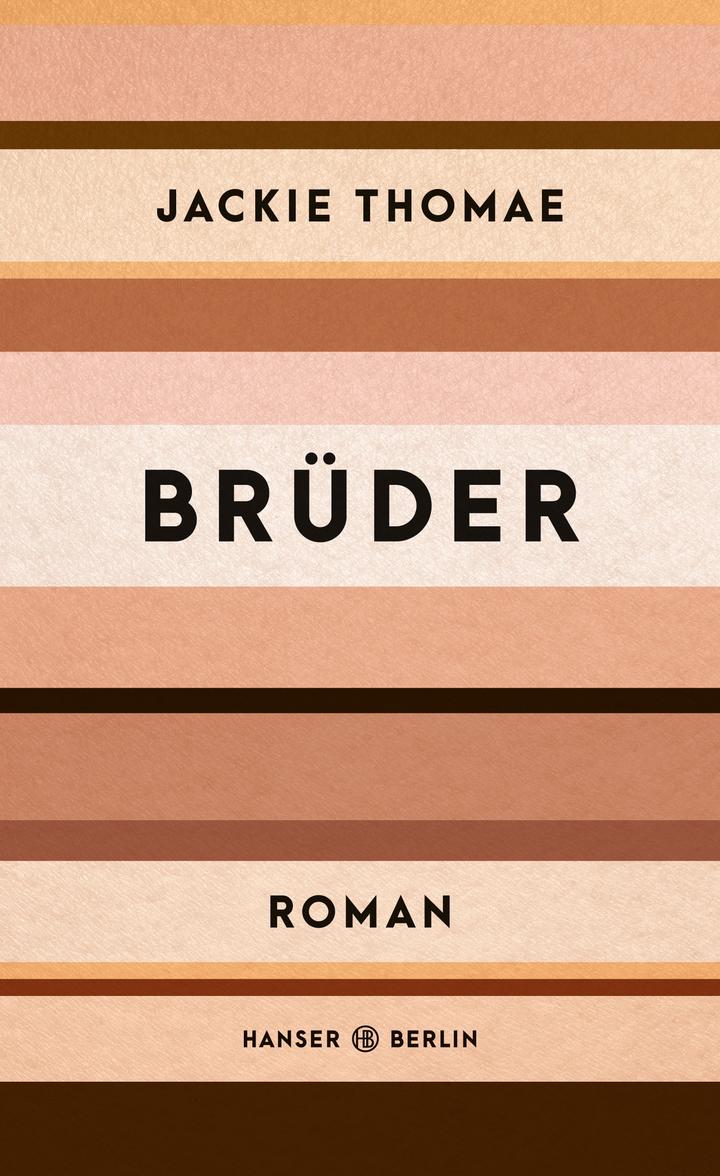
Brüder (Affiliate-Link)
Jackie Thomae – Brüder (2019)
Halbschwarz, Afrodeutsch und noch dazu mit einer alleinerziehenden Mutter in der DDR aufgewachsen – wo führt ein solches Leben hin? Jackie Thomae, die als DDR-Kind eines afrikanischen Medizinstudenten eine vergleichbare Biografie aufweisen kann, stellt zwei Versuchsanordnungen auf, die gegen alle Hypes gerade nicht autofiktional daher kommen: Die Stories zweier Halbbrüder, zwei Jahre auseinander, die nichts von einander wissen und praktisch nur den abwesenden Vater gemeinsam haben. Auf je 200 Seiten erzählt einmal Michael „Mick“ aus den Neunzigern, die er nachtaktiv in Berlin verbracht hat: als „professionelles Feierschwein“, Clubbetreiber, Sportler, Frauenheld und generell unterhaltsamer Typ, bis er sich nach einem schweren Unfall fast taub zur Jahrtausendwende und seinem 30. Geburtstag seinen Zukunftsängsten stellen muss. Micks Geschichte ist im Präsens erzählt, schnell, leicht und mit vielen tollen Vignetten und flach/tiefen Einsichten aus dem Nachtleben. Wie es eben so war, kurz vor dem Ernst des Lebens. Das Interessante an diesem Teil des Buches ist die lässige Selbstverständlichkeit Micks, sein souveräner Umgang mit den extraschwierigen Themen Identität, Heimat und Rassismus. Wie einfach und klar doch das Komplizierte sein kann und doch nicht stumpf oder vereinfachend.
Die zweite Hälfte handelt von Gabriel, dem ziemlichen Gegenteil Micks. Er ist ein in London lebender Stararchitekt, Kosmopolit, Workaholic und Superstreber in so ziemlich jeder vorstellbaren Hinsicht. Ein klassischer Oreo, wie er sogar von seiner afrikanischen Frau Fleur mal genannt wird. Sein übertrieben rationaler und unsensibler Umgang mit anderen Menschen verwickelt ihn in eine #metoo-Geschichte mit einer seiner Studentinnnen. Von dieser einschneidenen Begegnung an wird Gabriels Geschichte in Rückblicken erzählt, zum Glück nicht nur von ihm selber, sondern in gleichen Teilen von der im Vergleich zu ihm schon sehr lässigen Fleur. Hier wird also ein nochmal anderer Blick auf Identität geworfen, auf das Fremde in sich Selbst und in den Menschen, mit denen man sich umgibt. So elegant und leichtgängig wie in diesem durchgehend wunderbaren, definitiv nicht zu langen Wälzer wird das selten erzählt.








