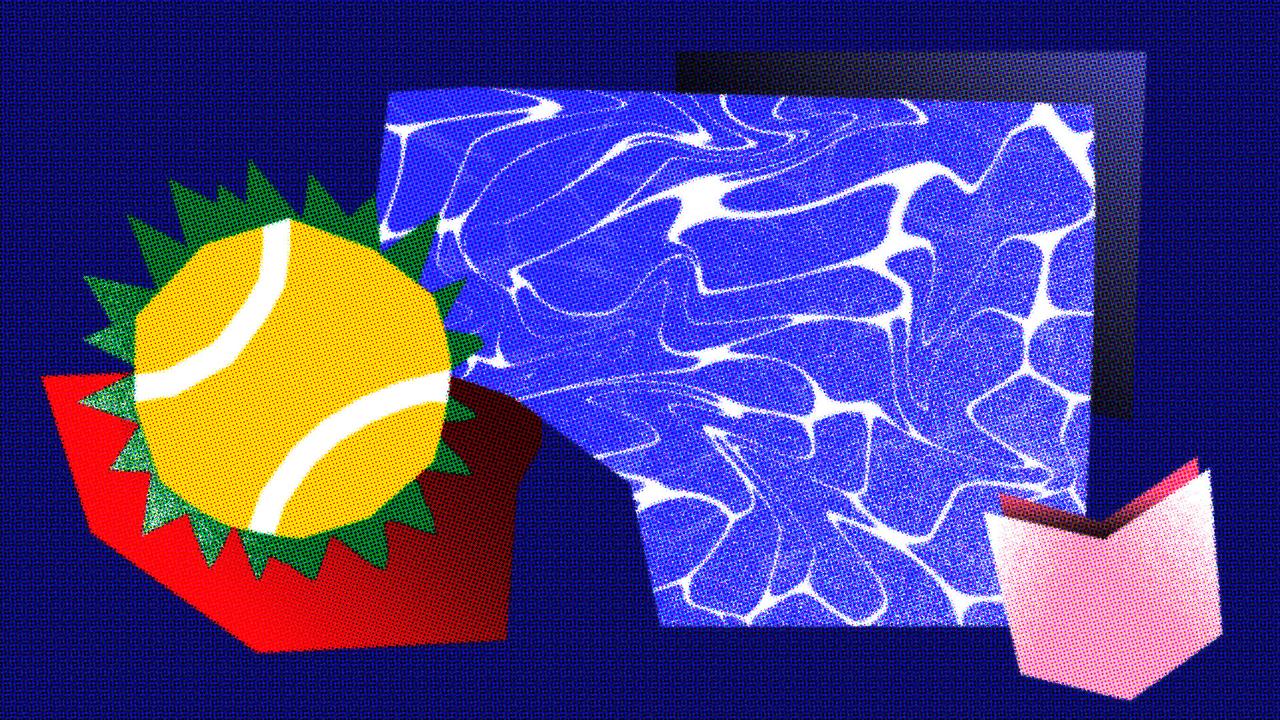Pageturner – Literatur im August 2022Ben Tarnoff, Amrei Bahr & Kristin Eichhorn & Sebastian Kubon und: Yasmine M'Barek
1.8.2022 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Bücher, Texte, Geschichten. Das sind Deep-Dives ohne Marketing-Konnotation und auch keine Longreads mit Like-Clickbait. Wer schreibt, der bleibt. Frank Eckert ist der Pageturner der Filter-Redaktion und inhaliert Monat für Monat zahllose Bücher. Ob dringliche Analysen zum Zeitgeschehen oder belletristische Entdeckungen – relevant sind die Werke immer. Was bietet sich für den August – die Sommerpause – an? Krimis oder anderes „Leichtes“? Nicht zwingend. Ben Tarnoff untersucht in „Internet For The People“ Möglichkeiten, das Netz wieder zu demokratisieren. Das Autor:innen-Trio Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon beleuchtet in „#IchBinHanna“ die prekären Berufsperspektiven in der Academia. Und Yasmine M'Barek fordert in „Radikale Kompromisse“ einen neuen gesellschaftlichen Dialog auf allen Ebenen.
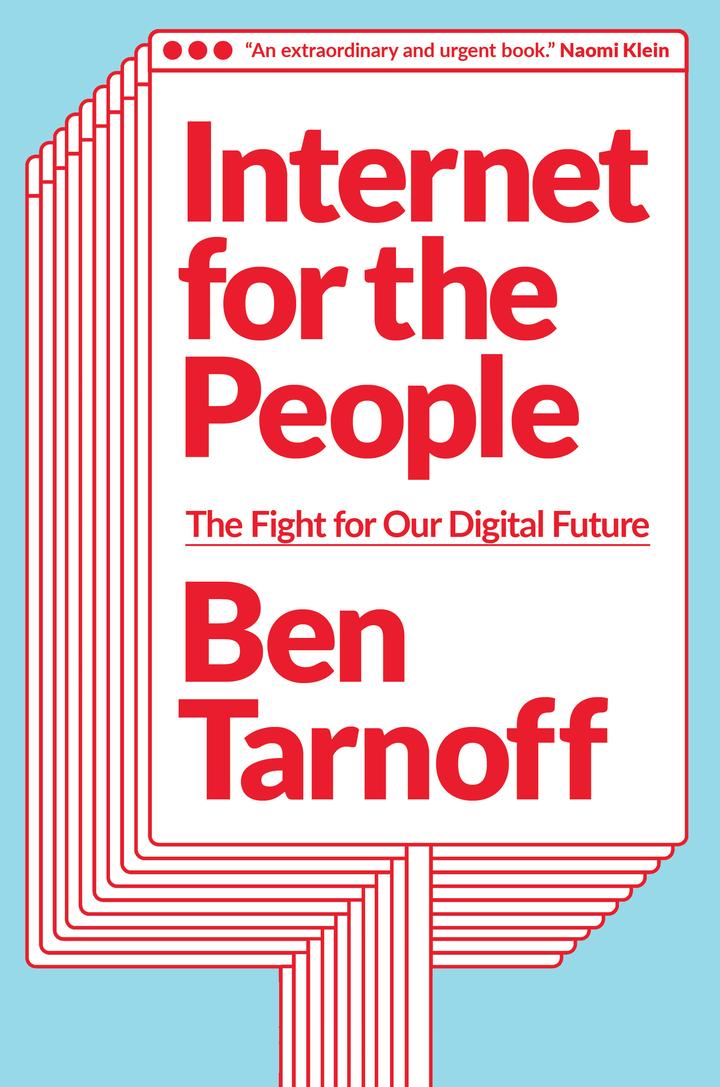
Internet For The People (Affiliate-Link)
Ben Tarnoff – Internet For The People (2022)
Thema Internet, hier mal für die Leute. Ben Tarnoffs erfreulich konzentriert und knapp gehaltenes Buch beleuchtet den Aspekt der Privatisierung des Internets. Als Gründer des Logic-Magazins und persönlich involvierter Kommentator der kalifornischen Tech-Worker-Szene ist Tarnoff schon beruflich sehr nahe am Thema.
Wie kam es dazu, dass zwar einerseits die verwendeten Software- und Kommunikationsstandards (wie TCP/IP und HTTP) offen sind, aber die Kontrollinstanzen (wie die IP-Adressen-Vergabe) und der größte Teil der Hardware-Infrastruktur bei einer sehr überschaubaren Anzahl von Konzernen liegt, die alle in den USA sitzen? Und das, wo aktuell 93 % der Nutzer:innen außerhalb der USA leben? Die Historie ist ziemlich gut dokumentiert, wenn auch heute von so manchen Mythen überformt, die eventuell vergessen machen, dass die Privatisierung der mit immensen staatlichen Mitteln von der National Science Foundation aufgebauten Infrastruktur von der Clinton-Regierung massiv forciert und von keiner der nachfolgenden Administrationen zurückgenommen wurde (von der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA ließe sich ja eine ganz ähnliche Geschichte erzählen). Was hat das für Folgen für uns alle? Was lässt sich gegen die malignen Effekte der Privatisierung in Oligopole/Kartelle tun? Kurz gefasst: Kann das Internet wieder demokratisiert werden?
Tarnoff beantwortet dies vorsichtig mit Ja – ohne allzu große Illusionen darüber zu haben, wie weit diese Re-Demokratisierung gehen kann. Weder Horrorszenarien noch Utopien sind wahrscheinlich. Und am Wenigsten weiter bringt uns die Nostalgie nach den Zeiten, in denen das Internet noch akademischer, übersichtlicher und weißer war, als Metapher für die Außenposten, Exploration und heroische Pioniertaten herhalten musste. Was praktisch möglich ist, zeigt Tarnoff an einigen interessanten Beispielen von abgelegenen ländlichen und/oder armen Gemeinden wie in Chattanooga (Tennessee), Nelson County in North Dakota oder einem benachteiligten Stadtteil von Detroit. Communitys, die, jahrzehntelang von den großen ISPs ignoriert, alle ihre eigenen Services aufgebaut haben – mit Angeboten, die allesamt preisgünstiger sind und eine schnellere Anbindung bieten als die kommerziellen Angebote in den Metropolen. Auf solch kommunaler Ebene in lokalen Enklaven ist eine Vergemeinschaftung des Internets bereits eine reale Option. Klar wird aber ebenso, dass dieser „Localism“ allein nicht genügt – und auch selbst Risiken birgt. Und auf dem Niveau der großen Plattformen wird es weit schwerer, etwas zu verändern. Unmöglich ist es jedoch nicht. Diesen unerwartet optimistischen Schluss führt dieses realpolitisch-pragmatische Buch absolut plausibel.

#IchBinHanna (Affiliate-Link)
Amrei Bahr, Kristin Eichhorn, Sebastian Kubon – #IchBinHanna (2022)
Ein Suhrkamp-Sammelband zur deutschen Arbeitswelt, diesmal zum akademischen Prekariat. Der titelgebende Hashtag #IchBinHanna bezieht sich auf ein Video des BMBF, in dem das geltende Wissenschaftszeitvertragsgesetz als Mittel gegen die „Verstopfung“ von Stellen an Universitäten und staatlichen Forschungseinrichtungen durch Nachwuchswissenschaftler:innen gerühmt wird. Gegen jede Evidenz wird hier behauptet, Fluktuation schaffe Innovation. Die Fluktuation ist politisch gewollt, sogar forciert: Die Befristung der Arbeitsverhältnisse kann durch die im guten Behördendeutsch „WissZeitVG“ genannte Regelung im akademischen Bereich länger angewendet werden als in jeder anderen Berufssparte – bis zu zwölf Jahre, dank Sonderregeln sogar noch länger.
Ob danach je eine der seltenen Tenure-Professuren oder gar eine der noch rarer gewordenen Festanstellungen im akademischen „Mittelbau“ erreicht werden kann, bleibt offen. In dieser Hinsicht funktioniert der universitäre Wissenschaftsbetrieb eher wie die viel geschmähte Gig-Economy der Fahr- und Lieferdienste oder Clickworker. Happy End nach einer Dekade an Qualifizierung und Spezialisierung? Eher unwahrscheinlich. Mit dem Effekt, dass sich einerseits die beschworene „Exzellenz“ kaum noch einstellen mag: Jobs in der Industrie sind paradoxerweise langfristig sicherer und besser bezahlt – und erlauben viel weitergehende Entwicklung und Veränderung. Und andererseits eine wissenschaftliche Karriere nur noch dann gelingt, wenn ausreichend zeitliche und ökonomische Ressourcen vorhanden sind. Also eher nicht bei Kindern, die nicht selbst aus studierten Familien stammen.
Damit wird der allseits gewünschte Geist des intellektuellen Wettbewerbs und das damit oft eingeforderte unternehmerische Denken der Kandidat:innen ad absurdum geführt, denn: „Besser scheitern“ muss man sich leisten können, vor allem nach zwölf Jahren in einem geschlossenen und selbstgenügsamen System von Promotion, Post-Doc und Habilitation. Was das für strukturelle Folgen in der akademischen Wissenschaft und der Gesellschaft allgemein hat, beleuchtet der Band ziemlich gut. Denn Strukturen, die ihre Insass:innen prekär und unsicher halten, sind inhärent wissenschaftsfeindlich und nicht nur darin gesamtgesellschaftlich relevant.

Radikale Kompromisse (Affiliate-Link)
Yasmine M'Barek – Radikale Kompromisse (2022)
Wir brauchen mehr Kommunikation, auch wenn das lange dauert, gerade wenn das Gegenüber keine Anstrengungen zeigt, die eigenen Standpunkte verlassen zu wollen. Wie überheblich und wohlfeil eine solche Forderung sein mag, zumal wenn sie mit den Standpunkten diskursiv Bessergestellter vorgetragen wird – notwendig ist sie doch. In ihrem langen Essay „Radikale Kompromisse“ plädiert Yasmine M'Barek für eine Aussprache. Für kleinteilige Überzeugungsarbeit, für detailgenaues Durchsprechen von Problemen und Herausforderungen. Denn ja, wir brauchen die Minderheit der (gerne privilegierten) Idealisten, die uns mit den dringlichen Zukunfts-Themen versorgen.
Noch mehr brauchen wir jedoch pragmatische Realist:innen, die der theoretischen Thematisierung etwas Greifbares folgen lassen. Warum? Aktuell kann sich die große Mehrheit – Geringverdienende, Systemrelevante, Alleinerziehende, Bedenkenträger:innen, Autofahrer:innen, prekär Beschäftigte – es sich gar nicht leisten, radikale idealistische Positionen zu vertreten. Es braucht also dringend eine Vermittlerrolle, die die radikalen Maximalforderungen in eine umsetzbare Form bringt, selbst wenn es dabei Reibungsverluste der ursprünglichen Ideen gibt. Denn am meisten verlieren alle immer dann, wenn sie sich auf idealistische Extrempositionen zurückziehen, die jegliches Fortkommen verhindern.
M'Barek illustriert solch typische Diskurs-Sackgassen an den oft rettungslos verhärteten Positionen zum Gendern, zum Klimawandel, zur „Cancel Culture“ und Identitätspolitik – aber auch ganz konkret an Diskussionen zum Tempolimit auf Autobahnen, zum Atomausstieg und der Pendlerpauschale. Die rechthaberische Arroganz, die einem nicht selten bei Themen wie dem Klimawandel von Aktivist:innen entgegenblafft. spricht hier Bände. Denn sollte nicht gerade ein so globales Thema, das weltweit alle angeht und bei dem alle mitmachen müssten, um es in den Griff zu kriegen, mit Bedacht und ohne herablassenden Tonfall kommuniziert werden? Es braucht also so etwas wie „ambitionierte Realpolitik“, was in sich kein Widerspruch sein sollte. Sonst bleibt es bei frucht- und kulturlosen Debatten, in denen es letztlich nur noch um das korrekte Framing geht. Und was wird anders, wenn die jeweils eigenen Standpunkte unverrückbar sind? Womit wir wieder bei der eingangs erwähnten Forderung sind, nach längerer und tieferer Kommunikation. Dem miteinander Sprechen, dem gegenseitigen Zuhören und dem wohlmeinende Versuch, die anderen zu verstehen. Ausgerechnet so etwas von oben herab einzufordern, mag wohlfeil und privilegiensatt, ja sogar herablassend wirken oder sein. Letztlich ist es aber das Fundament allen demokratischen Handelns, das hier auf dem Spiel steht.