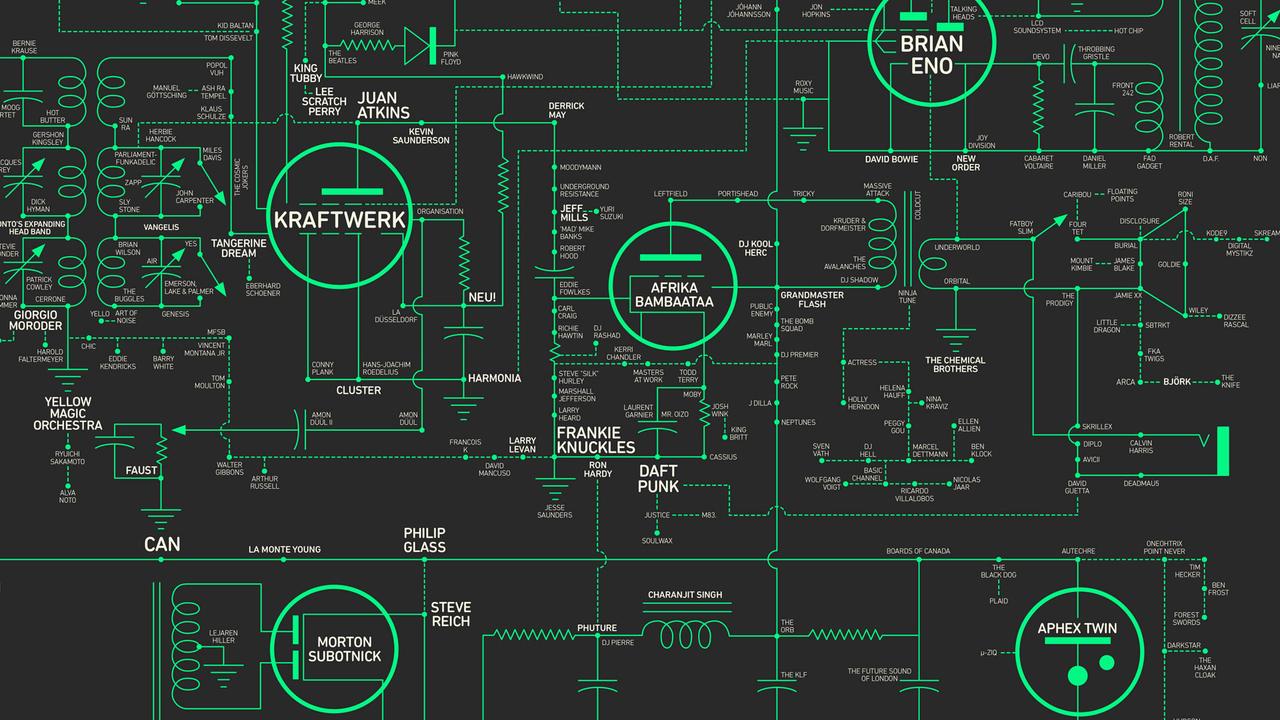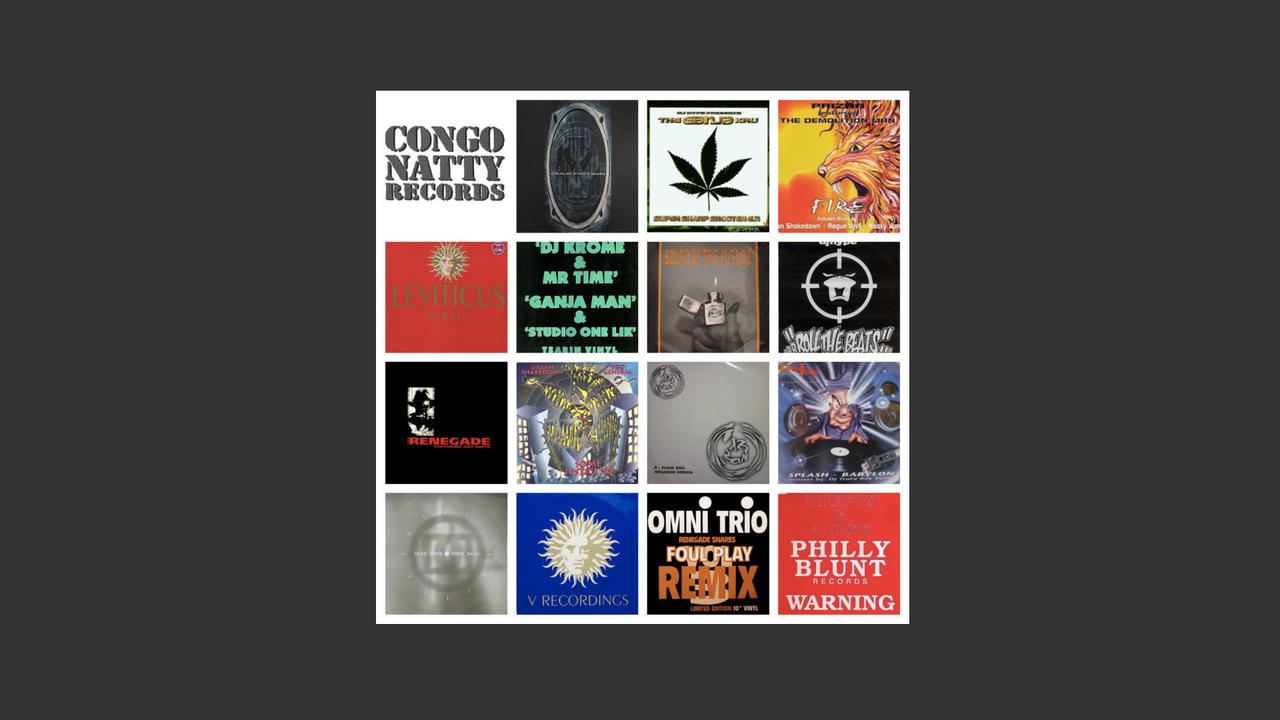Pageturner – Literatur im April 2021Wendy Liu, Aaron Benanav, Anna Mayr
1.4.2021 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Wer schreibt, der bleibt. Vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist der Pageturner und versorgt uns jeden Monat mit Reviews seiner literarischen Fundstücke. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Für den April lässt der Kolumnist die Belletristik links liegen und nimmt drei Werke in den Blickpunkt, die sich mit Arbeit, Kapitalismus und den Folgen auseinandersetzen. Wendy Liu will das Silicon Valley und seine eingebrannten Konzepte abschaffen, Aaron Benanav beleuchtet die Folgen der Automation in der Arbeitswelt und Anna Mayr fragt, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet.
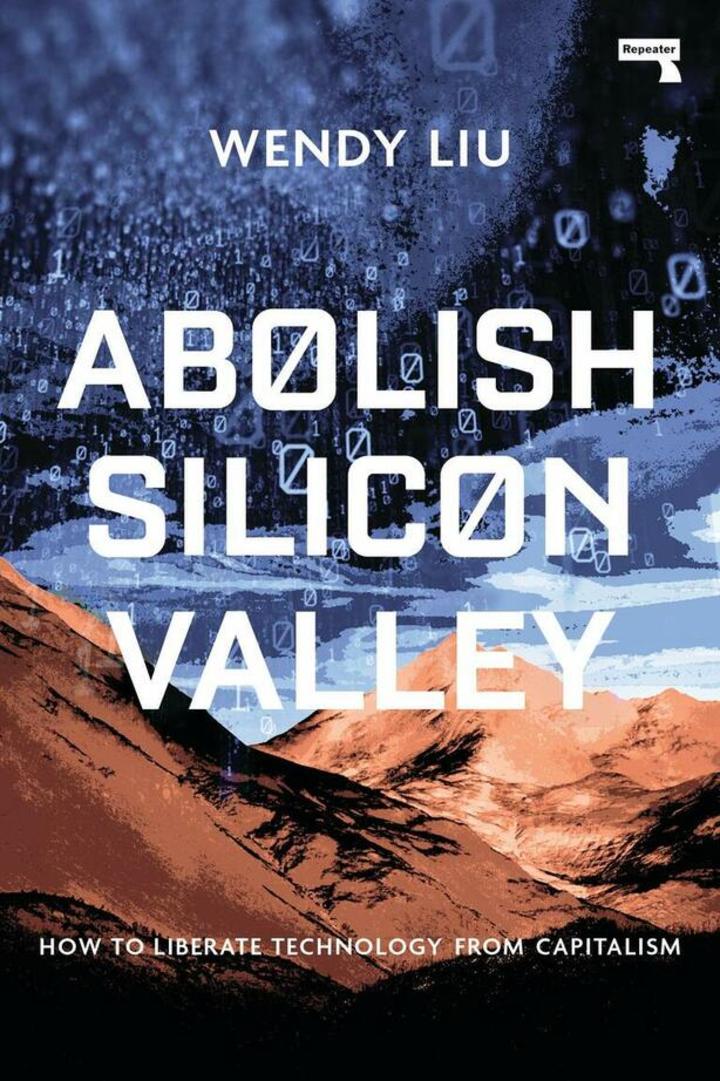
Abolish Silicon Valley (Affiliate-Link)
Wendy Liu – Abolish Silicon Valley (Repeater Books)
Die Autobiografie der Tech-Entepreneurin Wendy Liu erzählt eine moderne Paulus-Geschichte von links. Aufgewachsen im unverrückbaren und naiven Glauben an technische Machbarkeit, an Meritokratie, Konkurrenz als Lebensentwurf und Leistung als Lebenssinn, folgt Liu bis sie Mitte Zwanzig ist dem Tech-Überflieger-Narrativ praktisch vollständig: rapides IT- Studium, Praktikum bei Google, Job-Angebote von den großen Plattformen zugunsten eines eigenen Startups abgelehnt, Gründung einer eigenen IT-Firma aus der Universität heraus mit drei Kommilitonen, Venture-Kapital und Startup-„Accelerator“. Doch es läuft nichts wie geplant. Das Startup wird nicht zu der berühmten Ausnahme, dem einen Zehntel, die es schaffen – obwohl das Geschäftsmodell dem später so, äh „erfolgreichen“, von Cambridge Analytica ähnelt: aus „freiem“ Internet-Content und Metadaten verkaufbare Marketing-Daten zu erzeugen. Eine Sache, die den Gründern erfolgversprechend scheint, auch wenn sie definitiv nicht die einzigen mit so einer Idee sind. Ihren Gründerstolz und ihre Daseinsberechtigung zieht aus der Qualität der technischen Lösung. Ethische Bedenken müssen erst mal hintangestellt werden.
Doch als die Perspektive, von einem Tech-Major übernommen und jeweils siebenstellig entschädigt zu werden, mit der Zeit in immer weitere Ferne rückt, trotz des permanenten Pivoting (was sich hier wohl mit Anbiedern via cold calls übersetzt) bei potentiellen Investoren und Kunden –, kommen bei ihr langsam Zweifel auf. Nicht nur über den Sinn und Zweck ihrer Arbeit (vom vielen Geld abgesehen), sondern auch über das ethische Fundament, die gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen ihrer Arbeit, über die sie zuvor nie wirklich nachgedacht hat. Dass eventuell das ganze System, auf dem ihre Arbeit und Weltanschauung beruht, nicht fair ist. Oder nur einigermaßen fair zu ihresgleichen, den Overachievern also, die nach Lektüre von Elon Musks Biografie ihre 80 bis 100 Wochenarbeitsstunden runterreißen, um die Besten zu werden, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Dass sich dieses System aber gegenüber der großen Masse der Anderen ungleich und unfair verhält, gegenüber den Gig-Workern, den Service-Kräften auf Mindestlohn, den outgesourcten Fabrikarbeiter*innen, den obdachlos gewordenen, die sich die 3000-Dollar-Monatsmieten in San Francisco nicht mehr leisten können, dass es weder die gleichen Entwicklungschancen noch die selbe Fehlertoleranz entgegen bringt, die Inhalte ihrer Arbeit ins kleinste Detail vorgibt und jeder individuellen Kontrolle und Freiheit entzieht: Darauf kommt sie erst, als es eben bei ihrem eigenen Startup nicht mehr so gut läuft.
Mit 25 Jahren und der ernüchternden Erkenntnis, sogar als Startup-Champion nur Dispositionsmaterial für die großen Tech-Konzerne darzustellen, beginnt Liu Kapitalismuskritisches zu lesen, von Mark Fisher bis Geoff Mann, und stellt ihre Überzeugungen auf die Probe. Meritokratie ist dann bestenfalls ein utopisches Ideal, praktisch eher eine billige weithin akzeptierte Möglichkeit, Ungleichheit von Voraussetzungen und Ungerechtigkeit der Verteilung von Chancen zu maskieren. Und der Glaube, man würde mit seiner Arbeit die Welt verbessern, eine gängige Selbstbeschreibung der Tech-Eliten, ergibt eben auch keine Verbesserung für alle, sondern nur für einen sehr begrenzten Kreis. Letztlich sind so alle Probleme, Schattenseiten und Folgeerscheinungen der Tech-Industrie die Probleme des Kapitalismus. Das Silicon Valley abschaffen, wie der Titel des Buches fordert, bedeutet also den Kapitalismus abschaffen in seiner jüngsten und wohl effektivsten Ausprägung – den digitalen Plattformen, die ganz besonders gut darin sind, jegliche Kritik zu absorbieren, jeglichen Widerstand in Profit umzuwandeln.
Was Liu auf den letzten Seiten ihrer Memoiren einfordert, ist also eine ausgewachsene Utopie. Sie besteht allerdings darauf, dass sich die Vorboten und Zeichen für die Möglichkeit der Existenz dieser Utopie mehren. Bei Paulus hat es ja auch funktioniert, vielleicht ist die alte Bibelgeschichte deswegen bei manchen Linken wieder so en vogue.
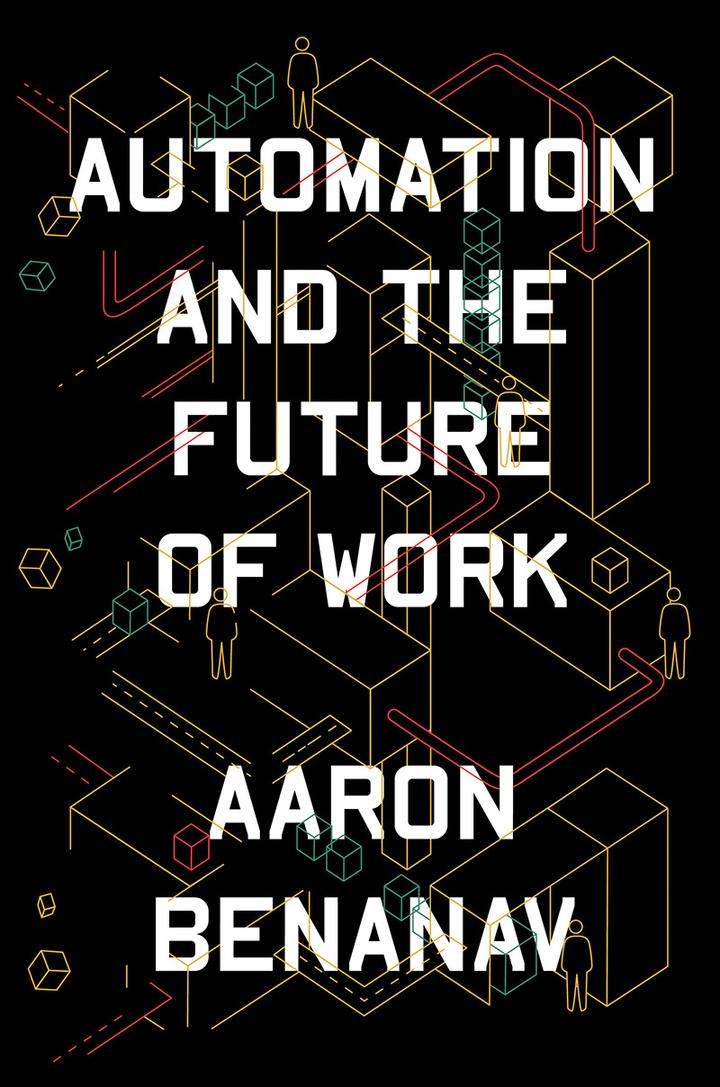
Automation And The Future Of Work (Affiliate-Link)
Aaron Benanav – Automation and the Future of Work (Verso)
Das Ende der Arbeit, mal wieder. Hier aus einer eher sozioökonomischen Perspektive betrachtet, ein etwas nüchterner und empirisch zahlenfundierter Blick auf das, was der linke Zukunftsforscher Aaron Bastani so blumig den „Fully Automated Luxury Communism“ genannt hat. Aaron Benanav denkt zwar auch über die Zukunft der Arbeit nach, in einer deindustrialisierten, von Robotern, KI und Automatisierung der Produktion angetriebenen Ökonomie. Er extrapoliert aber tatsächlich aus vorhandenen Trends, weniger aus spekulativen Zukunftsvisionen einer rosigen Technologie-Teleologie. Das Ausgangsparadox ist die Idee der meisten kalifornisch-digitalen aber ebenso auch der marxistischen Automations-Euphoriker: dass eine erhöhte Produktivität durch Automation den Weg zu einer „Post-Scarcity“-Ökonomie in der Fülle eröffnet, in der sich die Lohnarbeit und in Folge der Kapitalismus selbst abschaffen.
Allein ist das in den Automationsschüben der vergangenen 150 Jahre nie passiert. Und auch heute deutet nichts darauf hin, dass es so kommen muss. Im Gegenteil, es sind mehr Menschen (absolut wie anteilig) von Lohnarbeit abhängig als je zuvor. Die Rezession und der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Folge von COVID-19 haben das nur noch einmal verschärft und verdeutlicht. Ökonomien, die stagnieren oder schrumpfen, haben nur kurzzeitig eine deutlich erhöhte Arbeitslosenzahl. Stattdessen nimmt die „Unterbeschäftigung“ in prekären, unsicheren und schlecht bezahlten Jobs zu – und in Folge die Ungleichheit, weil die Schere der Einkünfte aus Lohnarbeit und Kapital weiter auseinander geht. Die Armen werden – absolut betrachtet – nicht ärmer, haben jedoch weniger Optionen. Die fatalste Folge des persistent und zunehmend niedrigen Bedarfs an Lohnerarbeiter*innen ist nicht unbedingt finanziell. Es ist vor allem der Mangel an sozialer Teilhabe und gesellschaftlicher Partizipation, der den Trend so schädlich für alle macht – nicht nur für die unmittelbar Betroffenen. Exakt deswegen (wie auch Anna Mayr, siehe nächste Rezension, eindringlich argumentiert) ist ein bedingungsloses Grundeinkommen keine hinreichende Lösung, allenfalls ein notwendiges Minimalkorrektiv der bestehenden Verhältnisse. Stattdessen sollte man das Vorgehen und die Perspektive auf den Kopf stellen: Erst die Möglichkeiten von Gemeinschaft und Teilhabe neu denken und neu ausprobieren. Dann überlegen, wie die Automation uns helfen kann, eine Welt jenseits der Ressourcen-Knappheit zu erreichen. Von allein passiert jedenfalls nichts.

Die Elenden (Affiliate-Link)
Anna Mayr – Die Elenden (Hanser)
Eine ZEIT-Redakteurin unternimmt eine Verteidigung der Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger*innen, Kranken, Armen, Abhängigen und Abgehängten. Gegen die Annahmen ihrer Kolleg*innen, der besser gestellten Bürgerkinder ihrer Generation, die sich gerade aufmachen, die deutsche Feuilleton-Landschaft für sich zu beanspruchen und zu übernehmen – mit dem Segen der (fast ausschließlich) alten Herren, die zur Zeit noch an diesen entscheidenden Positionen sitzen. Warum übernimmt Mayr diese unerfreuliche Aufgabe? Das hat (natürlich?) mit Herkunft und Betroffenheit zu tun. Mayr stammt aus einer eher armen Ruhrgebietsrandstadt, ihre Eltern sind Langzeitarbeitslose. Mayr ist dem System der intrinsischen wie vererbten Armut entkommen, durch Förderung und Stipendien, nicht durch Forderung und Druck. Ihr Buch erzählt aus dieser persönlichen unmittelbar betroffenen Perspektive, was es bedeutet, in einem reichen Land arm zu sein, welche politischen und gesellschaftlichen Mechanismen in diesem System der Angst und Verachtung (auch von sich selbst) ablaufen.
In einem journalistisch besonders gelungenen Kapitel gleicht sie ihre eigene Biografie mit der von Hartz-IV ab, fragt, wie es zur gegenwärtigen Form der Verachtung von Armut kommen konnte und warum ein nominell „bedingungsloses“ Grundeinkommen praktisch keine Lösung sein kann: Unmittelbare Konsequenzen der Armut würden zwar gelindert, aber das Problem der gesellschaftlichen Teilhabe, der sozialen Partizipation und Anerkennung werde ignoriert. Das Anspruchsdenken oder – moderner gesagt – das „Entitlement“ der nicht prekär Aufgewachsenen wird durch rein finanzielle Förderung niemals bei den „Abgehängten“ ankommen. Dies führt dann unmittelbar zu Aussagen wie von einem dieser TV-Talkrunden-Dauerbesetzer, dass ein Grundeinkommen unbedingt einzuführen sei, aber dann bitte ohne Kindergeld, damit die Armut nach und nach aussterbe (oder waren eventuell doch eher die Armen gemeint?). Die Forderungen, die Mayr diesen ahnungslosen oder ignoranten Konzepten und Vorstellungen der hiesigen Feuilleton-Philosophen entgegenstellt, klingen trotz ihrer aufgestauten Wut nicht radikal oder revolutionär. Letztlich geht es um mehr Geld (notwendige Bedingung) und mehr Würde (hinreichende Bedingung). Zum Beispiel durch eine Reduktion der Kontrollinstanzen, die die kleinen Einkommen völlig unverhältnismäßig überwachen.
Der unmittelbar einbezogene persönliche Standpunkt Mayrs ist die Stärke des Buches in der Genauigkeit ihrer Beschreibungen, etwa der Ängste, wieder in den Armutszustand zurückfallen zu können, aus dem man kommt, die jede noch so kleine „leichtsinnige“ finanzielle Entscheidung überschattet, zum Beispiel ein Taxi statt den Nachtbus zu nehmen. Oder das nagende Gefühl in allem Erreichten (Job, Bildungsabschluss) doch nur ein Betrüger zu sein, dem jederzeit wieder alles weggenommen werden könnte. Zugleich ist die unvermittelte Nahperspektive das größte Problem des Essays, weil es die Erwiderung zu leicht macht, dass es sich hier nur um ein individuelles Beleidigtsein einer (ehemals) Betroffenen handelt, weil der gesamtgesellschaftliche Blick fürs große Ganze manchmal fehlt. Einen bedeutenden Beitrag zu einem wichtigen Thema leistet das Buch allemal. Die „Was tun?“-Frage beantwortet Mayr auf der letzten Seite so: „Es hilft nicht, abends Foucault zu lesen, wenn man nachts nicht schlafen kann.“ „Die Elenden“ ist auch als Hörbuch verfügbar.