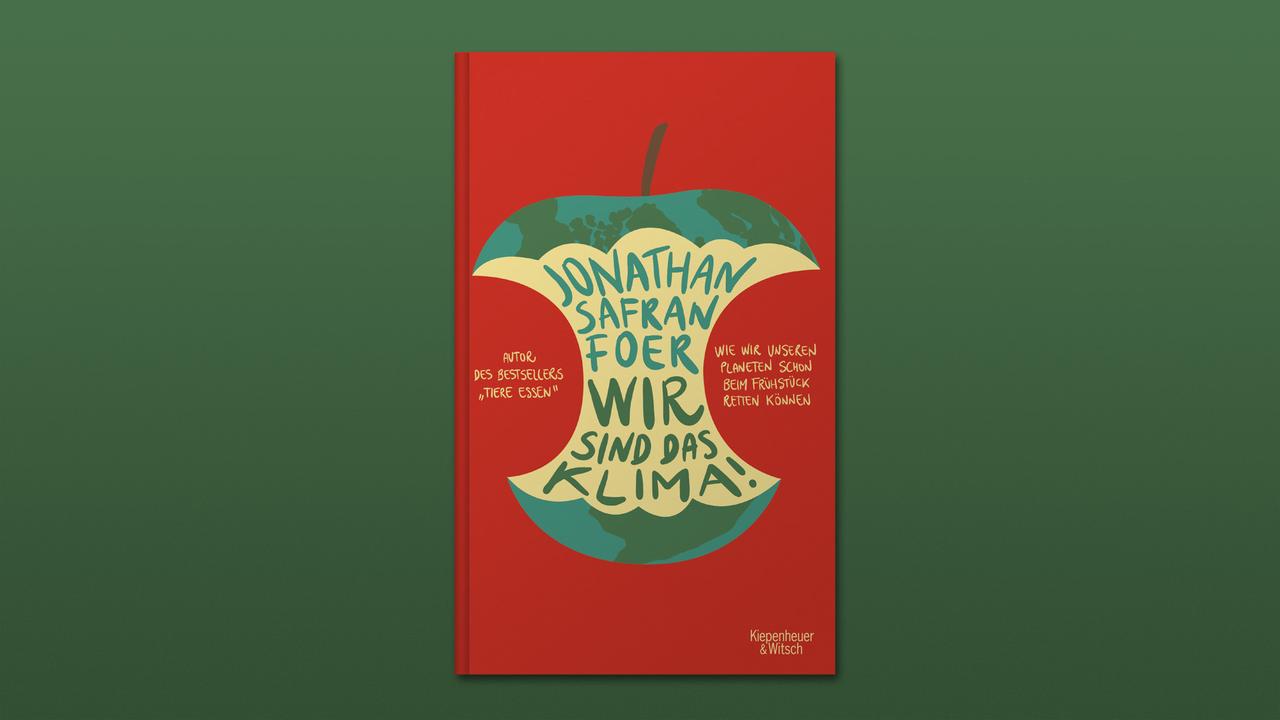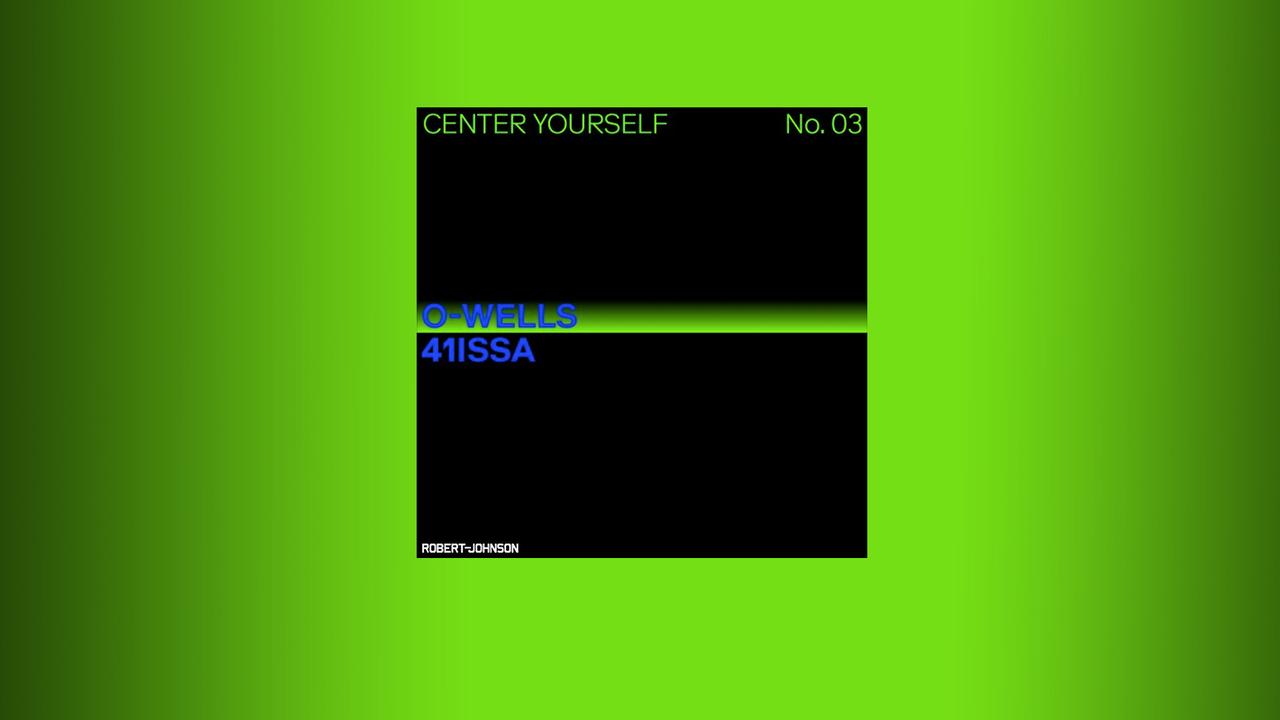Pageturner: Literatur im April 2020Sarah Pinsker, Olga Tokarczuk, Delia Owens
1.4.2020 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Wer schreibt, der bleibt. Vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist der Pageturner und versorgt uns jeden Monat mit Reviews seiner literarischen Fundstücke. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Im April empfiehlt unser Rezensent zunächst das dystopische und aktuell umso realer scheinende Roman von Sarah Pinsker „A Song For A New Day“: Wie geht es weiter mit der Musik nach einer Pandemie? Die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk legt mit „Spiel auf vielen Trommeln“ Kurzgeschichten vor, die anders funktionieren als ihre gefeierten Romane. Und die Biologin Delia Owens erzählt in ihrem Debütroman „Where the Crawdads Sing“ eine ungewöhnliche Geschichte aus den Sümpfen North Carolinas. 3 x Outsider, 3 x Isolation, 3 x sehr gut.
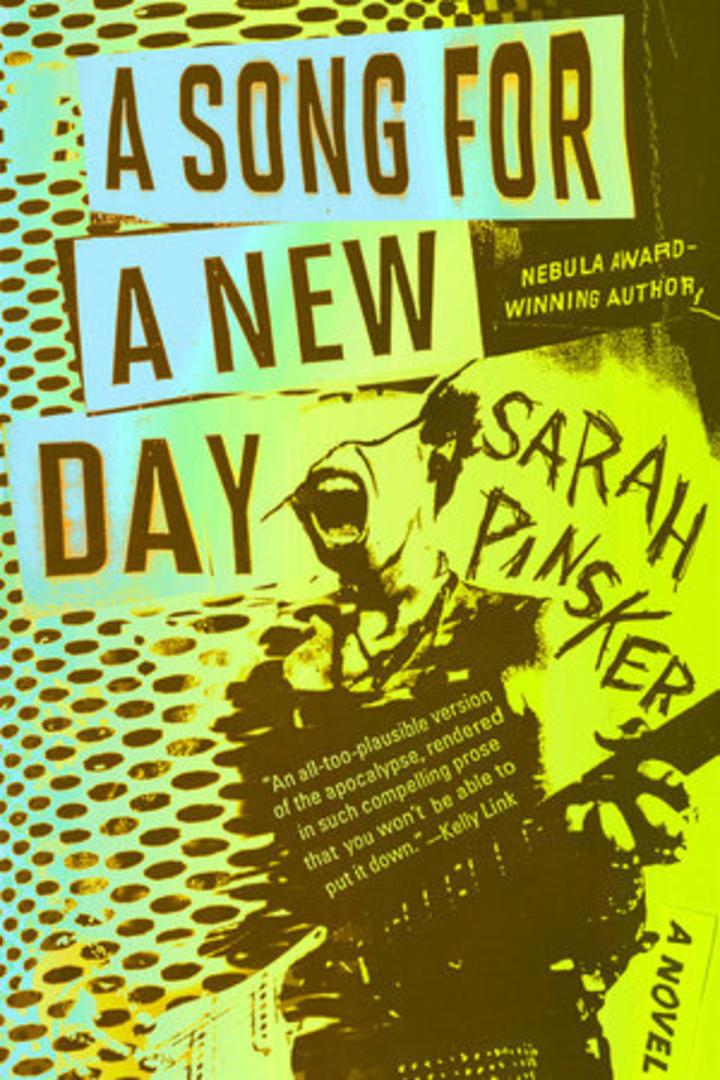
A Song For A New Day (Affiliate-Link)
Sarah Pinsker – A Song for a New Day (Berkley)
Wow, Sarah Pinsker hat 2019 nicht nur die beste Kurzgeschichtensammlung der Speculative Fiction vorgelegt („Sooner or Later Everything falls into the Sea“), sondern mit „A Song for a New Day“ auch noch eine überzeugende Nahzukunftsvision in Romanform gegossen, die die aktuelle Situation beängstigend realistisch vorhergesehen hat. Der Rahmen ihres Romans erinnert an viele ihrer Short Stories. Eine nicht allzu weit extrapolierte Zukunft nach einer Beinahe-Apokalypse (hier eine Kombination aus Terroranschlägen und Pocken-Pandemie) in einer Szenerie von bohemistisch-queeren Wahlverwandtschaften mit Riot-Grrrl-Indierock-Soundtrack.
Die Apokalypse kommt ja bekanntlich immer dann, wenn es gerade nicht so gut passt. Als die Band von Luce richtig durchstartet, als die virtual native Rosemary beginnt, Live-Konzerte zu Virtual-Reality-Shows umzusetzen. Einige Jahre später sind öffentliche und private Versammlungen größerer Menschenzahl (Sportveranstaltungen, Konzerte, Kunstmuseen, politische Demonstrationen, Messen) verboten, und Luce bestreitet als Offline/NonComm illegale Privatkonzerte in geheimen Venues, meist vor wenig mehr als einer Handvoll verbliebener Fans von Livemusik. Rosemary rekrutiert genau solche Acts/Bands für die VR-only-Plattform ihres Arbeitgebers, so eine Art Walmart-Facebook-Hybrid und Musikmarktherrscher. So folgt Pinsker in ihrem Romandebüt weniger den kühnen Gegenwartsextrapolationen ihrer Kurzgeschichten als ihrer musikalischen Sozialisation in Baltimores Queercore/Indie-Szene. Das Buch ist eine Mischung aus Tour-Tagebuch, Coming-of-Age- und Coming-Out-Geschichte mit einem erstaunlich versöhnlichen unapokalyptischen, aber leicht subversivem und leidlich glücklichen Ende. Die Botschaft könnte simpler und relevanter kaum sein: Musik, Kunst, Kultur allgemein ist gerade dann besonders wichtig und lebensnotwendig, wenn die Umstände das Gegenteil behaupten, wenn es fast nur noch um das blanke Überleben geht. Es ist also weniger das „Was“, das Pinskers Prosa interessant macht, als wie es erzählt wird. Schnell, laut, hart und catchy, wie Indierock-Literatur wohl sein sollte, dabei aber immer mindestens eine Metaebene klüger als der Rest. Mit popliterarischer Männerlarmoyanz à la „Soloalbum“ hat das nichts zu tun. Pinskers Roman also ganz anders als erwartet, aber mindestens so gut wie erwartet.

Spiel auf vielen Trommeln (Affiliate-Link)
Olga Tokarczuk – Spiel auf vielen Trommeln (Matthes & Seitz)
Vor ungefähr zehn Jahren war die aktuelle Literaturnobelpreisträgerin Stipendiatin in Berlin. Sie hat diese Erfahrung in eine Handvoll Kurzgeschichten gelegt, die mit Ausnahme der Titelgeschichte gar nicht in Berlin spielen, aber dennoch unmittelbar von der Stadterfahrung sprechen. Storys, die mit der Unruhe, dem Rhythmus der Metropole vibrieren. Tokarczuks Stärke ist die Beschreibung von äußeren und inneren Landschaften, typischerweise der ostpolnischen Provinz und der Mentalität ihrer Bewohner. In der großen Stadt und in der kurzen Fragmentform zersplittert diese Beobachtungsgabe zu Momentaufnahmen singulärer Situationen, in denen aber doch nichts Lebensveränderndes passiert. Kunstvoll, gerade auch in der deutschen Übersetzung der geschätzten Esther Kinsky, sind die Geschichten. Ob sie nun von einer Jahrhunderte zurückliegenden archaisch anmutenden Belagerung erzählen oder vom heutigen Alltag eines urbanen Jedermanns. Die zentrale Story über die Trommeln, die Berlin zusammenhalten, ist beste Autofiktion. Wie die Erzählerin, die eigentlich zurückhaltend, vorsichtig und am liebsten körperlos als unbeteiligtes Geisterwesen aus der Distanz beobachten wollte, sich langsam öffnet, beim Trommeln mitmacht und selbst eine Geschichte spinnt, die sich bei den trommelnden Bauwagenbewohnern fortpflanzt, mutiert und als urbaner Mythos wieder bei ihr ankommt – das ist einfach große Erzählkunst.
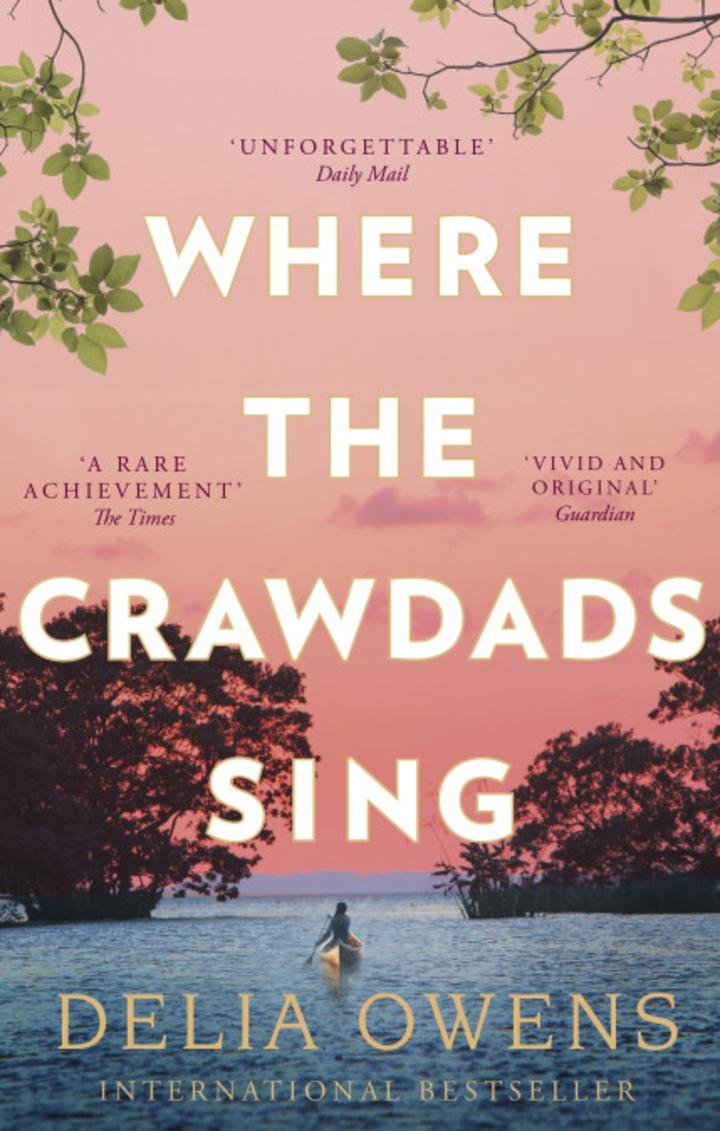
Where The Crawdads Sing | Der Gesang der Flusskrebse (Affiliate-Links)
Delia Owens – Where The Crawdads sing (Corsair)
Für ihr spätes Romandebüt hat die Biologin und Co-Autorin einiger sehr populär gewordener Dokumentationen über die ostafrikanische Savanne ihr bekanntes Terrain verlassen und ist in das salzige Schwemmland der Küste North Carolinas eingetaucht – sie ist im nahen Georgia aufgewachsen. Dort erzählt sie entlang zweier Zeitstränge von den fünfziger Jahren und von 1969 an von einem mysteriösen Todesfall des hiesigen Dorf-Casanovas, und die Coming-Of-Age-Geschichte des „Marsh Girl“ Kya.
Kya lebt als Kind am Rande des Sumpfs zwischen prekären „Shrimpern“ mit einem Alkoholikervater – traumatisierter vesehrter Weltkriegsveteran – und einer Familie, die sie nach und nach verlässt. Erst hält es die Mutter mit dem gewalttätigen Vater nicht mehr aus, dann die Geschwister, schließlich geht auch der Vater selbst. Sie bleibt allein zurück und lebt davon, Muscheln und selbstgefangenen Räucherfisch an die Bewohner der benachbarten „Colored Town“ zu verkaufen. Wenn der „Sochul Servis“ oder der fiese Dorfpolizist nach ihr suchen, verschwindet sie mit dem Boot in den Sumpf. Lange Zeit ist ihr einziger Sozialkontakt ein etwas älterer Junge aus der Schwarzensiedlung, der ihr Lesen und Schreiben beibringt und ihre Faszination für die Flora und Fauna der Gegend und für Naturlyrik teilt. Niemand kennt diese Natur besser als Kya. Es ist klar, dass das isoliert-bukolische Leben in und von den Salzmarschen nicht auf Dauer gutgehen kann. So verlässt sie ihr einziger Freund in Richtung College und Biologiestudium. Es bleibt die Einsamkeit, und der Körper will etwas anderes, als der Kopf weiß.
So schließt sich der Kreis zum lokalen Highschool-Schönling und Quarterback, der sich fast zwangsläufig logisch als richtiger Widerling herausstellt – und Kya ebenso zwangsläufig als quasi natürliche Verdächtige für seinen Todesfall. Da hilft es auch nicht, dass sie über den Kontakt mit ihrem alten Freund zur autodidaktischen, aber überaus erfolgreichen Autorin und Zeichnerin von Anthologien der lokalen Tierwelt wird. Bei den Dörflern macht sie das eher noch unbeliebter. Die zwei Handlungen konvergieren 1970 und werden im letzten Drittel des Buchs zu einem Gerichtsdrama. Zusammen ergibt das eine wunderschön geschriebene Außenseitergeschichte, die mit eher wenig Melodrama zum Glück nicht zu sehr auf die Tränendrüse drückt. Die Natur des Marschlands ist eine weitere starke Figur in diesem Roman, und das macht die eher gewöhnliche Geschichte erst richtig stark.