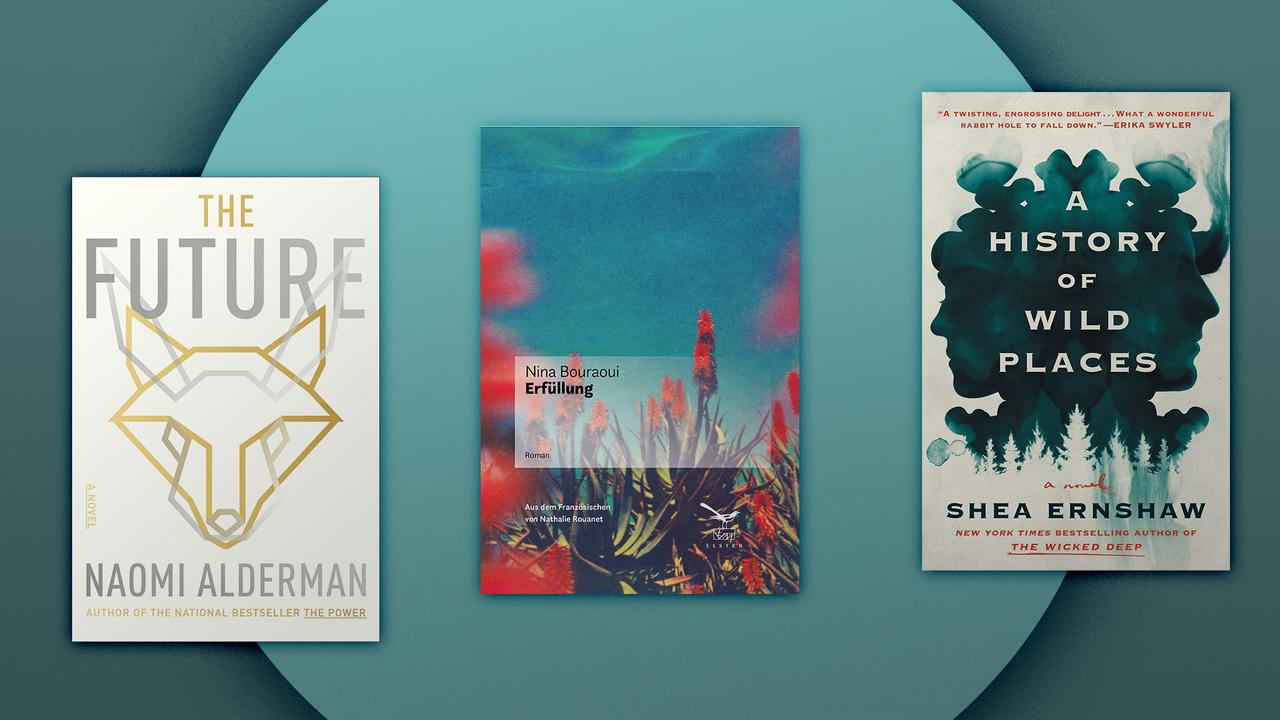Pageturner – August 2024: MenschlichesLiteratur von George Saunders, Tess Gunty und Deborah Levy
1.8.2024 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Für seine Literaturkolumne im August stellt Frank Eckert drei Bücher vor, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Menschen, das Menschliche und das Klarkommen in mindestens ebenso unterschiedlichen Umständen in den Blick nehmen. George Saunders gilt als Meister der Short Stories – sein aktueller Band „Liberation Day bzw. „Tag der Befreiung“ kreist um teils unvorstellbare WTF-Momente im Irrsinn des Alltäglichen. Tess Gunty beobachtet das Leben eines Teenagers im „The Rabbit Hutch“, einem Sozialen Wohnungsbau im US-amerikanischen Rust Belt. Und die große Deborah Levy widmet ihre schreiberische Einzigartigkeit in „Real Estate“ ein weiteres Mal der Aufgabe, die Geschichten von Frauen lautstark zu verstärken.
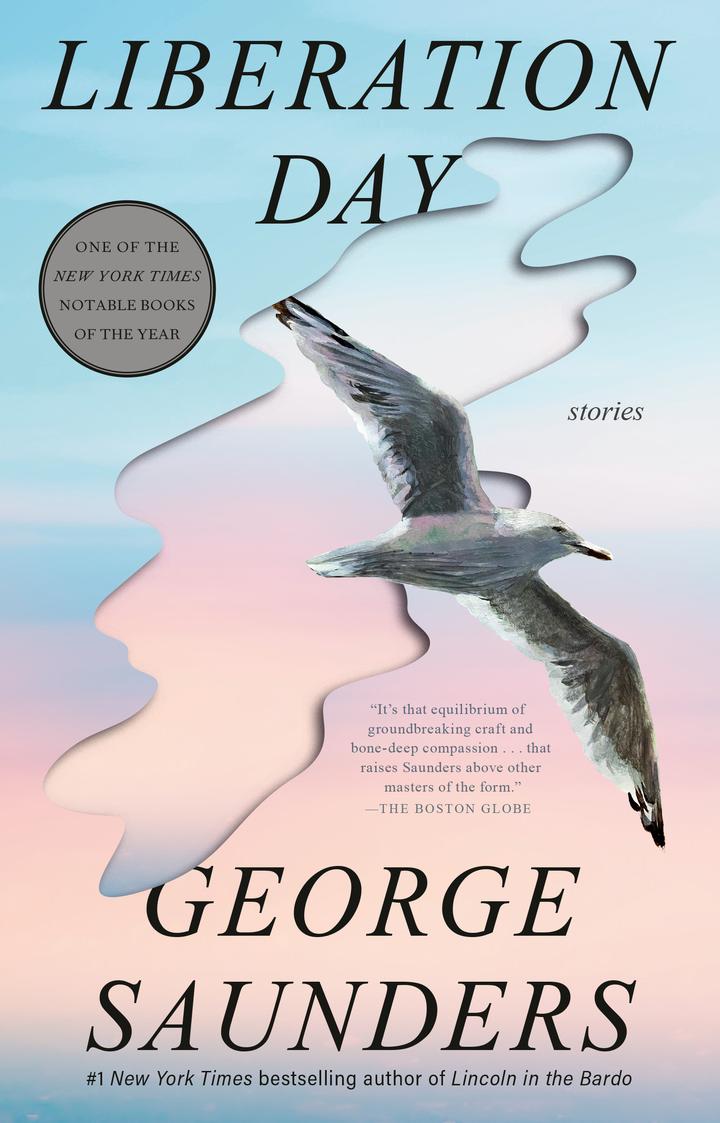
Liberation Day (Affiliate-Link) | Tag der Befreiung (Affiliate-Link)
George Saunders – Liberation Day (Bloomsbury, 2022)
Endlich wieder Kurzgeschichten von George Saunders. Sogar solche, die seine offensichtliche Faszination bis Obsession für Themenparks und Re-Enactment wieder aufnehmen. Nicht dass die gesammelten Literaturkurse über die alten Russen „A Swim in a Pond in the Rain“ oder absurd-abwegige Dark-Fantasy wie „Lincoln in the Bardo“ irgendwie schlechter gelungen wären: Immerhin macht Saunders den Doppel-Job als Professor für Creative Writing und Autor schon seit über fünfundzwanzig Jahren. Müde geworden ist er dabei keineswegs.
Die kurze Form bringt vielmehr eine stete Konzentration auf den Kern des Menschseins zum Vorschein: in Settings, die abstruser kaum sein könnten, und entlang von Themenkomplexen, die oft sehr düster und dystopisch daherkommen. Allein die Titelstory „Liberation Day“ hätte locker eine der finstersten (und besten) „Black Mirror“-Episoden werden können. Was die Sammlung unbedingt auszeichnet, ist die stark erhöhte Frequenz an wtf?-Momenten. Selbst wenn sie nicht im Spekulativen angesiedelt sind, werden die Storys bis an die Grenze des Nachvollziehbaren und Verständlichen bizarr und absurd. Sie sind also eher wild und trippig als (selbst-)erklärend und moralisch oder gar intellektuell überheblich abgehoben. Dass Saunders offenbar nichts Menschliches fremd ist und auch bei den krassesten Themen noch ein immens menschenfreundliches (und menschenkennendes) Weltbild durchscheint, macht seinen weirden wie verschmitzten Extrem-Humanismus jederzeit intuitiv und leicht zu verstehen.
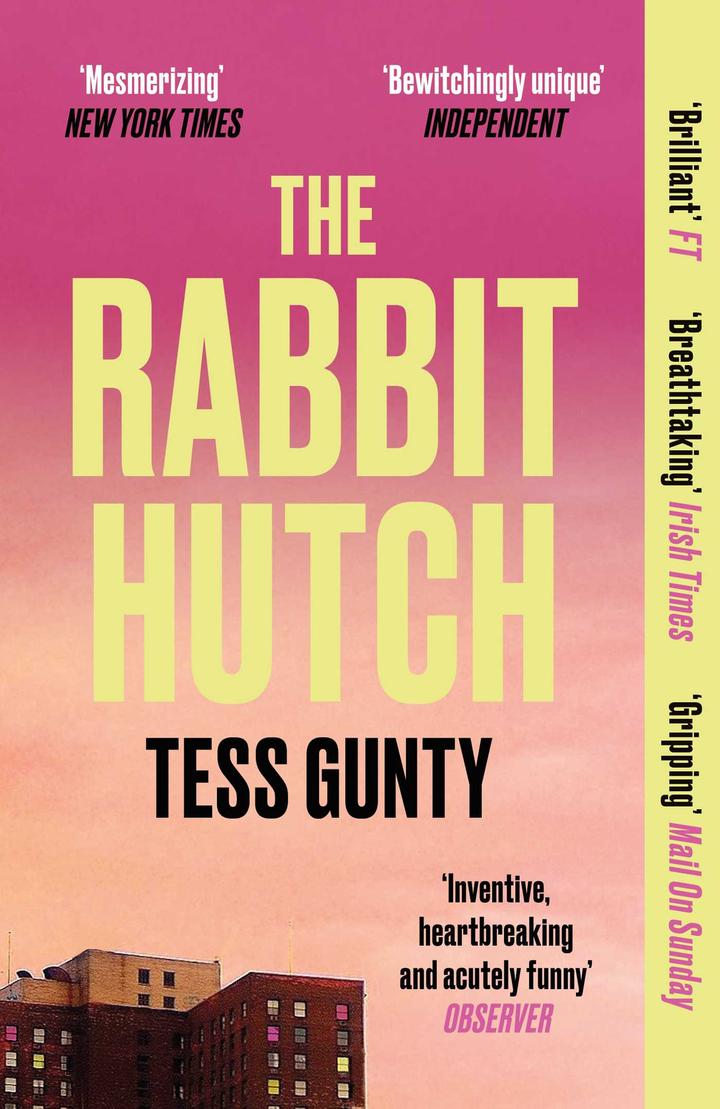
The Rabbit Hutch (Affiliate-Link) | Der Kaninchenstall (Affiliate-Link)
Tess Gunty – The Rabbit Hutch (Alfred A. Knopf, 2022)
„Knife, cotton, hoof, bleach, pain, fur, bliss.“ Cool, Tess Gunty mag Aufzählungen, Adjektivhäufung und einen Überschuss an Adverbien mindestens ebenso wie ich. Wobei all diese Schulmerkmale schlechten Schreibens ja durchaus nerven können. Mögen muss man sie schon. Sollte man in diesem Fall sogar. Denn Guntys Debütroman ist originell und stark erzählt, multiperspektivisch und milde postmodern, als spannende Variation über ein klassisches Thema.
Ein für die Umstände deutlich zu schlauer Teenager kommt mit ihrer abwesenden familiären und gleichgültigen schulischen Umgebung nicht klar. Armut, Chancenlosigkeit, Gewalt, Misogynie tragen ihren Teil bei, und die postindustrielle Rust-Belt-Tristesse im Mittleren Westen der USA (hier das fiktive Vacca Vale, Indiana, das ebenso gut Flint, Michigan oder irgendein Vorort von Detroit sein könnte) ist ebenfalls nicht hilfreich. Die immer etwas zu sensible, zu scharfsinnige Blandine, um die sich einige weitere Erzählstränge ranken, sucht und findet Ablenkung, Ausweg – eine Möglichkeit zu Leben – in der Beschäftigung mit christlichen Mystikerinnen des Mittelalters wie Hildegard von Bingen oder mehr oder weniger zeitgenössischen wie Edith Stein oder Maria Bolognesi. Das geht bis zum Versuch, die mystischen Erfahrungen in den Traumata (kaum eine Mystikerin ohne Missbrauchserfahrung, ohne familiäre Gewalt, Inzest und Verdrängung) zu reproduzieren. Abzüglich des katholischen Glaubens natürlich, denn Blandine ist ein normal säkularer Teenager aus dem „Foster care“-System in einem Sozialbau, dem titelgebenden „Rabbit Hutch“. Wie das enden muss, kann man sich denken, läuft dann aber doch etwas anders. Auffällig ist allerdings, wie die avancierte Literatur der Post-Hipster-Generation plötzlich allseits Esoterik, Mystik und archaische Zeiten als Kritik am neoliberalen Kapitalozän entdeckt. Von Moshfegh bis Heti und Gunty, ein Umweg über das dunkle Zeitalter und das magische Denken in den Postkapitalimus?
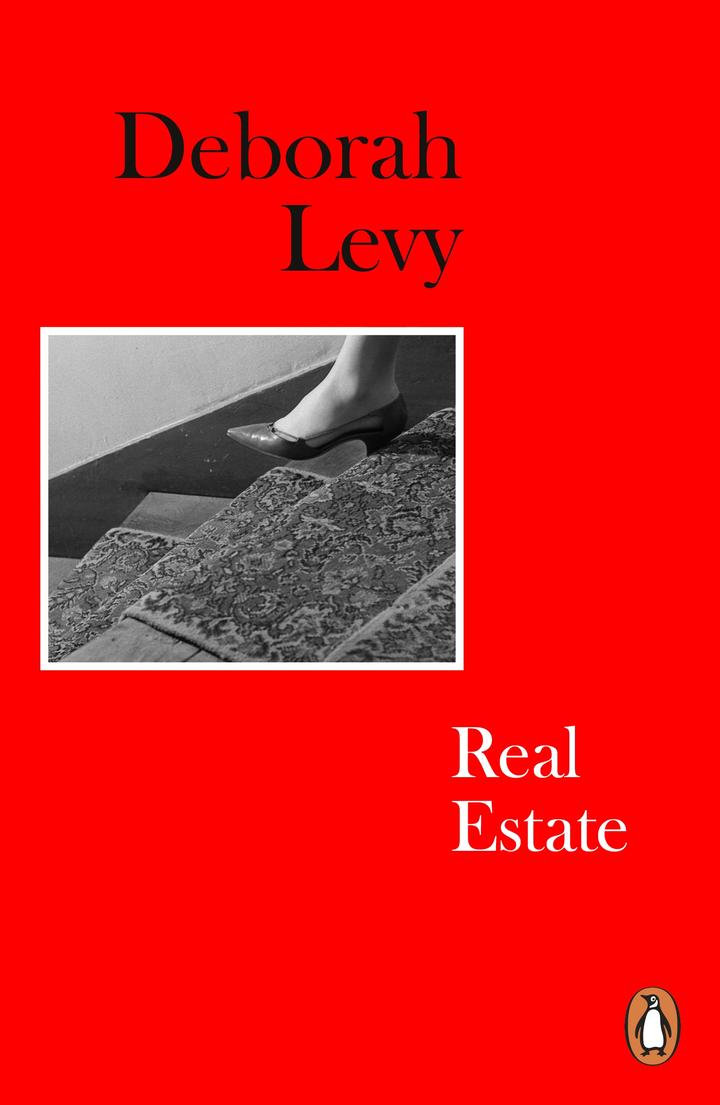
Real Estate (Affiliate-Link) | Ein eigenes Haus (Affiliate-Link)
Deborah Levy – Real Estate (Hamish Hamilton, 2021)
Der dritte und wohl finale Teil der „Living Autobiography“, den autofiktionalen Roman-Essays, mit denen Deborah Levy sich unabhängig, aber doch in unmittelbarer Nachbarschaft von Rachel Cusk zu einer Art Referenzpunkt der neueren englischsprachigen Memoir-Literatur geschrieben hat. Wie bei Cusk geht es darum zu erkennen und zu zeigen, dass ein Frauenleben wert ist, erzählt zu werden – ohne dabei auf die etablierten Muster autobiografischer Bekenntnisliteratur zurückgreifen zu müssen.
Es geht also nicht nur darum, einer spezifischen wie traditionell marginalisierten Perspektive eine Stimme zu geben. Sondern noch viel mehr darum, diese Stimme nicht auf klischierte und akzeptierte Tropen – wie etwa der Leidensgeschichte, der Unterdrückung mit nachfolgender Emanzipation – der Erfolgsstory zu reduzieren. Und positiv gewendet darum, den vom biografischen Genre vorgegebenen kleinen Rahmen des persönlichen individuell erreichten doch größer, gesellschaftlich, sozial und kulturell zu denken.
Wo sich Cusk in ihrer autofiktionalen Trilogie als Person aktiv weitgehend aus der Erzählung herausnimmt und zur klugen teilnehmenden Beobachterin ihres eigenen Lebens und der Fremdzuschreibungen auf dieses Leben wird, nutzt Levy das assoziierende Abschweifen, das Mäandern in Eindrücken, Gedankensprüngen und flirrenden Reflexionen als Mittel der Distanzierung vom Unmittelbaren. Beides ein deutlicher Bruch mit den Erzählkonventionen des Autobiografischen und den Erwartungen an das, was gerne als „Frauenliteratur“ kategorisiert wird. „Real Estate“ erzählt von Levys Lebensjahren um den 60. Geburtstag herum, von der weitgehend tagträumerischen Idee des Kaufs eines Eigenheims. Also ein Thema, das oberflächlich banal doch unglaublich viele grundsätzliche Dinge verhandelt, die Kultur, Familie, Gesellschaft und Ökonomie angehen. Mit Virginia Woolf: Letztlich geht es um „A room of one's own“.