Pageturner – April 2023: normal beschädigt, zeitgemäß utopisch, systemisch glücklosLiteratur von Una Mannion, Virginie Despentes und Marion Messina
3.4.2023 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Una Mannion schreibt in „A Crooked Tree“ über das Aufwachsen im US-amerikanischen Nirgendwo in den 1980er-Jahren. Die französische Autorin Virginie Despentes nimmt in „Liebes Arschloch“ so ziemlich alle Ismen der Gegenwart in den Blick. Und Marion Messina reflektiert in „Fehlstart“ die ganz persönliche Erneuerung im Kastenwesen der Lohnarbeit 4.0. Frank Eckerts Literaturempfehlungen für den April 2023.
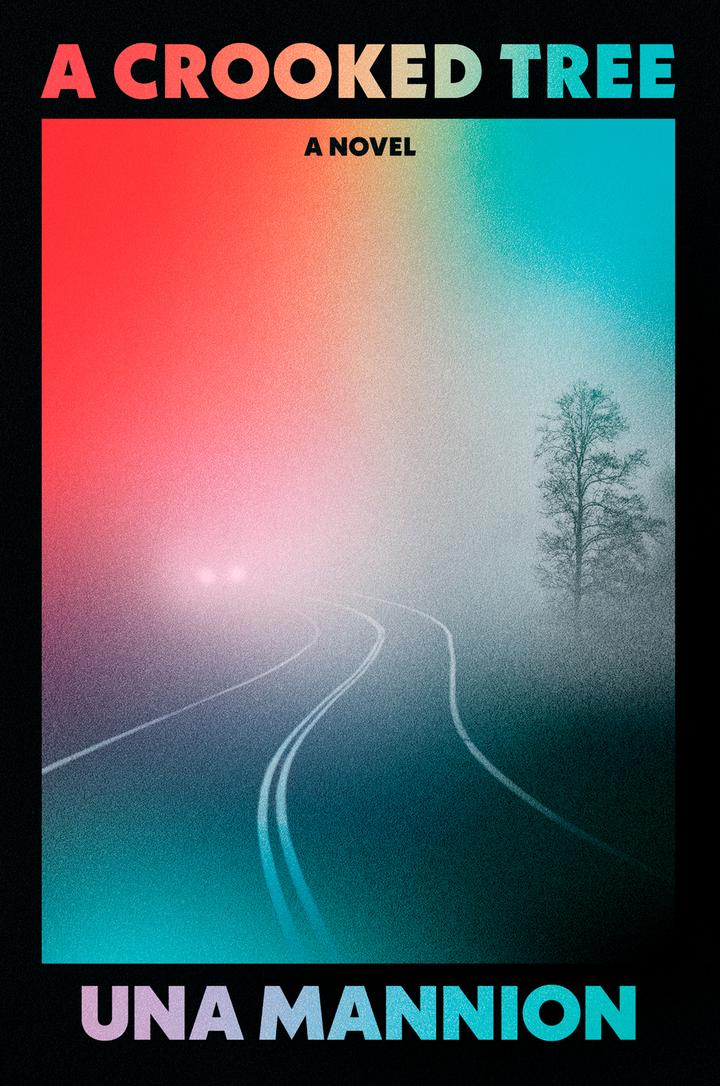
A Crooked Tree (Affiliate-Link | Licht zwischen den Bäumen (Affiliate-Link)
Una Mannion – A Crooked Tree (Faber&Faber, 2021)
Es muss etwas ganz Besonderes dran sein an so einer Jugend in den frühen Achtzigern. Sogar dann, wenn sie an einem so unspektakulären Ort stattfindet wie in Una Mannions Debütroman „A Crooked Tree“ – einem Kaff in Pennsylvania, das weder Stadt noch Land ist. Die Appalachen mit ihrer Miner- und Folk-Tradition sind (mythisch und in Meilen) ungefähr gleich weit entfernt wie Philadelphia oder das wenige Jahre zuvor kerngeschmolzene Harrisburg: für einen Teenager ohne Auto also quasi unerreichbar. Ein Ort mit „einem Kino, ein paar Banken, ein paar Eisenbahnschranken“, wie Bernd Begemann so schön dichtete.
In einer normal beschädigten Familie, Vater gestorben, Mutter überarbeitet, nicht wohlhabend aber auch nicht arm. Mit den archetypischen Erlebnissen einer solchen Jugend (Sommernächte, Lagerfeuer, lauwarmes Bier, ins Freibad einsteigen, beinahe von der Polizei erwischt werden). Musikalisch noch immer im Radio-Rock-Mainstream der Siebziger verfangen, wobei Punk und Wave bei ein paar Wenigen schon angekommen ist. Das Besondere dieser Kleinstadtjugend dieser Zeit ist vielleicht die Freiheit (oder andersherum ausgedrückt, das auf sich selbst zurückgeworfen sein), was es für Teenager weder in den strengen Dekaden zuvor, noch in den überbehüteten Dekaden seitdem in dieser Form noch gab. Eine Art von elterlichem und generell gesellschaftlichem Desinteresse an der Jugend, ein Alleingelassensein mit den Peers, das Erfahrungen und Grenzüberschreitungen in ungekanntem Maß ermöglicht, Narben und Traumata inklusive.
So erschaffen sich die Teenager-Geschwister und ihre Freunde ihre Welt selbst, weitgehend unbeachtet von Eltern und Institutionen. Etwas hochtönend ausgedrückt: Sie kümmern sich um sich und ihre Freunde in einer flüchtigen Vorstadt-Heterotopie. Mannion packt diese spezielle Situation in atmosphärisch dichte und genau beobachtete Bilder, die einerseits eine höchst spezifische Neuengland-Kleinstadt-USA wiedergeben, andererseits aber in den verhandelten Emotionen und Umständen eben auch in Sindelfingen, Wuppertal, Genk, Hasselt oder Neuchâtel (... bitte Provinzmittelstadt deiner Wahl hier einsetzen ...) dieser Zeit spielen könnten.
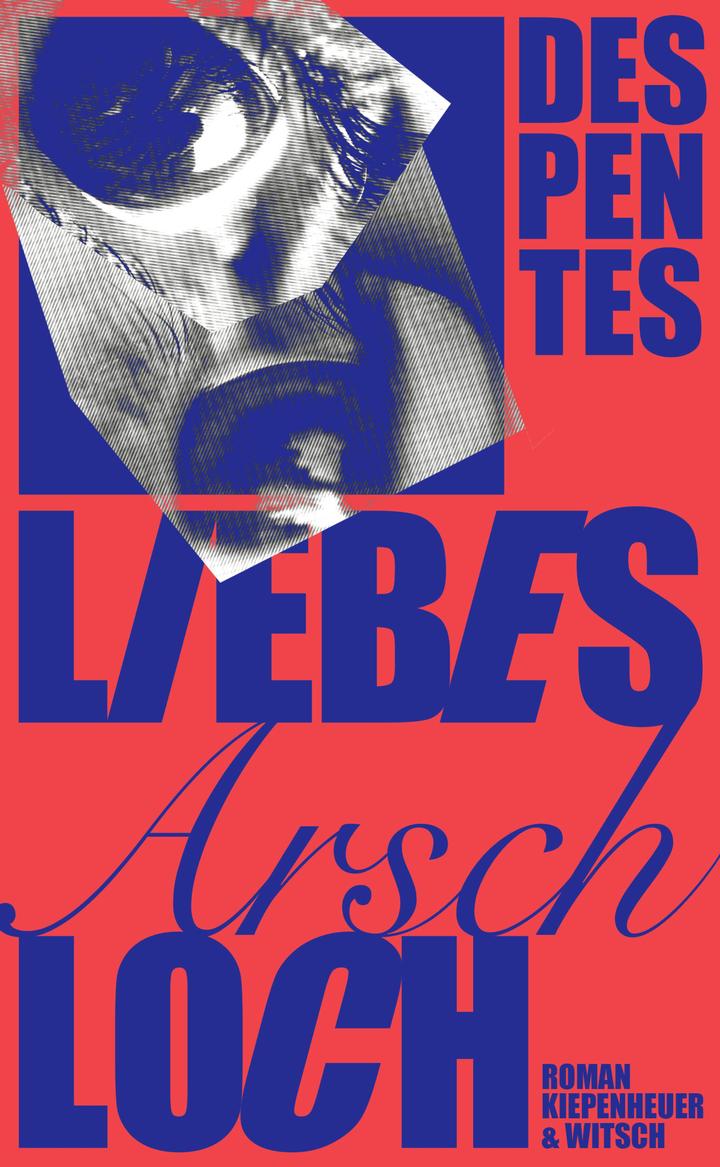
Liebes Arschloch (Affiliate-Link)
Virginie Despentes – Liebes Arschloch (Kiepenheuer & Witsch, 2023)
Versöhnlich, ja beinahe sogar altersmilde sei „Cher connard“ ausgefallen, so ist allseitig zu lesen. Tatsächlich ist das weder wahr noch wichtig. Es weist viel eher darauf hin, dass Tugenden wie Widersprüche aushalten oder den Dialog suchen heute im öffentlichen Diskurs nicht mehr allzu viel gelten. Daher ist es erst recht erstaunlich, dass der altersweise, kluge und vielschichtige jüngste Roman von Virginie Despentes in Frankreich und anderswo zu einem phänomenalen Instant-Erfolg wurde. Nicht ohne Grund allerdings. Die verhandelten Themen sind akut (ungefähr alle grassierenden Ismen, Machtmissbrauch, „Cancel Culture“, „Wokeness“ und ihre reaktiven Antagonisten), die Form ist konventionell, beinahe schon klassizistisch – es handelt sich um einen Briefroman mit Blog-Einschüben – und dabei höchst unterhaltsam (mindestens wie Despentes „Vernon Subutex“ ohne dessen Längen und bitteren Abgang). Und das, ohne die Komplexität und Verstricktheit der verhandelten Themen je zu vermindern oder die Problematik kleinzureden.
Der primäre schriftliche Austausch verläuft zwischen einer ehemals sehr erfolgreichen, nun aber von Altersdiskriminierung und Substanzabhängigkeit gebeutelten Schauspielerin und einem recht erfolgreichen, von jahrzehntelanger Alkoholsucht, körperlichem Verfall und vor allem Selbstmitleid gebeutelten Autor. Beide kennen sich aus Kindertagen, stammen aus kleinbürgerlichen oder prekären Verhältnissen und haben ihre Rollen als soziale Aufsteiger:innen stets brav eingespielt, bis der Autor im Blog der dritten Hauptfigur, einer deutlich jüngeren, ehrgeizigen und woken ehemaligen Verlagsassistentin des Autors, eines – ihres – #MeToo-Falles bezichtigt wird (wie langsam klar wird, völlig zurecht). Diese Disruption der eingeschliffenen Beziehungen, Verhältnisse und Denkweisen führt jetzt nun aber gerade nicht zu einer gewalttätig gewaltigen Eskalationsspirale oder mündet in einen Thesenroman zu den Antagonismen von Second-wave und intersektionalem Feminismus. Nein, es ist gleichzeitig viel komplizierter und viel einfacher, wie das Leben halt: Alle Beteiligten zeigen sich lernfähig, sind bereit aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden und sich über bleibende Differenzen hin zu verständigen, zu öffnen, klarzukommen. Also eine total krasse Utopie in diesen Zeiten. Aber eine notwendige und offensichtlich willkommene.

Fehlstart (Affiliate-Link)
Marion Messina – Fehlstart (Carl Hanser, 2020)
Alles richtig gemacht, immer aufgepasst, fleißig studiert – und es reicht doch nur für einen Job im Callcenter zum Mindestlohn, oder zur Empfangsdame bei einer TV-Produktionsfirma? Willkommen im neuen Kastenwesen der Lohnarbeit 4.0. Der Debütroman von Marion Messina erzählt von einer Erneuerung. Vom Wiedererstarken der Grenzen, die dem Individuum von Herkunft gesetzt sind. Von der wieder zunehmenden Undurchlässigkeit von Klassen, ja ihrer Existenz selbst. Wie nicht das, was man selbst kann oder machen will über die Zukunft entscheidet, sondern die Eltern, das was die Eltern aus ihrem Leben gemacht haben.
Aurélie, die gar nicht so naive Heldin des Romans, macht sich eigentlich wenig Illusionen über das, was sie als erste und einzige Studierende einer Arbeiterfamilie aus der feuchtkalten Provinzmittelstadt Grenoble in Paris tatsächlich erreichen kann – ohne Netzwerk, ohne Freunde oder Verbindungen und mit einer elterlich imprägnierten Haltung von Zurückhaltung, Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit. Und wird dennoch wieder und wieder enttäuscht. Die Analyse, dass Ausbildung, höhere Abschlüsse oder die Aneignung von Bildung an sich nicht mehr mit sozialem Aufstieg verbunden sind, ist nicht neu, gilt aber mehr denn je – für das eliteorientierte Schulsystem Frankreichs ebenso wie für das zumindest formal etwas egalitärere hierzulande. „Fehlstart“ ist allerdings kein Thesenroman, der diese Analyse mit deutlichen Bildern ausstaffieren würde. Es geht um die Protagonistin und ihr Innenleben, um die permanente Prägung durch kleine alltägliche Erniedrigungen in einem umfassenden Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit. Das ist exzellent beobachtet und fein in ein individuelles Schicksal gewoben. Der systematisch, ja systemisch glücklosen Heldin wird nicht einmal Ambition und Ehrgeiz honoriert. Ihr bleiben nur die Abzeichen ihrer Kaste: Demut und seinen Platz kennen. Nur gibt es diesen Platz nicht mehr.








