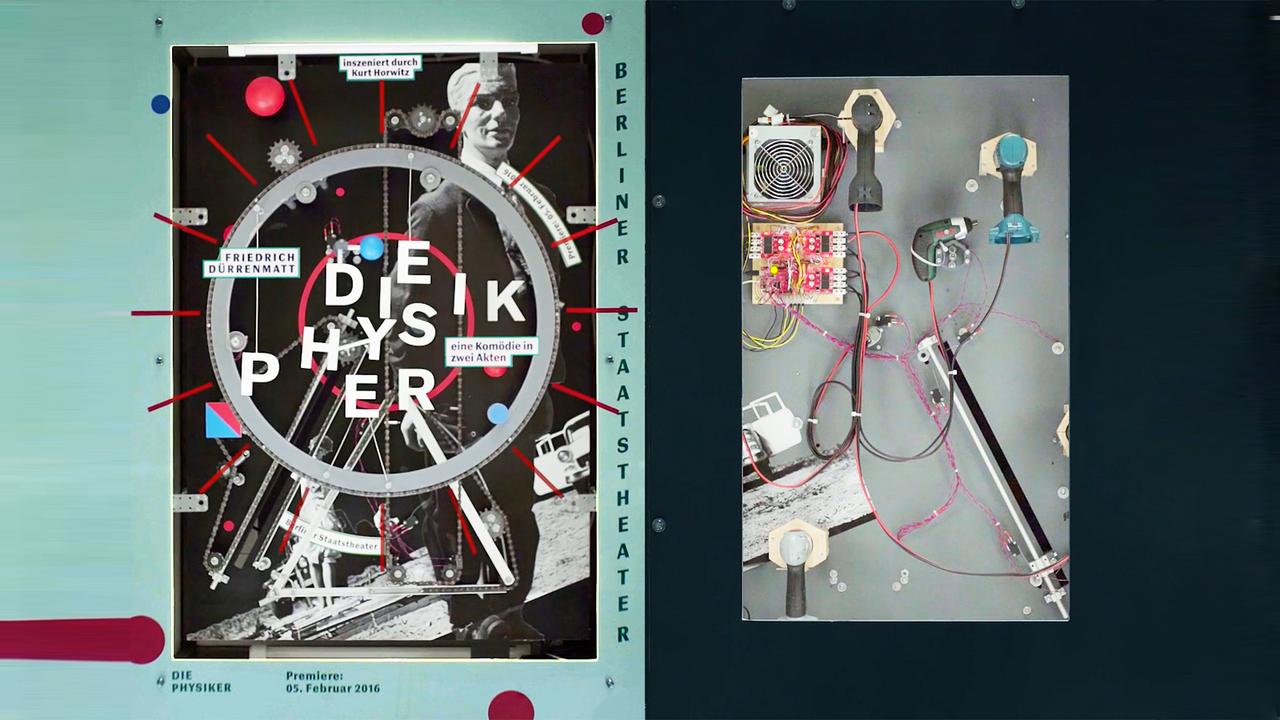„Bitte kein Pfand!“Michel Niknafs vom Prince Charles über das Leben als Clubbetreiber
1.9.2017 • Kultur – Interview: Ji-Hun Kim
Am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg steht seit über fünf Jahren der Club Prince Charles. Heute eine feste Institution, auch weil hier eben nicht das übliche Techno- und House-Diktat der Hauptstadt dominiert, sondern die Berliner HipHop-Szene und auch der Halligalli-Party-Elektizismus eine konstante Heimat gefunden haben. Redakteur Ji-Hun Kim traf Michel Niknafs, einen der Betreiber, zum Interview. Sie sprachen über den Ritterschlag durch Berliner Taxifahrer, Rosinen in der Subkultur, geklaute Tresore und wieso das Thema Bretterbuden-Club endgültig durch ist.
Der Club „Prince Charles“ in Berlin-Kreuzberg existiert seit mittlerweile fünf Jahren. Wer steckt alles dahinter?
Wir sind fünf Partner. Neben mir sind Nicolas Mönch, Andreas Zappe, Quirin Schwanck und Florian Popp beteiligt.
Was war vorher in dem Club?
2011 haben wir den Zuschlag bekommen, im Aufbauhaus in einem stillgelegten Schwimmbad einen Club zu machen. Es handelt sich um das ehemalige Mitarbeiterschwimmbecken der Bechstein Klaviermanufaktur, in der die bekannten Pianos gefertigt wurden. In den 70ern hat man nach der Arbeit wohl mit dem Chef ein paar Bahnen in dem kleinen Becken gezogen oder ging gemeinsam in die Sauna. Das Schwimmbecken ist weiterhin denkmalgeschützt, deshalb ist es in der Form nach wie vor im Club vorhanden. Wir haben es zu einer 360-Grad-Bar umgebaut. Die Bar ist auch der Dreh- und Angelpunkt des Clubs. Neben der Bar haben wir einen Dancefloor, der frühere Saunabereich. Mit den Holzelementen am DJ-Pult und am Dancefloor haben wir versucht, das Sauna-Thema aufzugreifen. Die Optik haben wir quasi so vorgefunden. Unser Konzept ist fast wie damals: Im Pool gibt's das erfrischende Nass, auf dem Dancefloor wird geschwitzt.
Was hast du vor deiner Zeit als Clubbetreiber gemacht?
Bevor es mit dem „Prince Charles“ losging, habe ich bei Universal Music gearbeitet. Dort habe ich eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Im „Prince Charles“ leitete ich zunächst das Programm. Wenn man in Berlin einen Club aufmacht, ist es ja nicht so wie in kleineren Städten, wo man sofort Stadtthema ist. In Berlin interessiert sich erst mal keine Sau für dich. Man braucht ein Profil. Ich war aber sehr motiviert, habe meine Netzwerke aktiviert, und 2012 nahm alles richtig Fahrt auf. Darüber sind wir sehr glücklich. Es fühlt sich gut an, in ein Taxi zu steigen, den Namen des eigenen Clubs zu sagen und der Fahrer weiß sofort, dass es zum Moritzplatz geht.

Michel Niknafs vom Prince Charles | Foto: Ji-Hun Kim
Das ist der Berliner Ritterschlag?
Die einzige neutrale Größe, an der man feststellen kann, wie erfolgreich ein Club ist, sind die Taxis, die am Samstag vor deinem Club stehen. Das ist der Gradmesser. Jeder Taxifahrer weiß, wo das „Berghain“, das „Watergate“ und das „Prince Charles“ ist. Sie können dir auch genau sagen, wer alles in die Clubs geht, selber drin waren sie aber wahrscheinlich nie.
Lange Zeit war es in Berlin so, dass man einen erfolgreichen Club eigentlich nur mit Techno und House bespielen konnte. Bei euch ist das anders. Ihr verfolgt einen eklektischen Ansatz. Wie ist es dazu gekommen?
Als ich dazugestoßen bin, bestand meine Vision darin, dass ich keine hatte. Ich bin Musikliebhaber, war schon immer gerne Gastgeber, und ich liebe Menschen. Ein Club ist ja nicht nur ein Raum, dazu gehören auch die Leute, die im Raum ihre Zeit verbringen. Ich habe früh mit Crews und Promotern gesprochen und für den Club kuratiert. Vor fünf Jahren gab es fast überall nur den „Uffta“-Sound. Den Sound aus dem „Berghain“ oder „Kater Holzig“ – alles andere war verpönt. Ich wollte jedoch nie in einem Club arbeiten, in dem jeden Tag das Gleiche passiert. Ich bin ja selber jeden Tag da. Das würde mich langweilen.
Wie kann man einem Außenstehenden das Konzept beschreiben?
Unser Wochenende sieht in der Regel so aus: Donnerstags kommen lokale Größen aus dem HipHop-Bereich, manchmal auch bekannte Rapper wie Cro oder Action Bronson. Künstler vom Label Kitschkrieg wie Megaloh und Ronny Trettmann, aber auch MC Bomber und Karate Andi sind regelmäßig dabei und stehen auch für den Laden. Der Donnerstag ist seitdem eine feste Institution der Berliner HipHop-Szene geworden. Hier betreut seit 2016 Mario Bonse das Programm und zeigt, was die Zukunft von HipHop bringt. Freitags haben wir ein internationales House-Booking. Wir geben uns Mühe, ein exklusives und ausgewähltes Programm zu gestalten, auch weil es in dem Genre in Berlin viel Konkurrenz gibt. Federführend gestaltet wird dieses Segment seit 2015 vom Booker Tim Leginski. Samstags haben wir unsere Netzwerk-Veranstaltungen.
Ob „Burgers and HipHop“, wo Streetfood-Markt und HipHop-Party zusammenkommen – übrigens die allererste Veranstaltung dieser Art in Berlin – oder die Partyreihe „Engtanz“, wo im ganzen Laden rosarote Herzballons hängen, Robbie Williams und Bonnie Tyler läuft und alle lauthals mitsingen. Berliner HipHop, internationaler House und Halligalli-Netzwerkpartys von Berlinern für Berliner, das gibt es in keinem anderen Laden in der Stadt. Und der Generation, aus der ich auch komme, ist der starre Genregedanke gar nicht so wichtig. Es geht weniger um Subkultur als viel mehr darum, das Beste aus all den Subkulturen zu picken.

Früher Entspannungsbecken, heute Bar | Foto: Tim Kraehnke
Die heutige Generation geht da in der Tat unbedarfter dran.
Ich bin Jahrgang 1989, jetzt 27 Jahre alt und habe mit 22 den Club aufgemacht – das ist meine Generation. Ich habe mir nie vorschreiben lassen, dass ich nur Künstler einer Musikrichtung buchen soll.
Was lernt man in den fünf Jahren?
Einiges. Fünf Jahre sind ein schönes Alter für einen Club. Die Kinderkrankheiten sind weitestgehend ausgemerzt. Man hat Fehler gemacht, daraus gelernt und einen eigenen Flow entwickelt. Als Clubbetreiber lebt man von Wochenende zu Wochenende. Das ist ohne Frage ein schöner Lebensstil, aber auch einer, der an einem zehrt. Das betrifft alle, die im Nachtleben arbeiten: Wenn man nicht aufpasst, hat man von allem zu viel: zu viele Freunde, zu viel Party und zu viel Alkohol. Die Eindrücke sind vielfältig. Wenn man aber noch zehn Jahre weitermachen will, muss man seine Balance finden und den Verzicht lernen. Was ich noch gelernt habe, ist, dass man auf seinen Tresor aufpassen sollte.
Was ist passiert?
Im dritten Jahr unseres Bestehens wurde uns der Tresor aus dem Bürofenster heraus geklaut. Es war der Sonntag 2014, als Deutschland Weltmeister wurde. Den Tag werde ich nie vergessen. Die Diebe haben wirklich den Zeitpunkt abgewartet, bis Deutschland den Titel geholt hat. Sie wussten, dass daraufhin die ganze Polizei auf dem Ku'damm ist, um die Fans zu beruhigen. An dem Tag wurden in der Stadt einige Läden, darunter das „Prince Charles“, gezielt ausgeraubt.
Wenn so etwas geschieht, bekommt man Existenzängste?
Existenzängste hat jeder Gastronom. Es hätte schlimmer kommen können. Den Verlust konnten wir glücklicherweise auffangen. Aber wenn man Gastronom ist und die Gäste kommen nicht, dann wird man nervös. Wir machen den Club um 23 Uhr auf und anfangs wurde ich schon um halb 12 unruhig, wenn nur 20 Leute da waren. Mittlerweile bin ich da cooler geworden. Ich bin glücklich, dass es selten vorgekommen ist, dass zu wenig Gäste da waren. Aber die Sorge spielt jeden Abend mit. Mittlerweile haben wir aber eine treue Fangemeinde, die offen für die Programmpunkte ist, die wir ihnen anbieten. Existenzängste sollte aber jeder haben, der an seiner eigenen Bar sitzt und anfängt, sein bester Gast zu werden.
„Existenzängste sollte aber jeder haben, der an seiner eigenen Bar sitzt und anfängt, sein bester Gast zu werden.“
Die Geschichte des „Prince Charles“ verläuft parallel zur Entwicklung des Aufbauhauses. Es haben sich hier Verlage, Agenturen, Restaurants und vieles mehr etablieren können. Man spricht vom neuen Kreuzberg …
… das habe ich damals in der Berliner Zeitung gesagt! Das Aufbauhaus ist eine schöne Plattform. Weil es als Kreativhaus konzipiert ist und seitdem eine Menge spannender Sachen passieren. Es gibt hier zum Beispiel Tischler und Lasercutter, bei denen wir unsere Clubmarken und andere Utensilien anfertigen lassen. Es entstehen Symbiosen. Als Club waren wir zu Beginn nicht der beliebteste Mieter. Wir sind halt laut und dreckig, und wenn irgendjemand was zu mäkeln hatte, dann waren immer gleich wir die Schuldigen. Viele denken, die Arbeit im Club bestehe daraus, am Abend die Tür aufzuschließen, zu feiern und am Sonntag betrunken schlafen zu gehen. Wir sind aber die ganze Woche tagsüber hier. Wir müssen Events nachbereiten, vorbereiten, Künstler buchen und für das Team ist es wichtig, an einem Ort zu sein, der mittlerweile auch sehr lebenswert ist. Es gibt ein großes Laufpublikum, Touristen und Berliner. Tagsüber zieht es viele in das große Künstlerkaufhaus Modulor. Und es gibt natürlich Leute, die in den Büros hier arbeiten. Abends sorgen wir dafür, dass der Moritzplatz am Leben gehalten wird. Hier passiert also 24/7 etwas. Vor zehn Jahren war hier tote Hose. Stillgelegte Fabrikgebäude und genau eine Dönerbude, sonst nichts. Es ist schön, dass das jetzt anders ist. Uns macht es auch ein bisschen stolz, Teil dieses neuen Kreuzbergs zu sein.

Foto: Viktor Schanz
Ihr betreibt mittlerweile in diesem Gebäudekomplex auch Gastronomien.
Genau. Der Eigentümer hat uns nach einiger Zeit, in der wir uns als Clubbetreiber beweisen konnten, angeboten, weitere Flächen zu bespielen. Vor zweieinhalb Jahren haben wir das „Parker Bowles“ mit unserem Partner Oliver Rother eröffnet. Hier gibt es tagsüber ein Deli/Café und abends Restaurant- und Barbetrieb. Vor anderthalb Jahren wurde das „Pacifico“ gemeinsam mit unserem Freund Bruno Bruni eröffnet. Dort bieten wir Fusion-Küche an: koreanisches Fastfood, gesunde Bowls und Burger von der amerikanischen Westküste. Dadurch ist unsere Agentur Bechstein Network entstanden, die diese Unternehmen seitdem unter einen Hut bringt. Aber wir bespielen mit der Agentur vor allem Off-Locations. Zur Fashion Week und Berlinale organisieren wir zahlreiche Veranstaltungen, machen aber auch viel im Bereich Corporate Event. Dazu kommt unsere neue Rooftop-Location „Atelier“ auf dem Dach vom Aufbauhaus. Und seit einiger Zeit arbeiten wir mit weiteren Partnern an einen ehemaligen Güterbahnhof im Prenzlauer Berg. Die Location nennt sich „Von Greifswald“ und eignet sich perfekt für größere Events, Ausstellungen und Food-Märkte. Wir haben also den Sprung raus aus Kreuzberg geschafft. Die Familie wird immer größer. Mittlerweile haben wir an die 200 Mitarbeiter.
War von Anfang an klar, dass ihr derart expandieren würdet? Kommt es bei solchen Entscheidungen nicht auch zu Interessenkonflikten?
Bei so vielen Partnern kommt es immer wieder zu Konflikten. Aber wir streiten eher über die Farbe von Tischplatten, als über die großen Themen. Da sind wir uns in der Regel schnell einig. Es gibt ja Menschen, die glauben, dass man als Clubbetreiber von vornherein Millionär ist. Das stimmt ja natürlich nicht. Unsere Schritte und Investitionen sind wohl überlegt. Klar spielt das Risiko eine große Rolle. Aber ich fahre noch immer meinen alten Volvo. Dennoch geht es uns natürlich darum, etwas Zukunftsträchtiges zu schaffen, sodass alle Partner davon leben können. Langfristig ist es sinnvoll, nicht nur auf einen Club zu setzen, sondern sich auch mit anderen Konzepten über die Stadt zu verteilen. Jeder weiß, dass ein Club in Berlin keine endlose Lebenszeit hat. Wir gehen da unseren eigenen Weg. Der Zenit ist noch nicht erreicht.
„In Berlin ist man faul, was Innovationen anbetrifft. Der Bretterbuden-Charme altbekannter Techno-Institutionen ist ja wohl wirklich durch. Ich brauche keine Kuckucksuhr und David-Bowie-Poster mehr hinter der Bar. Das Thema ist abgeschlossen.“
Was waren Clubs oder Bars, die dich in letzter Zeit beeindruckt haben?
In Detroit veranstaltet der legendäre Moodymann einmal im Jahr seine Soulskate-Partys. Eine riesige Rollschuh-Disco kombiniert mit den besten House-DJs der Welt. So etwas würde ich mir hier in Berlin auch mal wünschen. Kürzlich war ich in London und bin zunächst mit einer arroganten Berliner Haltung hin. Die Vitalität, die Leute, die Spannung waren aber so faszinierend und Weltklasse, das hat mich wieder auf den Teppich zurückgeholt. Ich war auf einem Pop-up-Markt, der so virtuos aus Containern gebaut wurde, dass er sich über mehrere Ebenen erstreckte und mit tollen Materialien designt wurde – das fühlte sich wie eine kleine, eigene Stadt an. Großartig. Da ist man in Berlin manchmal ein bisschen faul, was Innovationen anbetrifft. Der Bretterbuden-Charme altbekannter Techno-Institutionen ist ja wohl wirklich durch. Ich brauche keine Kuckucksuhr und David-Bowie-Poster mehr hinter der Bar. Das Thema ist abgeschlossen. Der Tresor-Gründer Dimitri Hegemann hat mit dem „Kraftwerk“ wieder bewiesen, was in Berlin möglich ist. Eine der eindrucksvollsten Locations zurzeit. Aber auch den „Klunkerkranich“ finde ich interessant. Ein stinknormales Einkaufszentrum davon zu überzeugen, die oberen Parkdecks zu vermieten, um dort ein langfristiges Rooftop-Bar-Konzept zu entwickeln, das den Neuköllner Kiez mit viel Charme bereichert, das muss man so hinkriegen.
Was braucht der perfekte Club?
Das Wichtigste im Club ist das Publikum. Die Menschen machen den Club, die Menschen identifizieren sich mit dem Club und lassen einen Club damit heller erstrahlen, als das Gemäuer selbst es könnte. Das Gemäuer sollte Atmosphäre schaffen, zum Austausch anregen. Leute sollten eingeladen werden, zu verweilen. Zu dunkel und anonym darf es nicht sein. Kommunikation ist ein wichtiger Faktor. Außer auf dem Dancefloor, da sollten Leute sich verlieren dürfen, in die Musik eintauchen, eine persönliche Erfahrung mit der Musik haben. Außerdem sollten die Drinks in einem festen Glas kommen und vor allem: bitte kein Pfand!

Beide Fotos: Viktor Schanz

Dieses Interview erschien ursprünglich im disco-magazin Ausgabe 01/2017.