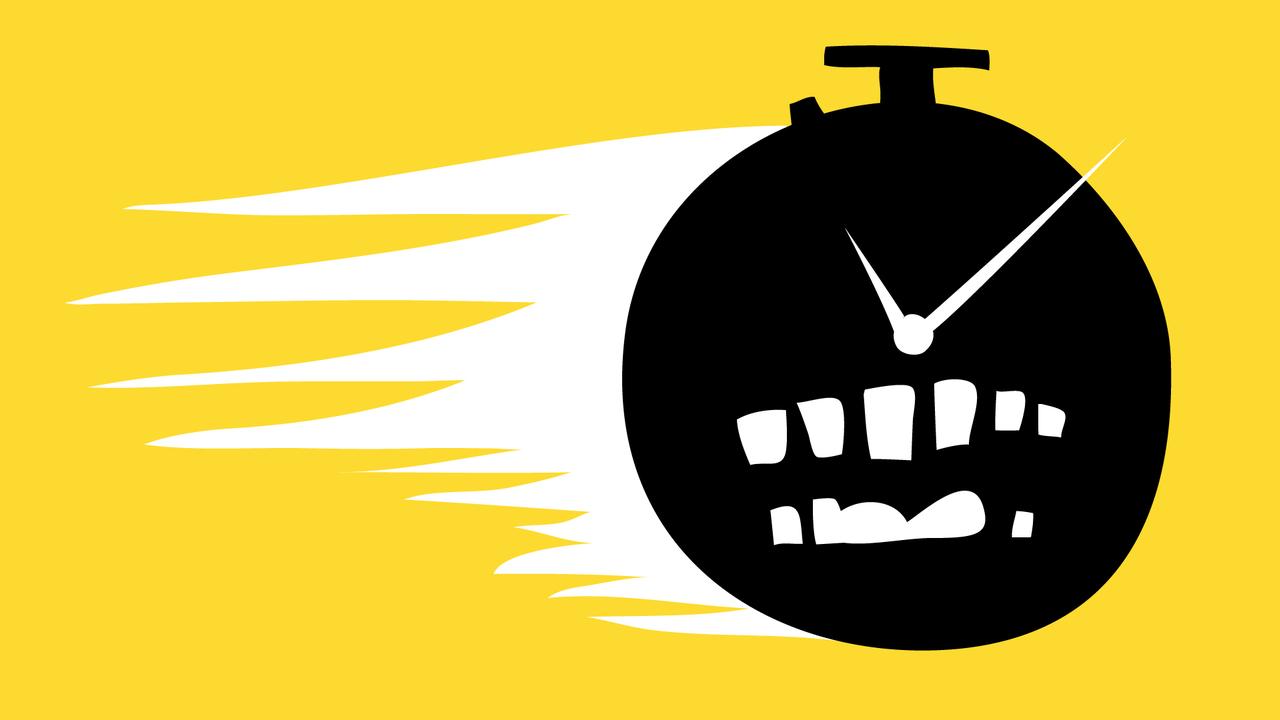Water Works – Geschichten aus Südafrikas WasserkriseTeil 1 | 14 leere Dämme
15.1.2020 • Gesellschaft – Text & Fotos: Julia Kausch
Chapman’s Peak
Wasser ist ein kostbares und endliches Gut. Wie kostbar es wirklich ist, lässt sich mittlerweile auch hierzulande ob des dramatischen Klimawandels immer mehr erahnen. Wasserknappheit ist schon lange kein Problem mehr, das wir als wohlstandsverwöhnte Europäer ignorieren können. Andere Regionen sind noch schlechter dran. Ab 2015 sah sich die südafrikanische Provinz Westkap mit einer dramatischen Situation konfrontiert. Dürre und Trockenheit ließen die Wasserreserven der Region gefährlich schwinden. Anfang 2018 schließlich wurden die Szenarien für den „Day Zero“ veröffentlicht, dem Tag, an dem das Wasser aufgebraucht sein würde. Genau in dieser Zeit fuhr Filter-Autorin Julia Kausch nach Südafrika. Um das Land kennenzulernen, vor allem aber auch, um zu surfen und sich dem Wasser der Ozeane kompromisslos auszusetzen. In ihrer Artikel-Serie „Water Works“ erzählt sie Geschichten rund um das Wasser in Südafrika. Episodisch und reportierend setzt sich so Stück für Stück oder Welle für Welle das Bild einer Krise zusammen, die von weit mehr abhängig ist als vom resourcenschonenden Umgang und der Hoffnung auf Regen.
Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: »Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?« Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: »Was zum Teufel ist Wasser?«
(Das hier ist Wasser – David Foster Wallace)
Umgeben vom atlantischen und indischen Ozean bildet Kapstadt eine kleine Spitze windiger Landschaft aus trockenen Bergen, die von – nach deutschem Regulierungswahnsinn unvorstellbaren – unbefestigten Wanderwegen durchzogen sind. Diese im März gänzlich ausgetrocknete und unfassbar schöne Flora und Fauna ist geprägt von europäisch anmutenden Serpentinenstraßen, welche Wasser und Dürre einzigartig gegenüberstellt. Die Tischdecke, wie die nebelartigen Wolkengebilde, die wie Stickstoff über dem Tafelberg hängen, genannt wird, entsteht der Legende nach immer dann, wenn der holländische Pirat Jan Van Hunks den Teufel am Hang des Berges zum Wettrauchen trifft.
Das sich in rollenden Wellen an kalten Felsen brechende Meer erscheint zugleich ungebändigt und doch stumm, blickt man von weit oben auf dem Chapman’s Peak darauf hinab. Ist es nun gezähmt? Wohl kaum. Sogar von oben ist es nicht schwer vorstellbar, dass zahlreiche Seefahrten hier im Schiffbruch endeten. Die 180-Grad-Meeresansicht stürzt sich im 90-Grad-Winkel in die Ozeanschlucht hinab, die gesäumt von Felsformationen ein- und ausläuft. „Ist mir egal“ ist das Motto, welches in Benjamin von Stuckrad-Barres Stimme durch den Kopf hallt. Wie er schreibe auch ich den Großteil dieser Zeilen im Halbschatten eines Zitronenbaums, welcher sich gegen die afrikanische Sonne abzeichnet.
Ein stilles Wasser, bitte
Tag null. Uhr abgelaufen, aber wann ist es denn soweit? T minus x? Schon vor meiner Ankunft in Kapstadt, noch in London, hörte ich viele Geschichten vom allseits gefürchteten Day Zero, dem Tag also, an dem das Wasser abgedreht werden sollte. Ja, genau jenes, was doch bequem aus dem Hahn strömt, sich ins Becken ergießt, den Wasserkocher füllt, den Topf, in welchem die Stärke aus den Nudeln gekocht, diese im besten Fall aber al dente auf dem Teller landen, jenes grundlegende Element jeder Waschmaschine, was Persil-strahlend-weiß ja erst den nötigen Kick zur Leuchtkraft gibt. Das, welches in Tropfen das Gesicht herunterrinnt, wenn man sich an kalten Wintertagen doch nur ungern aus der warmen Dusche begibt. Und selbst die kalte Dusche scheint in Anbetracht der Tatsache, dass die ganze Sache mit dem Wasser aus dem Hahn ein Ende nehmen könnte, nahezu himmlisch. Dass das Wasser, auf das zumindest in der Theorie der Vereinten Nationen ein Menschenrecht besteht, einfach so und auf Monopoly-Weg ohne Umwege abgedreht wird: Kann das denn sein? Kann es, zumindest in (Süd-)Afrika.
Gerade aus der Badewanne gestiegen und im warmen Wohnzimmer in London sitzend, starrte ich auf den Bildschirm meines MacBooks, auf dem das Gesicht einer Freundin aufflackerte, die bereits am Sehnsuchtsort war. Sie berichtete vom Chaos, das sich Anfang 2018 in Südafrika offenbarte: Menschenmengen, die Schlange stehend Wasserreserven aufzufüllen versuchten und ganze Supermärkte leerkauften, sodass Läden ein Pro-Kopf-Limit an Wasserflaschen einführten. Zwar kam noch Leitungswasser aus dem Hahn, jedoch war dieses bei niedrigen Dammfüllständen nicht unbedingt empfehlenswert für den direkten (also ungekochten) Gebrauch.
Wie leer waren die Dämme aber? So genau wusste das wohl von meinen Freund*innen niemand. Der Plural – die Dämme – bildete hier die entscheidende Unschärfe. Verschiedene Gebiete nutzen unterschiedliche Dämme, wobei es natürlich kleine und große gibt. Dass eine Prozentzahl des Füllstands zwar bekannt ist, für die meisten jedoch keine Bedeutung hat, erscheint logisch. Beispiel: Der größte Damm des West-Kaps ist der Theewaterskloof-Damm. Er fasst rund 480,000,000 Kubikmeter Wasser. Kapstadts ältester Speicher, das Molteno Reservoir, dagegen fasst noch nicht einmal ein Zehntel dessen (etwa 3,000,000 Kubikmeter). Machte aber eigentlich nichts: Im März 2018 sieht es pegelstandtechnisch überall ziemlich gleich scheiße aus. Theewaterskloof-Damm: 10,3 %, Voëlvlei: 14,4 %, Bergriver: 44,9 %, Clanwilliam: 6,1 % – alle Dämme des Western Capes vereint dümpelten auf einem Tiefstand von 21,8 %, wie Badewannen, denen bei nur noch lauwarmem Wasser die Stöpsel gezogen wurden. Wie die „City of Cape Town“ schreibt, ist Kapstadt von 14 Dämmen umgeben, welche die Kollektivkapazität von etwa 900,000,000.000 Liter haben. Aha ... wieviele Badewannen waren das jetzt? Kein Wunder, dass bei so vielen Nullen jeglicher Bezug zum Alltag fehlte.

Der Theewaterskloof-Damm
Water Restriction Level 7
Soviel wusste aber selbst ich, post-Badewanne, in London: Der kollektive Nervenzusammenbruch war angebracht, die Uhren auf fünf vor zwölf, das Fass paradoxerweise nicht am Überlaufen, sondern gegenteilig fast leer. Das alles hatte einen bürokratisch nichtssagenden und in seiner Trockenheit beschreibend anmutenden, wenngleich für Normalsterbliche sinnentleerten und ja daher noch apokalyptischer klingenden Namen: Water Restriction Level 7. NASA, Apollo 13 – ja, geheimnisvolle Codes wurden hier evoziert! Mir lief es kalt den Rücken herunter. Warum, wusste ich bei dieser begrifflichen Unschärfe gar nicht so genau. Aber: Das heiße Badewannenerlebnis war dahin. Immer noch bei FaceTime, sprang ich vom Sofa auf und lief in die Küche; meine Freundin musste kurz warten. Wasserhahn an, Wasserkocher befüllt, Beutel in die Tasse und brühwarm aufgegossen. Zurück am Laptop, versuchten wir den derzeitigen Status Quo, also im Februar 2018, zu erschließen. Die Restriktionslevel reichten von eins bis sieben, wobei sieben quasi drei Ickse (XXX) bedeutete. Three strikes, Cape Town you’re out. Und dann? Wusste auch keiner. Level 7 war das hoffentlich nie erreichte Nostradamus, an dem die trockensandige Erde aufgehen und aller EinwohnerInnen auf Nimmerwiedersehen verschluckt würden. Geschickt hatte die Regierung kurzerhand straßennummernartig Buchstaben angefügt. Für Beginn 2018 hieß das Übel also: Water Level Restriction 6B.
Dazu gab es auch endlich etwas zu lesen: „Level 6B water restrictions are applicable to residents and businesses in the City of Cape Town as of 1 February 2018. Water use should be limited to human consumption.“ Privatpersonen, Unternehmen; los ging es am 1. Februar. Das hieß genauer: 50 Liter Trinkwasserverbrauch pro Person pro Tag, egal, ob dies zu Hause, in der Schule oder der Arbeit passiert. Die einzige Ausnahme: Man ist gerade nicht in Kapstadt, machte ja Sinn. In acht Punkten wurde symbolisch wie schriftlich beschrieben, was genau die Restriktionen bedeuten. Selbst vor Sanktionen bei Nichteinhaltung in Privathaushalten wurde gewarnt. Wie genau das gemessen werden sollte, blieb Magician’s Code – (Magier-)Geheimnis. Aus europäischer Sicht schien es, als liefe in Südafrika gar nichts mehr. So schlimm, so vergewisserte meine Freundin, sei es aber nicht. Bisher musste sie noch nichts zahlen, hielt ihre Duschen aber auf einem Zwei-Minuten-Minimum, mit Abständen von zwei bis drei Tagen. Handsanitizer anstatt Wasser und Seife sowie eine ganze Palette Trockenshampoos waren lebensnotwendig. Etwas geschockt legte ich auf; meine Freundin musste los zum Surfen – zumindest im atlantischen und indischen Ozean schien es also noch Wasser zu geben. Die Dusche hatte sie damit für den Tag auch gespart. Ich ging ins Bett und zählte zum Einschlafen, wie viele Bäder ich wohl vor Abreise noch nehmen könnte.
Century City
In einem kleinen Café im Norden Kapstadts, im gut situierten Century City, macht sich ein Vorortgefühl à la Kleinmachnow breit; das reiche und doch so unpersönliche Stiefkind einer Mutterstadt. Die Mutterstadt der Nordhalbkugel kannte ich natürlich schon. Wo Kleinmachnow leider nicht nur einzigartige Landschaft, sondern auch Palmen fehlen, könnte Century City ebenso in Florida gelegen sein: dominiert von gated communities, in welchen sich die ewig unveränderte Architektur amerikanisch anmutender Apartmentkomplexe und Einfamilienhäuser in von Zäunen umringten Dörfern anordnet. Die Wiesen und Vorgärten sind leuchtend grün und millimetergenau getrimmt. Über den unzähligen Kreisverkehren erheben sich Palmen, die bei Nacht im Las-Vegas-Stil mit Lichterketten beleuchtet werden. Anders als in Vegas ist hier allerdings so viel los, wie man es von einem gutbürgerlichen Seniorenstaat erwarten würde. Die Rollatoren auf 3 km/h gestellt, ziehen sie dann einmal täglich durch die Straßen – selbstverständlich innerhalb der Parameter des drei Meter hohen Zauns, der das Gelände gänzlich von der Außenwelt abschottet. Wenigstens den Himmel kann man sehen.
Spannend dabei ist, dass die Einkommensverteilung kongruent zur örtlichen Begrasung der Mittelinseln der Straßen verläuft. Dies kann vor allem dann lebensrettend sein, wenn man sich direkt nach Abholung des Fahrzeugs von der Autovermietung verfährt und versehentlich, aber ohne Umwege, in einem Township landet. Die zunächst trockener werdende Mittelinsel durchläuft dabei das Farbspektrum von leuchtend grün zu gelb, bis schließlich gar keine Vegetation mehr erkennbar ist. Jeder Zweifel der örtlichen Befindlichkeit verfliegt spätestens dann, wenn die gesamte Mittelinsel verschwunden ist, sodass Straßen und Gehwege einen fließenden Übergang bilden.
Nach ein paar Runden auf dem Parkplatz, die Anfahrt ist ruckelig, das Auto laut und die Lenkung ohne Servo, geht es los. Klimaanlage gibt es ... natürlich. Der kleine Toyota Tazz ist außerdem, und das macht es für mich auf Anhieb heimischer, schwarz. Die meisten Autos in Südafrika sind ja weiß. Viel Sonne und wenig Einkommen, um die Autos nach Verlassen der Fabrik zu lackieren, sind schuld. Lack ist auf Kapstadts Straßen sowieso nicht sicher. In Deutschland hat sich der Trend zum Glück wieder gelegt, aber auch dort war die Zahl der weißen Fahrzeuge (meist Mutti-SUVs) ja in den vergangenen Jahren exponentiell gestiegen. Keine Servolenkung und Probleme beim Starten, wie ich bald bemerke, aber wenigstens keine Soccer Mom. Mein iPhone im neuen, doch schrottreifen Auto auf dem Schoß, hatte ich die Adresse zurück ins umzäunte Elend bereits eingegeben. Der Besitzer öffnet das Tor, welches auf eine zwielichtige Seitenstraße Athlones öffnet, und blickt mir besorgt hinterher, als ich den Parkplatz verlasse und vor dem Abbiegen auf die zum ersten Mal falsche (also linke) Straßenseite den Rückspiegel einstelle.
Ich fahre zunächst geradeaus und weiß schnell nicht mehr, wo ich bin. Ich blicke auf mein iPhone, das bereits zwischen meine Knie gerutscht ist. Ich nehme es in die Hand und sehe: nichts. Der kleine blaue Punkt war auf dem Parkplatz der Autovermietung stehengeblieben. Wie in Europa gewöhnt, fahre ich erst einmal weiter, bald würde ja sicher ein Schild kommen, das mir den Weg gen Norden weisen würde. Dem ist nicht so. Ich bleibe also, wie auch der kleine blaue Pfeil, stehen. Allerdings bin ich ziemlich sicher, dass das hier zwischen trockenem Geäst und ohne tatsächliche Straße, dafür aber vielen selbst zusammengeschusterten Blechhäusern, nicht die beste Idee ist. Bitte Türen abschließen, erinnere ich mich an die Worte des Autovermieters. Zumindest mein Auto passt gut in die hiesige Umgebung: Das rostige Schwarz bildet einen schönen Übergang zum Hintergrund; fast Camouflage. Als ich mein silbernes iPhone gerade wieder zwischen den Knien verstecken will – es glänzt ganz schön in der Sonne – beginnt es zu klingeln. Na wenigstens funktioniert das noch, denke ich und nehme ab. „Hello?“ „Hi dear“, tönt es vom anderen Ende. „Are you lost?“ Ja klar bin ich lost, schließlich habe ich seit etwa 15 Minuten keinen begrasten Mittelstreifen mehr gesehen, was, wie ich ja wusste, immer schlecht ist. Aber woher weiß der Mann das jetzt? Es ist der Besitzer der Autovermietung. Ein kleiner Tracker im Auto zeigt ihm, dass ich schnurstracks in ein Township gefahren bin. „Du bist in Langa, ist alles okay?“, fragt er. „Ja, soweit alles okay“, antworte ich. Stehenbleiben, ruhig verhalten, es komme jemand, erklärt er. Von der Autovermietung gesendet, folge ich einem weißen Pick-Up-Truck (hier liebevoll Bakkie genannt), zurück in die gated community.
Welcome to Africa.
Im zweiten Teil der Serie „Water Works“ gibt es Wasser im Überfluss. „Wellen aus Blut“ erscheint am 29. Januar.