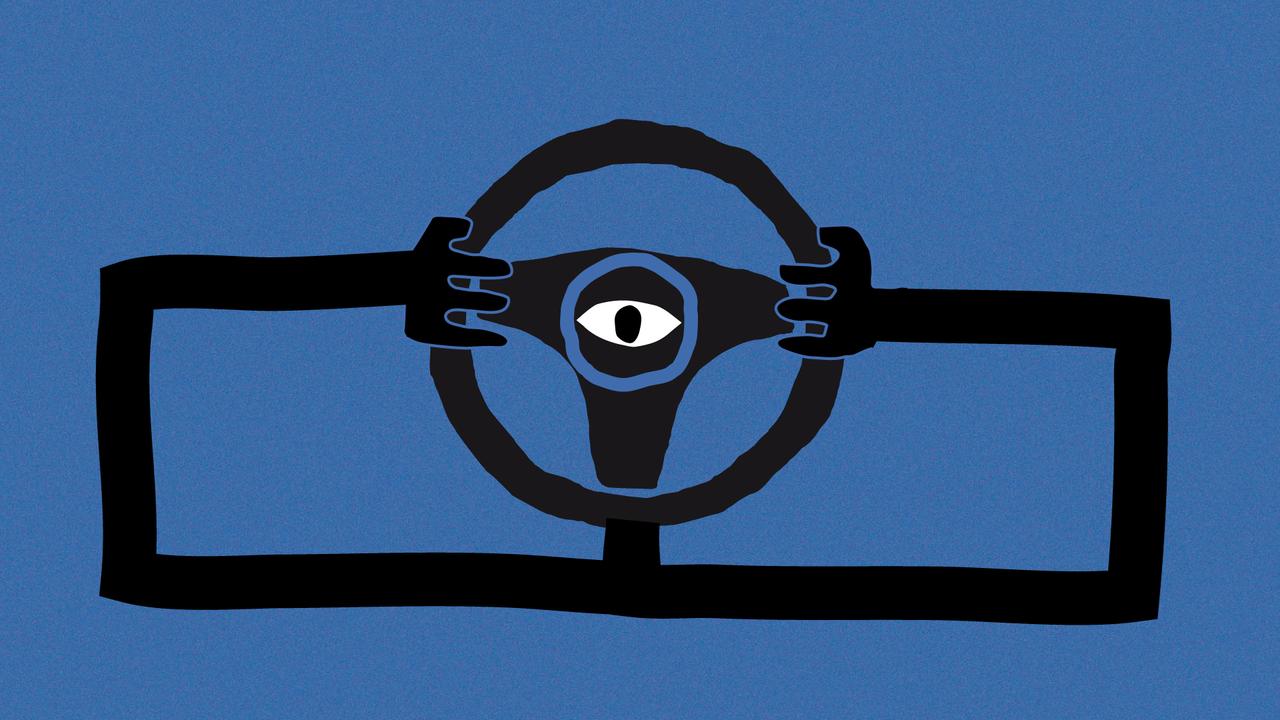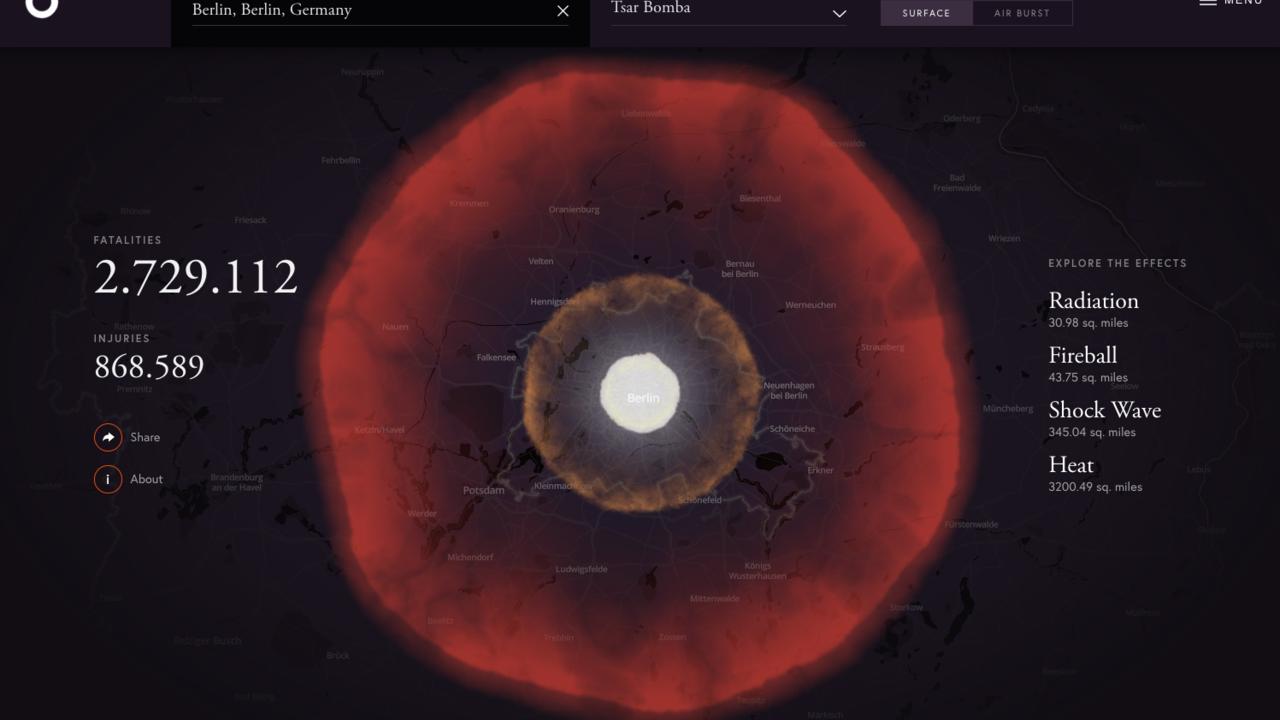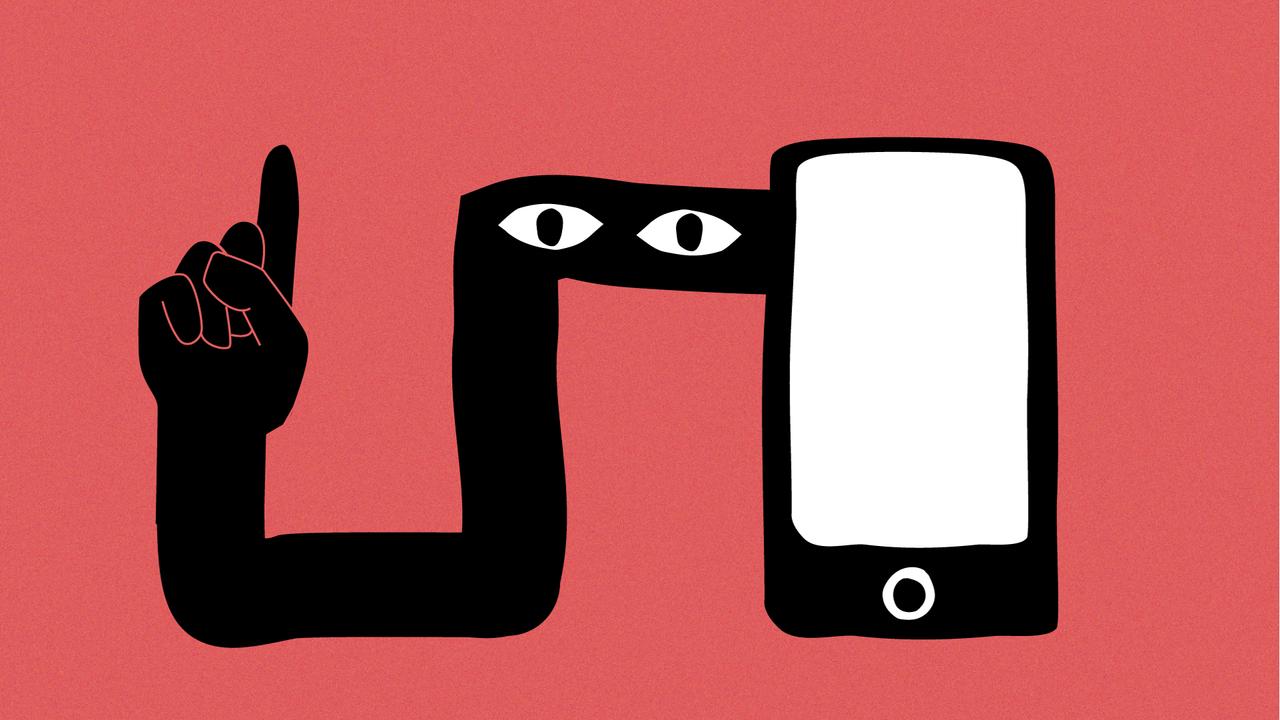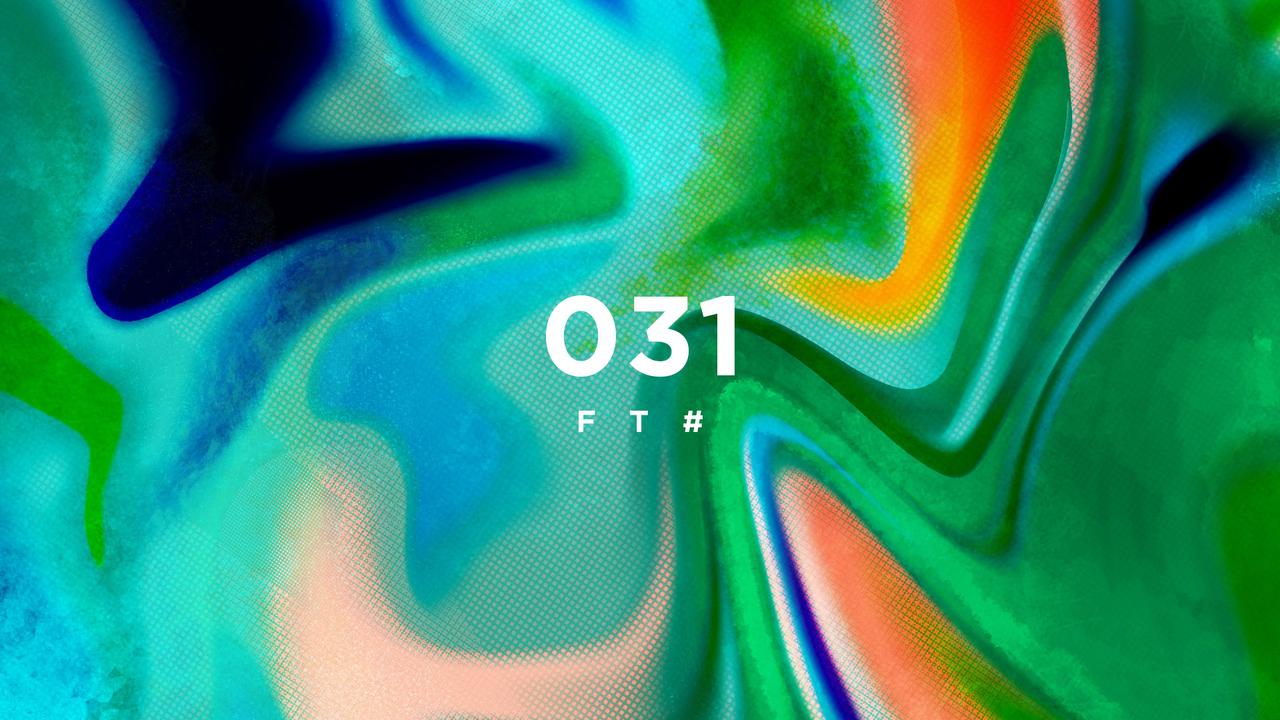„Meine Patienten haben keine Lobby“Die Ärztin Thea Jordan behandelt in Berlin Flüchtlinge und Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis
22.6.2018 • Gesellschaft – Interview: Monika Herrmann, Fotos: Benedikt Bentler
Eigentlich ist Thea Jordan schon im Rentenalter. Aber keine Spur von Ruhestand. Der Grund sind die Flüchtlinge in Berlin und deren Probleme, Sorgen und Krankheiten. Seit vielen Jahren begleitet Jordan diese Menschen – ehrenamtlich. Sie nennt das „Barfuß-Medizin“. Und die findet in einer Kreuzberger Kirche statt. Monika Herrmann hat die Ärztin dort besucht.
Frau Jordan, ich bin ein bisschen erstaunt. Ihre Praxis befindet sich in einer Kirche und ist ein kleiner Raum ohne technisches medizinisches Gerät. An eine Arztpraxis denkt man da nicht. Dabei kommen kranke Menschen hierher. Wie kriegen sie das hin?
Sehr gut sogar (lacht). Ich mache ja hier eine so genannte Barfuß-Medizin: Es gibt eine Behandlungsliege. Im Schrank liegen gespendete Medikamente für Notfälle, ich habe mein Stethoskop, ein Blutdruckmessgerät, und das reicht. Ich versuche meine jahrzehntelangen Erfahrungen als Ärztin einzusetzen. Natürlich komme ich da oft an die Grenzen meiner Möglichkeiten. Dann bin ich dankbar für die Hilfen, die ich von fachärztlichen Kollegen erfahre, die meine Patienten unentgeltlich weiter behandeln.
Diese Barfuß-Medizin scheint also gut zu funktionieren. Sie haben auf diese Weise schon vor ihrem Renteneintritt obdachlose Menschen medizinisch behandelt. Erzählen Sie!
Ja, das war nach der Wende und für mich eine ganz neue und wichtige Erfahrung – Menschen, die keine Krankenversicherung hatten und auf der Straße lebten, als Ärztin zu begleiten und ihnen beizustehen. Dann lernte ich die Flüchtlinge kennen, die den Berliner Oranienplatz in Kreuzberg besetzt hatten, und natürlich auch medizinische Hilfe brauchten. Ich habe andere Flüchtlinge auch in Zeiten ihres Hungerstreiks in Berlin mit anderen zusammen ehrenamtlich betreut. Wir haben ihnen auch geholfen, als sie in Notquartiere eingewiesen wurden und ihre Zukunft in Deutschland total unsicher war. Ich habe gemerkt, dass es für die Menschen wichtig war, einen Ort zu haben, an dem sie nicht nur mit ihren Krankheiten, sondern auch mit ihren anderen Problemen gehört, akzeptiert und willkommen sind.
„Viele meiner Patienten leben schon lange illegal in Deutschland.“
Hier in der Kreuzberger Flüchtlingskirche behandeln Sie seit rund vier Jahren wieder Menschen, die nicht nur krank sind, sondern auch viele andere Probleme haben. Wer sind jetzt Ihre Patienten?
Das sind in der Hauptsache Flüchtlinge. Aber auch Menschen ohne Krankenversicherung, ohne Papiere, die sich nicht in normale Berliner Arztpraxen trauen oder auch gar keinen Arzt finden, der sie behandeln würde. Menschen, die ich aber schon längere Zeit kenne, die Vertrauen zu mir haben. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Viele meiner Patienten leben schon lange illegal in Deutschland. Sie kennen sich auch nicht aus in unserem Gesundheitssystem, haben keine Arbeit, keine Unterkunft. Wenn sie krank sind, kommen sie hierher in die Praxis.

Wahrscheinlich sind sie vor allem psychisch krank, oder?
Als ich anfing mit dieser Praxis, gab es wenig psychisch Kranke. Das war so der Zeitpunkt, als die Patienten, die als Flüchtlinge kamen, noch Hoffnung hatten auf einen Neuanfang in Deutschland. Sie wollten etwas erreichen, haben auch dafür gekämpft. Das hat die psychischen Störungen erst mal zurückgedrängt. Die Patienten kamen deshalb überwiegend mit körperlichen Erkrankungen. Jetzt stelle ich mehr und mehr psychische Erkrankungen bei ihnen fest. Der Grund: Sie haben kein für sie sichtbares Ziel, sie leben ohne Struktur, sind enttäuscht, wissen nicht, was sie in Deutschland erwartet. Das macht sie krank. Viele brauchen professionelle Hilfe.
Gibt es Möglichkeiten, diese Patienten an Berliner Kliniken oder Fachärzte zu überweisen?
Natürlich. Auch Patienten, die illegal hier leben, werden im akuten Notfall in Kliniken behandelt. Wenn es sich um chronische Krankheiten handelt, wird es allerdings schwieriger. Es gibt aber eine ganze Reihe von Fachärzten in Berlin, die diese Patienten unentgeltlich behandeln. Prinzipiell macht sich kein Arzt strafbar, wenn er Menschen medizinisch versorgt, die keine Papiere haben. Da hat sich in den letzten Jahren viel geändert.
Flüchtlinge, sagen Sie, werden aber nicht selten auch in ganz normalen Arztpraxen abgewiesen.
Ja, das ist leider so. Grund ist oft die Sprachbarriere und die fremde Kultur. Die Patienten haben ein anderes Krankheitsverständnis, das man verstehen muss. Dazu kommt, dass viele Geflüchtete über ihre psychische Erkrankung nicht reden wollen: ein Tabu in vielen arabischen und auch in afrikanischen Ländern. Die Patienten fühlen sich durch die Krankheit stigmatisiert, weniger wertgeschätzt. Da kommen viele Dinge zusammen, so dass Patienten dann abgewiesen werden.
„Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass man als Ärztin helfen muss und zwar immer.“
Woher kommt ihr persönliches Engagement für diese Menschen?
Ich weiß, dass meine Patienten keine Lobby haben, bei Krankheit wenig oder oft gar keine Hilfe bekommen. Aber ich denke, dass mein Engagement auch mit meiner Erziehung zusammen hängt. Ich bin in einer Arztfamilie groß geworden. Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass man als Ärztin helfen muss und zwar immer und wenn nötig auch unentgeltlich. Das hat mich geprägt. Ich habe die Nachkriegsjahre erlebt – mit allen Nöten und auch mit dem Hunger. Ich weiß es zu schätzen, dass mein Leben relativ gut verlaufen ist. Da will ich jetzt etwas zurückgeben. Und ich schätze meinen Beruf. Deshalb ist die Sprechstunde hier eine Weiterführung meiner ehemaligen Arbeit.
Aber was macht das mit Ihnen, wenn Sie hier Menschen erleben, die psychisch am Ende sind, ohne Hoffnung leben und ihnen dann ihre Sorgen und Probleme erzählen? Leiden Sie mit ihren Patienten?
Das ist oft schwierig für mich. Aber als Ärztin habe ich gelernt, die Emotionen ein bisschen nach hinten zu schieben und mehr empathisch als emotional zu reagieren. Sonst könnte ich diese Arbeit nicht machen. Einen gewissen Schutzschild brauche ich schon. Was mich jetzt ein wenig betrübt ist, dass ich so wenig Einfluss auf die sozialen Bedingungen meiner Patienten habe. Denn das wäre wichtig, weil gerade diese bei vielen Geflüchteten auch Ursache für ihre Erkrankung sind. Sie sind ja oft traumatisiert. Da gab es Ereignisse in der Heimat, die sie jetzt krank machen oder die Situation während der Flucht. Und ganz oft sind es jetzt die Bedingungen in Deutschland, die sie nicht gesunden lassen. Sie sitzen in den Heimen, haben keine Arbeit und vor allem keine Perspektive.
Gibt es Grenzen ihrer ärztlichen Hilfe?
Natürlich. Wenn mir der Patient seine Geschichte erzählt und ich merke, er ist schwer traumatisiert, dann kann ich ihm hier in meiner Barfuß-Praxis kaum helfen. Natürlich höre ich ihm zu, das hilft ihm vielleicht kurzzeitig. Dann muss ich ihn an einen Kollegen oder in eine Klinik überweisen. Das ist sehr zeitaufwendig. Nicht nur die Suche nach einem Arzt: Der Patient muss von mir häufig auch begleitet werden. Zudem ist auch in einigen Fällen die Begleitung zu Institutionen, Behörden etwa, notwendig.

„In den Unterkünften kommen vor allem Männer mit ihren Problemen zu mir.“
Sie gehen auch in die Gemeinschaftsunterkünfte, in denen Geflüchtete oft schon sehr lange leben. Was erleben Sie dort?
In den Unterkünften kommen vor allem Männer mit ihren Problemen zu mir. Die geflüchteten Frauen und auch die Familien haben es manchmal leichter: Sie haben Kinder, tragen Verantwortung für sie und sie haben in der Regel weniger psychische Probleme als die allein eingereisten Männer. Aber diese Männer wollen dann über ihre gesundheitlichen Probleme erst mal gar nicht reden, oder es dauert sehr lange bis sie es tun. Aber sie leiden oft unter Depressionen, Panikstörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Dann versuche ich, sie an Kollegen, mit denen ich vernetzt bin, zu überweisen.
Hier gibt es also umfassende Hilfe.
Bei mir gibt es nicht die übliche Zehn-Minuten-Sprechstunde. Meine Patienten dürfen in aller Ruhe von ihren Problemen erzählen. Das ist für sie sehr wichtig. Wir lernen uns kennen, und hier in der Flüchtlingskirche können sie ja auch andere Hilfen in Anspruch nehmen. Es gibt eine Asyl- und Sozialberatung, Deutschunterricht, auch ein Café, in dem man Kontakt aufnehmen kann. Diese Vernetzung ist auch für mich natürlich wichtig.
Dass jetzt in Berlin und in anderen Bundesländern der anonyme Krankenschein kommen wird, ist ein großer Erfolg.“
Sie geben nicht so schnell auf.
Nein, das darf man auch nicht. Und es gibt ja auch Erfolge. Dass jetzt in Berlin und in anderen Bundesländern der anonyme Krankenschein kommen wird, ist nur der jahrelangen Arbeit von vielen zivilen Organisationen, engagierten Ärzten und deren ständigem Hinweis zu verdanken, dass es für viele Menschen eben ein Problem ist, ganz normal zum Arzt zu gehen, weil sie keine Chipkarte vorlegen können. Mit dem anonymen Krankenschein können sie nun genauso behandelt werden. Das ist ein großer Erfolg. In Bremen und Hamburg gibt’s das Modell schon lange. Es hat sich bewährt.
Ans Aufhören denken Sie nicht, oder?
Nein, im Moment nicht. Die Menschen hier sind mir wichtig. Ich weiß, dass sie meine Hilfe brauchen. Aber ich hoffe, dass vielleicht diese Sprechstunde hier in der Kirche einmal unnütz wird, weil sich die Lebenssituation meiner Patienten zum Positiven verändert hat.