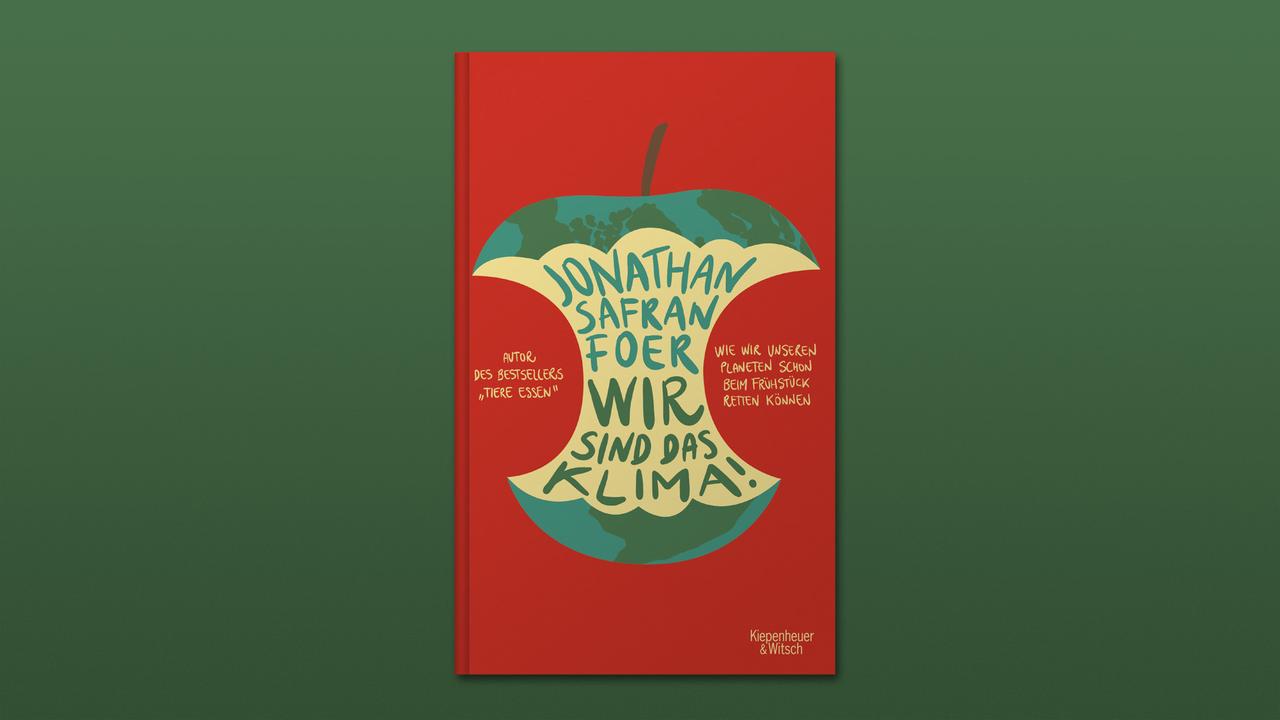Berlinale 2020Der tägliche Festivalblog der Filmredaktion
21.2.2020 • Film – Text: Christian Blumberg, Alexander Buchholz, Thaddeus Herrmann, Sulgi Lie, Tim Schenkl
Illustration: Susann Massute
Unsere Autoren Christian Blumberg, Alexander Buchholz, Sulgi Lie und Tim Schenkl berichten täglich über die aktuellen Favoriten des Wettbewerbs und versorgen euch mit Insiderinformationen zu den heißesten internationalen Neuentdeckungen.


Foto: Lee Kang-Sheng und Anong Houngheuangsy in Rizi / © Homegreen Films
1. März 2020
Rizi (Tsai Ming-Liang)
(Wettbewerb)
Sulgi: Die Fetischisierung von Slowness als unhinterfragte ästhetische Tugend ist in vielen festivalkonformen World Cinema Filmen leider schon zu einem Klischee geronnen. Was einst als radikale Freisetzung einer anderen Zeiterfahrung intendiert war, produziert oftmals nur ödeste Langeweile. Bevor der Schnitt kommt, ist man während vieler Long Takes schon längst eingeschlafen. Dem taiwanesischen Regisseur Tsai Ming-Liang kann man diese selbstzweckhafte Entschleunigung aber kaum vorwerfen, grundiert er doch die Langsamkeit immer in der spezifischen Trägheit des menschlichen Körpers in seiner Tätigkeit oder Untätigkeit: sitzen, liegen, laufen, kochen, essen, duschen, schlafen.
Dies ist auch in Rizi nicht anders, der fast wie ein Remake seines Klassikers The River (1997) anmutet: Tsais Alter Ego Lee Kang-Sheng hat es diesmal nach Bangkok verschlagen. Seine psychosomatischen Nackenschmerzen sind auch nach über 20 Jahren nicht verschwunden. Traf er im früheren Film jedoch in einer finsteren Szene auf seinen eigenen, unerkannten Vater in der Schwulensauna, fällt der Gay Sex diesmal trotz anonymer Transaktion deutlich lichter aus: Dem jungen Thailänder, den er zur Massage in sein Hotelzimmer bestellt, schenkt er im Anschluss eine kleine Musikwalze, die als Emblem der Zärtlichkeit die Tristesse und Einsamkeit der Männer für einen kurzen Augenblick vergessen macht. Aber in diesem Stummfilm der Körper gibt es auch extrem lustige Momente, in denen sich der Witz langsam der Slowness entwindet: Für eine bizarre Schmerztherapiesession hat Tsai einen ganz eigenen Hybridapparat aus Elektrostimulation, Akupunktur und Moxa erfunden, der auf dem Rücken des Protagonisten einen merkwürdigen Tanz aufführt: Slow Slapstick könnte man das auch nennen.


Foto: Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien / © Filmgalerie 451
29. Februar 2020
Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien (Bettina Böhler)
(Panorama Dokumente)
Christian: Die versehentliche Doppelbelichtung eines Filmstreifens sorgt beim 8-jährigen Christoph Schlingensief für Verzückung. Eigentlich nur ein kleineres Missgeschick, das seinem Vater im Urlaub unterläuft, doch Schlingensief hat die Doppelbelichtung später zum Ausgangspunkt seiner künstlerischen Praxis erklärt. Mit dieser Anekdote beginnt Bettina Böhler nicht nur ihren Film, sie nutzt die Mittel der Überlagerung auch selbst. Ihr Künstlerporträt ist eine zweistündige Montage aus Archivmaterial, Interviews und Filmausschnitten. Erzählen lässt Böhler Schlingensief selbst, das konnte der bekanntermaßen ja auch sehr gut. Die Regisseurin montiert ausschließlich O-Töne, die noch immer etwas Ansteckendes haben. Ganz überraschend ist diese Herangehensweise nicht, schließlich ist Böhler Filmeditorin. Sie hat als solche selbst mit Schlingensief gearbeitet (u.a bei Terror 2000 und Die 120 Tage von Bottrop) sowie später mit Regisseur*innen wie Angelea Schanelec, Christian Petzold oder Valeska Grisebach.
Schlingensiefs Wirken wird oft in Phasen erzählt: Da sei der krawallige Provokateur und Aktivist gewesen, der mit der Flüstertüte durch die Welt lief und in dessen Händen alles zum Spektakel geriet. Später dann der Gereifte, der Bayreuth- und Operndorf-Schlingensief: Einer, der von den B-Movies in den arrivierten Kunstbetrieb gefunden hatte, vom Kunstblut zu den existenziellen Themen: Kirche, Wagner, Angst und Tod. Böhlers Film ist nun eine teilweise Überschreibung dieses Narrativs. Zwar arbeitet er sich weitgehend chronologisch durch ein Lebenswerk, doch sucht und findet er darin die Kontinuitäten. Der junge Schlingensief wirkt da manchmal ganz weise. Böhlers Montage nimmt Motive auf, spielt sie in immer neuen Variationen durch und erschliesst fast beiläufig ein Werk, sodass der Weg von Menu Total nach Bayreuth am Ende gar kein so weiter scheint. Schon immer, erklärt Schlingensief einmal im Interview mit Alexander Kluge, sei seine Kunst Überlebenskunst gewesen. Schlingensiefs Tod jährt sich dieses Jahr zum zehnten Mal. Mit einem Film war zu diesem Anlass zu rechnen. Gut, dass es dieser geworden ist.


Foto: Kim Minhee und Song Seonmi in Domangchin yeoja / © Jeonwonsa Film Co. Production
28. Februar 2020
Domangchin yeoja – The Woman Who Ran (Hong Sangsoo)
(Wettbewerb)
Tim: Viele Filme von Hong Sangsoo unterliegen einer Zweiteilung. Für sein neues Werk Domangchin yeoja, das am Dienstag im Wettbewerb seine Weltpremiere feierte, wählt der koreanische Regisseur jedoch eine dreigeteilte Form. The Woman Who Ran ist der englische Titel des Films, und die Frau, die (davon)rannte, ist die Blumenhändlerin Gamhee, gespielt von der Silbernen-Bären-Gewinnerin und Lebensgefährtin von Hong Sangsoo, Kim Minhee.
Zu Beginn von Domangchin yeoja kehrt Gamhee in einen Außenbezirk Seouls zu Füßen des Inwang Berges zurück. Hier trifft sie nacheinander auf mehrere Frauen, mit denen sie lange Gespräche führt. Vermutlich hat Gamhee den Bezirk einst verlassen, sicher wissen wir es nicht, nachdem die Kulturarbeiterin Woojin, Gamhees Gesprächspartnerin aus der dritten Episode, ihr den Freund, einen deutlich älteren Schriftsteller, ausgespannt hatte. Doch bevor es zu der Begegnung mit Woojin kommt, bezieht Gamhee, die seit fünf Jahren mit einem Mann zusammen ist und von diesem auf seinen Wunsch bisher noch keinen Tag getrennt war, erst einmal ihre Unterkunft bei der geschiedenen Youngsoon. Diese hat sich von ihrem Scheidungsgeld ein Apartment gekauft, welches sie mit ihrer Mitbewohnerin Youngji teilt. In dem dazugehörigen großen Garten hält Youngsoon sich einige Hühner und pflanzt Gemüse an. In der zweiten Episode besucht Gamhee die Pilateslehrerin Suyoung, die vorhat, in Zukunft vor allem das Leben zu genießen. In der dritten Episode trifft Gamhee dann durch Zufall auf die nun mit dem älteren Schriftsteller verheiratete Woojin.
Alle Filme von Hong Sangsoo gleichen sich stark in Form und Inhalt, und auch Domangchin yeoja ist mit seinen langen Einstellungen und präzisen Zooms wieder ein typischer Hong-Film geworden. Auch die Liebe zu Flora und Fauna ist für Kenner seines Werkes natürlich nichts Neues, sie wird in Domangchin yeoja jedoch besonders offensichtlich ausgelebt. Hühner und Katzen bevölkern den Bildkader, jedes Fenster im Film blickt in die Natur hinaus, und es wird ausführlich über die Vorteile des Vegetarismus diskutiert. Fast erscheint Domangchin yeoja wie ein Appell für ein harmonischeres Miteinander von Mensch und Natur.
Was zum Gefühl der Harmonie beiträgt ist die fast komplette Abwesenheit von männlichen Charakteren. Zwar tauchen einige von ihnen auf, sie wirken dabei aber wie kurze Störfaktoren in der Welt der Frauen und werden von der Kamera geradezu ignoriert und fast ausschließlich in der Rückenansicht gezeigt. Die Frauen in Domangchin yeoja scheinen wunderbar ohne sie auszukommen: Sie braten ihr Fleisch selbst, schneiden sich alleine die Haare, züchten ihr eigenes Gemüse und verhalten sich untereinander solidarisch.
In einer Szene erzählt Youngji von einem bösen Hahn, der um seine Vormachtstellung zu bewahren, den Hennen wiederholt in das Gefieder am Hals pickt. Dabei bekommt man als Zuschauer*in schnell das Gefühl, dass hier eigentlich von einer ganz anderen Art von Gockel gesprochen wird. Männer, wer braucht die eigentlich? In diesem Film zumindest niemand.


Foto: Sidney Flanigan in Never Rarely Sometimes Always / © Focus Features
27. Februar 2020
Never Rarely Sometimes Always (Eliza Hittman)
(Wettbewerb)
Christian: Nachdem Garrel und Ferrara sich im Wettbewerb an der männlichen Psyche abgearbeitet hatten, kam dann Eliza Hittmans Never Rarely Sometimes Always. Der Titel rekurriert auf die Antwortmöglichkeiten, die der 17-jährigen Autumn zur Verfügung stehen, als sie in einer Abtreibungsklinik zu den Umständen ihrer Schwangerschaft befragt wird. Hittman zeigt dies in einer langen, ungeschnittenen Einstellung. Es ist die Szene, die beim Publikum den Verdacht erhärtet, Autumns Schwangerschaft könnte die Folge sexuellen Missbrauchs sein. Im Ankündigungstext des Festivals heisst es, die Szene werde „aus dem feministischen Kino künftig nicht mehr wegzudenken sein“. Noch besser wäre es allerdings, dies würde nicht nur für das feministische, sondern für das Kino überhaupt gelten.
Eliza Hittmans Film zeichnet seine Hauptfigur jedoch nicht nur als Opfer. Weil Autumn die Abtreibung in ihrer Heimat Pennsylvania nicht legal vornehmen lassen kann, fahren sie und eine Freundin auf eigene Faust nach New York. Die jungen Frauen verbindet dabei eine Solidarität, die fast ohne Worte auskommt. Und der Wille, diese Sache hinter sich zu bringen. Das wird am Ende ganze drei Tage dauern. Für diesen gänzlich unromantischen Roadtrip wählt Hittman einen realistischen, fast schön kühlen Duktus des Erzählens. Die Kamera sucht zwar offensiv die Nähe zu den Figuren, doch befindlich wird es nie. Auch der Score von Julia Holter hält sich zurück. Anstatt mit inszenatorischen Mitteln um Mitleid für seine Protagonistin zu werben, begleitet Never Rarely Sometimes Always – nah aber nüchtern – eine Person, die den Widrigkeiten eines beschissenen Lebens nicht zuletzt mit Trotz begegnet. Ganz leise formuliert sich dabei sogar so etwas wie Hoffnung.

27. Februar 2020
The Roads not Taken (Sally Potter)
(Wettbewerb)
Sulgi: Wenn die emotionale Ausschlachtung von Krankheit und Behinderung seit jeher zum festen Register des Arthousekinos gehört, dann ist Javier Bardem nicht weit. Durch so viele Schmonzetten hat sich der Spanier schon gejammert und gewimmert, dass das Porträt eines Alzheimer-Patienten wie in Sally Potters Wettbewerbsbeitrag fast schon eine Routineübung in jener Art billiger Empathieerpressung ist, auf die es auch die britische Regisseurin abgesehen hat. Diesmal plagen den spanischen Schmerzensmann neben der Amnesie auch noch ein Trauma (ja klar), Schreibblockaden (klar, er ist natürlich ein Schriftsteller) und seine verkniffene Lust auf junge Frauen (auch klar). Wie gut, dass es da all die Frauen in Vergangenheit und Gegenwart gibt, die ihn hegen und pflegen, ob nun Salma Hayek als Ex, Laura Linney als Ex-Nr.2 oder Elle Fanning als Tochter. Wann immer ein kleines oder großes Gebrechen, die Frauen sind sofort an Ort und Stelle. Aua!
Am Ende fällt ein Satz aus dem Mund der Tochter, der an Dummheit kaum zu überbieten ist, nachdem Javier seine Elle vielleicht doch noch im Hirn gespeichert hat: „You are always you!“ Nochmal: Aua! The Roads not Taken ist ein Film, der „better not to be made“ wäre. Aber zur Dialektik des Festivalviewings gehört es vielleicht auch, sich durch solch einen nichtigen Film zu quälen, um dann einen großen Film wie Eliza Hitmans Never Rarely Sometimes Always richtig würdigen zu können.


Foto: Willem Dafoe in Siberia / © Vivo film, maze pictures, Piano
26. Februar 2020
Siberia (Abel Ferrara)
(Wettbewerb)
Christian: Abel Ferraras Neigung, den eigenen Kopf zu verfilmen, ist bekannt. So konsequent wie in Siberia hat er die filmische Selbstfindung aber bislang noch nicht betrieben. Ein Mann (natürlich ist es Ferrara selbst, natürlich spielt ihn Willem Dafoe) lebt in einer Berghütte. Der Schnee um sie herum scheint kontaminiert, er schimmert grünlich. Doch unter der Hütte tut sich der Schlund zur Hölle auf. Und die Hölle, das ist das Eigene. Die Ferrara/Dafoe-Personalunion trifft dort die Dämonen der eigenen Vergangenheit: die Unzulänglichkeiten, die Familie, die Frauen, die Männlichkeit, die Abgründe, die Kindheit. Siberia ist eine Reise in den Schmerz. „Time will pass and you will continue to be lost.“ bekommt Ferrara/Dafoe mit auf den Weg gegeben. Und dann geht man mit ihm durch einen Irrgarten von einem Film. Vielleicht ist es aber auch kein Irrgarten, sondern eine Couch.
Eine ganzes Arsenal verstörender Motive wird hier aufgefahren, und manchmal gelingt es Siberia, eigene Bilder zu finden. Oft gelingt es aber auch nicht: Eine nackte kleinwüchsige Frau im Rollstuhl kommt aus einem Lynch-Film vorbei. Eine nackte, dicke, tanzende Frau aus einem von Fellini. Dann gebiert eine nackte alte Frau einen blutigen Klumpen. Viele nackte schrumpelige Männer gibt es auch. Sie tragen statt eines Genitals klaffende Wunden. Darüber hinaus Lazarette. In Afrika. Weltkrieg. Death Metal und Dunkle Magie. Und irgendwo dazwischen Ferraras (wirkliche) Tochter, die Ferraras (wirklichen) Sohn spielt.
Ob der Vater hier scharf mit sich ins Gericht geht oder ob sein Film doch vor allem hemmungslos selbstmitleidig ist, bleibt mitunter schwer zu entscheiden. Die überraschende Erkenntnis kommt nach dem Film, denn der lässt sich dann doch in seiner Gesamtheit erstaunlich gut ansehen. Vielleicht liegt es an Stefano Falivenes fliegender Kamera oder an der Musik vom Soundwalk Collective. Vielleicht daran, dass gelegentlich doch so etwas wie Selbstironie in den Film bricht. Vielleicht bleibt es aber auch ein Geheimnis und als solches tief verborgen. In Ferraras Kopf.


Foto: Lilith Stangenberg in Orphea
26. Februar 2020
Orphea (Alexander Kluge / Khavn)
(Encounters)
Christian: Diese Berlinale ist auch die des Alexander Kluge. Der Godfather des Neuen Deutschen Films hat in der Volksbühne eine das Festival begleitende Ausstellung namens Das Theater Des Kinos eröffnet, das Jubiläumsprogramm des Forums zeigt seinen Science-Fiction-Essay Der Große Verhau von 1971, und in der neuen Festival-Reihe Encounters ist Orphea zu sehen, eine Kollaboration mit dem philippinischen Regisseur Khavn de la Cruz. Dessen Wirken beschränkt sich – wie Kluges – nicht aufs Filmemachen, Khavn tritt auch als Sänger und Musiker in Erscheinung. In ihrer zweiten Zusammenarbeit nach Happy Lamento (2018) haben die beiden den antiken Mythos um Orpheus adaptiert und dabei ein paar Rollen verdreht: Aus der Gestalt des Orpheus, der vergeblich versucht, seine Eurydike dem Totenreich zu entwinden, wird bei Kluge & Khavn eine Orphea.
Kluges intellektuelle Fantasien und Khavns rohes Impro-Kino ergänzen sich dabei überraschend gut, vielleicht weil beide theaterhafte Elemente betonen. Heraus kommt ein Experimentalfilm als Bühne für Lilith Stangenberg, die sich in der Rolle der Orphea durch von Khavn wild montierte Performances tobt, nur um einige Schnitte später in Settings von Kluges erprobten dctp-Formaten zu erscheinen, wo sie inszenierte Interviews gibt oder – öfter noch – singt. Denn weil Orpehus bekanntlich ein Sänger war, ist Orphea eben auch: ein Musical. Unterbrochen nur von Kluges inzwischen fast schon ikonisch wirkenden Texttafeln.

25. Februar 2020
Last and First Men (Jóhann Jóhannsson)
(Berlinale Special)
Thaddeus: Je länger Jóhann Jóhannsson tot ist, desto öfter frage ich mich: Welche seiner Werke werden wirklich für lange Zeit, vielleicht sogar für immer, also bis zum Ende der Erde oder zumindest der Kultur, so wie wir sie erkennen, nachhallen? Als überzeugter Fanboy des isländischen Komponisten überrascht es mich selbst, dass ich mir diese Frage ernsthaft stelle – und kann berichten, dass sein Film Last and First Men nicht dazugehören wird. Der Kniff seiner dokumentarischen Beobachtung ist so überraschend wie offensichtlich. Jóhannsson montiert smoothe Kamerafahrten kreuz und quer durch die „Spomeniks“, also die von Tito in Auftrag gegebenen brutalistischen Denkmäler, die der Natur im ehemaligen Jugoslawien eine mitunter furchteinflößenden Touch gaben und geben, orchestriert Musik dazu und lässt Tilda Swinton Auszüge aus „Last and First Men“ von Olaf Stapledon lesen. Das macht alles Sinn, zumindest auf dem Papier. Der Brutalismus signalisiert Aufbruch, Zukunft, einen radikalen Bruch mit Traditionen, getaucht in überwältigende Überforderung. Der Science-Fiction-Roman von 1930 beschreibt detailliert und emotional genau diese Zukunft. Und die Bilder der Denkmäler, die heute zerfallen, sind die verbindende Bruchstelle.
Das lässt sich als epische Parabel der Menschheitsgeschichte lesen oder auch nur als abstrakte Interpretation von Titos Vision des Sozialismus – faktisch jedoch ist es eine nicht enden wollende Zeitlupe, die zwar grau in grau fotografiert ist, dafür aber ziemlich grell nervt. Die Musik ist wahnsinnig toll. Die Bilder sind jedoch auf 70 Minuten Länge eher etwas für diejenigen, die Beton wirklich erotisch finden. Und Tilda Swinton hat den Text-Duktus zwar genau verstanden und trägt mehr als angemessen vor – auf die Makros zerbröselnden Betons jedoch wollen sie einfach nicht passen. Immerhin weiß ich jetzt, dass Michel Granger auch Fan der Spomeniks war, als er für Jean-Michel Jarre das Artwork für Equinox anfertigte.


Foto: Julia Garner in The Assistant / © Forensic Films
25. Februar 2020
The Assistant (Kitty Green)
(Panorama)
Christian: Ein Film im nüchternen Beige-Grau eines Laserdruckers. Einen Bürotag lang ein Blick auf die hierarchische Organisation von Arbeit. Julia Garner als namenlose Assistentin in einer Produktionsfirma; verrichtet die Care-Arbeit, wischt Schreibtischoberflächen, holt Sandwiches, stellt Telefonate durch. Junge Frauen sitzen in den Warteräumen. Der Chef tauscht Berufsaussichten gegen sexuelle Dienste. Jeder Einwand verpufft noch bevor er nach außen dringt. Das ist systemimmanent geregelt. Mit über 100 Frauen hat Kitty Green vor dem Dreh gesprochen, dem Chef aber verwehrt sie ein Gesicht. Er bleibt ein akusmatisches Wesen, eine Stimme aus dem Nebenraum: Greens Präzisionskino inszeniert ihn als strukturelles Problem.


Foto: Paula Beer und Franz Rogowski in Undine / © Marco Krüger/Schramm Film
24. Februar 2020
Undine (Christian Petzold)
(Wettbewerb)
Alexander: Nach Transit, seinem Berlinale-Wettbewerbsbeitrag vom vorletzten Jahr, bringt Christian Petzold für Undine wieder Paula Beer und Franz Rogowski in einem Melodram zusammen, nur um sie dann wieder auseinanderzureißen: Die Sage der Undine, angesiedelt im sehr jetzigen Berlin (und auf einigen anonymen Bahnhöfen im Ruhrgebiet), erzählt als vordergründig luftige Liebesgeschichte über die Frage, ob man Verliebtsein unbeschadet überstehen kann. Und wer oder was eigentlich daran Schuld ist, dass es immer in einer Tragödie münden muss. Petzolds Männer kommunizieren bekanntermaßen ziemlich ungeschickt, und die verdruckste Art und Weise, wie Johannes (Jacob Matschenz) Undine (Beer) am Anfang des Films für eine Andere verlässt, steht dafür ganz exemplarisch. Undines Antwort ist dagegen völlig klar und unmissverständlich: Er kann nicht gehen! Wenn er es doch tut, muss er sterben. Christoph (Rogowski), der Johannes’ Platz einnimmt, scheint sich zunächst weniger ungelenk anzustellen. Doch schon bald sabotiert auch sein Begehren die Magie zwischen den beiden, da auch er nicht weiß, wann man seine Liebe festhalten muss und wann man sie besser loslässt.
Niemand im deutschen Kino kann so über verpasste Chancen und über das Verlorensein erzählen wie Petzold. Und mit Beer und Rogowski hat er genau die richtigen Gesichter und Körper gefunden, um diese Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Dass Undine mich nicht vollends begeistert hat, liegt eigentlich nur daran, das Petzold mit seinen Vorgängerfilmen Barbara, Phoenix und eben Transit dieselbe Figurenkonstellation schon dreimal perfekt abgeliefert hat. Undine ist daher auch mehr Fußnote als ein ernstzunehmender Kandidat für den diesjährigen Bären. Dennoch, gebt Petzold doch bitte endlich mal den Hauptpreis, ja? Schon allein, um den Fehler von 2018 wiedergutzumachen. Touch Me Not? Pfff, eher Watch Me Not. Ok (hüstel), entschuldigt bitte! Ich hab den ja noch nicht einmal gesehen. Hat den eigentlich irgendjemand gesehen?


Foto: Marie Tragousti in Nackte Tiere / © Czar Film
24. Februar 2020
Nackte Tiere (Melanie Waelde)
(Encounters)
Tim: Im Cinemaxx 7 herrschte am Freitag eine aufgeregte Stimmung, wie so häufig, wenn Berliner Regisseur*innen bei der Berlinale ihre Weltpremiere feiern und viele Bekannte, Verwandte und Team-Mitglieder anwesend sind. In seiner sympathischen kurzen Einführung zu Nackte Tiere sprach Carlo Chatrian von der Kraft der Jugend, die in dem Debütfilm der DFFB-Absolventin Melanie Waelde spürbar werde. Kraft ist das richtige Stichwort, denn die fünf Jugendlichen auf der Leinwand tun während der 83 Minuten vor allem eins: ihre Kräfte messen – mit den Eltern, mit ihren Lehrern, untereinander. Katja, Sascha, Benni, Laila und Schöller stehen wenige Monate vor der Abiturprüfung. Die Konstellationen untereinander sind fluid, das sexuelle Begehren auch.
Es ist Winter, und die Orte, an denen sich die Jugendlichen aufhalten, wirken denkbar trist. Eine Sporthalle, eine Wohnung im Plattenbau, ein Feld mit Elektromasten, ein heruntergekommener Klassenraum in der deutschen Provinz: Hier möchte man nicht lebendig begraben sein.
Sascha und Katja tun sich beim Kräftemessen besonders hervor. Das regelmäßige gemeinsame Jiu-Jitsu-Training unter Leitung eines Polizisten reicht ihnen nicht. Immer wieder brechen spontane Keilereien zwischen den beiden aus, die ihrer Freundschaft jedoch keinen Abbruch tun, sondern sie eher stärken.
Für die Regisseurin Melanie Waelde ist die Kinoleinwand offensichtlich kein Möglichkeitsraum, dem ein utopisches Potential innewohnt. Ihre Protagonist*innen scheinen vielmehr in einem Unmöglichkeitsraum gefangen zu sein, was sich auch in der Wahl des beengten, fast-quadratischen Bildformats widerspiegelt. Katja, großartig gespielt von Marie Tragousti, vielleicht die Entdeckung des Festivals, sieht nach dem Abitur nur einen Weg hinaus aus dem Elend, und der ist die Bundeswehr. Benni ist irgendwann einfach weg, und dem Rest blüht ein Leben mit Haus und Kindern an diesem Nichtort. Fridays for No Future.


Foto: Le sel des larmes / © Rectangle Productions - Close Up Films
23. Februar 2020
Le sel des larmes – The Salt of Tears (Philippe Garrel)
(Wettbewerb)
Christian: Philippe Garrels Verdienste in allen Ehren, aber was sein ungefähr 30. Spielfilm Le sel des larmes in einem Wettbewerb des Jahres 2020 zu suchen hat, erschließt sich nur schwerlich. Le sel des larmes ist ästhetisch wie inhaltlich in einer sehr französischen 60er-Jahre-Welt hängengeblieben. Hier gibt es wehmütig plätschernde Klaviermusik, schwarz-weiße Bilder und einen auktorialen Erzähler. Fast schon kaschiert wird, dass dieser Film nicht nur im Jahr 2019 entstanden, sondern dort auch angesiedelt ist: Die jungen Menschen tragen zeitlose erwachsene Kleidung, notieren Telefonnummern noch handschriftlich und wollen Berufe wie den des Kunsttischlers erlernen. Wie eigentlich immer bei Garrell geht es um die Wirrungen im ewigen Game der heterosexuellen Liebe.
Der junge Luc ist ein Aufreißer und in Beziehungsdingen – pardon my french – ein komplettes Arschloch. Auch sonst verhält er sich unsympathisch bis übergriffig, verfolgt junge Frauen auf der Straße und verweist sie der Wohnung, sollten sie beim ersten Date nicht mit ihm schlafen wollen. Jene, die sich auf ihn einlassen (und das sind eigentlich alle), bringt er an den Rand der Verzweiflung. Zwar wird Luc am Ende für sein Verhalten bestraft, trotzdem stellt sich unentwegt die Frage, ob Garells Film überhaupt weiß, wie unangenehm seine Hauptfigur eigentlich ist. Oder soll Le sel des larmes am Ende gar eine Satire auf die Sexismen der Nouvelle Vague sein? Leider nein. Denn schlussendlich widmet der Film sich immer bloß den männlichen Befindlichkeiten. Luc ghostet seine Partnerinnen oder lässt sie abtreiben, alles egal. Erzählt wird von seinen Leiden an der Welt und dass die wahre Liebe für Luc so schwer zu finden ist. Die Frauenfiguren bleiben im Vergleich Staffage. Dafür bedenkt Garrel jede von ihnen mit mindestens einer Nacktszene. Vielleicht muss die Welt ja auch Platz für Altherren-Kino haben, aber hier beginnt es schon unappetitlich zu riechen.


Foto: Malembe von Luis Arnías
23. Februar 2020
Interview Dennis Vetter (WdK)
Tim: Die von Filmkritiker*innen ins Leben gerufene Woche der Kritik findet parallel zur Berlinale in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Ich habe dem Programmleiter Dennis Vetter drei schnelle Fragen gestellt.
Was passiert in diesem Jahr bei der Woche der Kritik?
Am heutigen Sonntag trifft eine Komödie aus Nigeria über Tradition und Gegenwart auf eine filmische Performance aus Brasilien, die ganz ernsthaft und gleichzeitig beschwingt ist. Am Dienstag folgt ein intensiver italienischer Dokumentarfilm aus der Mitte einer Kampfsport-Sekte auf die Dekonstruktion einer Gemeinschaft von Jugendlichen im tiefen Westen Deutschlands. Und am Donnerstag zeigen wir zum Abschluss das Debüt der Hochschulabsolventin Salka Tiziana aus Hamburg, die in den spanischen Bergen ein neues Verhältnis zur Zeit auslotet. Das ist wunderbar elegisch, wie man es selten vom deutschen Kino kennt. Unter dem Titel „Slow Cinema Fast“ begegnet ihr Film der Weltpremiere von Malembe, der zwischen den USA und Venezuela entstand und in einer aufregend-experimentellen Struktur Momente des Alltags in einen beinahe magischen Rhythmus überführt.
Das Prinzip der Woche der Kritik ist es, Dialoge und Reibungen zwischen Filmen zu schaffen und diese dann zu diskutieren. Dabei analysieren und sträuben wir uns gegen die Reflexe, die den Filmbetrieb und die Festivallandschaft viel zu oft prägen. In konzentrierten Gesprächen denken wir über das Kino, über Bilderpolitik und Gesellschaft nach. Dabei wollen wir herausfinden, welche blinden Flecken der Festivalbetrieb der Berlinale und andernorts aufweist und welche Begriffe unsere Gäste eigentlich vom Kino haben.
Was wäre so ein blinder Fleck?
Affirmative Riten, wie sie im Kontext von Festivals verbreitet sind, wollen wir durchbrechen. Ein neues Format stellt das dieses Jahr besonders heraus: In Streitgesprächen begegnen sich auf der Bühne jeweils zwei Kritiker*innen und diskutieren über ihre Gedanken zum vorausgegangenen Filmprogramm. Am 23. Februar sind das Wilfred Okiche aus Nigeria und Senem Aytaç aus der Türkei. Am 26. Februar begegnen sich die Französin Xanaé Bove und der Brite Neil Young, die beide Filme machen und über sie schreiben.
In unserer diesjährigen Eröffnungskonferenz haben wir versucht, die Vielgestaltigkeit und den Pluralismus der Filmlandschaft zu betonen sowie den Umstand, dass sich Gespräche über das Kino nicht unter einem Thema zusammenfassen lassen. Während die Berlinale sich unter neuer Leitung auf die eigene Identität besinnt, haben wir unsere Autorität als Kritiker*innen und Kurator*innen bei der Veranstaltung in Frage gestellt. Unser Selbstverständnis schließt ein, die Positionen unserer Gäste immer wieder auf die eigenen treffen zu lassen. Was uns dabei grundlegend interessierte: Wie funktioniert eigentlich Solidarität im Kulturbetrieb?
Die Berlinale wurde um die Sektion Encounters erweitert, die sich zum Ziel gesetzt hat, ästhetisch und formal ungewöhnliche Werke von unabhängigen Filmemacher*innen zu zeigen. Inwieweit entsteht für euch dadurch eine Konkurrenzsituation?
Konkurrenz ist ein Begriff, der sich als kapitalistisches Gegenteil von Solidarität begreifen lässt. Die Disziplin der Kritik, aus der die Woche der Kritik entstanden ist, ist aber keine kapitalistische Disziplin – sondern eine, die sich der Weiterentwicklung der Kultur und Gesellschaft widmet. Eine Festivalsektion wie Encounters als Teil eines Premierenfestivals steht unter einer kuratorischen Autorität, schafft einen Markt, ein Publikum und eine Verwertungslogik. Bei der Woche der Kritik rotiert das Programmteam, die Filme laufen unter anderen Vorzeichen und oft frei von Premierenzwängen. Bei der Woche der Kritik wollen wir Fragen stark machen, die sich über kuratorisches Territorialdenken und Statuspolitik hinwegsetzen und die dazu beitragen, das Kino und die freiheitlichen Kräfte in der Kultur in Bewegung zu halten. Diese Fragen zu stellen, bleibt wichtig.

23. Februar 2020
First Cow (Kelly Reichardt)
(Wettbewerb)
Christian: „History isn't here yet“ heißt es in First Cow einmal über das gerade erst dünn besiedelte Oregon des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte vielleicht nicht, der Kapitalismus aber schon. Eine weltgewandter Chinese und ein tierliebender Koch versuchen sich hier als Geschäftsmänner. Die US-amerikanische „frontier“ ist im Kino meist Territorium goldhungriger Rauhbeine. Reichardts Figuren sind hingegen für den Wilden Westen irgendwie zu zart. Und so bieten sie frittierte Teigwaren an. Nur Geld für die Zutaten ist keines vorhanden. Deshalb schleichen sie regelmässig auf den Grund eines im Biberpelz-Business zu Wohlstand gekommenen Briten und melken im Schutz der Nacht dessen Kuh – Kapital und Verbrechen können im Geschäftswesen sehr ähnliche Funktionen haben. Sätze wie diese hört man in den USA dieser Tage vor allem im schrillem Tonfall eines Bernie Sanders. Bei Kelly Reichardt gerät diese Feststellung dagegen ganz still und unaufdringlich.
Dass eine Regisseurin einen Film über ein paar Liter gestohlene Milch dreht, von dessen Plakat eine freundliche Kuh blinzelt, daran zeigt sich auch, dass Reichardt inzwischen in einer eigenen Sphäre des Filmemachens angelangt ist. Mit Zuschreibungen wie „Independent-Kino“ oder „Anti-Western“ ist ihrem Wettbewerbsbeitrag jedenfalls kaum beizukommen. First Cow ist ein kleines Wunder, in dem erzählerische Langsamkeit niemals Schwere bedeutet. Der Zubereitung des Proto-Streetfood möchte man stundenlang zusehen, ohne dass Reichardt sie dafür zum sinnlichen Akt stilisieren müsste. Meist aber bleibt sie – wie schon in wie in Meek’s Cutoff oder Night Moves – ganz nah bei ihren Figuren und der Natur (die 35mm Aufnahmen von Kameramann Christopher Blauvelt ringen noch dem tristesten Gebüsch texturale Qualitäten ab). Trotz dieser Nähe hat ihr Film mehr über Ökonomie und die Netzwerke des Sozialen zu erzählen als manch ausgeklügelter Wirtschaftsthriller – und dabei auch noch Zeit für einen diskreten Humor, der sich bis in die Erzählung schleicht: Ausgerechnet der betuchte Brite wird zum besten Kunden jener, die ihn zuvor bestohlen haben.


Foto: Sa-nyang-eui-si-gan / © 2020 UNION INVESTMENT PARTNERS, LITTLEBIG PICTURES, SIDUS. All Rights Reserved.
22. Februar 2020
Sa-nyang-eui-si-gan – Time To Hunt (Yoon Sung-hyun)
(Berlinale Special)
Christian: Mit seinem zweiten Spielfilm verbeugt sich der 37-jährige Yoon Sung-hyun vor jenen Spielarten des US-Actionkinos der späten 70er- und 80er-Jahre, in denen Männer mit Handfeuerwaffen es auf andere Männer mit Handfeuerwaffen abgesehen haben. Schon in den ersten Minuten migriert Sa-nyang-eui-si-gan ikonische New York-Bilder ins Seoul einer nahen Zukunft: Heruntergekommen und in dichten Smog gehüllt, stolpert die Stadt durch Zeiten schwerer wirtschaftlicher Rezession. Was als Buddy-Movie beginnt, bekommt nach und nach eine Härte, wie man sie insbesondere bei der Berlinale nicht häufig antrifft.
Drei Beinahe-Noch-Jugendliche wollen ein illegales Casino überfallen („Das eine, das todsichere Ding“), legen sich dabei aber mit einem mächtigen Kartell an, welches nun einen schweigsamen, diabolischen Killer auf sie ansetzt: „Time To Hunt“. Die Jagd vollzieht sich in düsteren und unübersichtlichen Settings: Tiefgaragen, Krankenhäuser bei Nacht, Hafenanlagen. Dass dort nichts wirklich Überraschendes geschieht, dass die Dialoge standardisiert, mitunter hanebüchen ausfallen, das darf man wohl weniger als Schwäche denn als Ausweis jener Konsequenz verstehen, mit der sich Sa-nyang-eui-si-gan einem Genrekino verschreibt, in dem Waffen lauter als Worte sind. Wo das Recht des Stärkeren herrscht, gibt es ja auch nicht viel zu bereden.
Sa-nyang-eui-si-gan besetzt eine Lücke, die in Hollywood schon länger, international aber spätestens seit dem Verschwinden des Hong-Kong-Actionkinos klafft. Und wenn nach einer guten Stunde mächtige John Carpenter-Vibes aufkommen, liegt das nicht nur an der zunehmend humorlos vorgetragenen Gewalt, sondern auch an den Bildern: In den vernebelten Nachtszenen der zweiten Filmhälfte beginnen die Farben zu glühen: „Neon-Noir“.


Foto: Elio Germano in Volevo nascondermi – Hidden Away / © Chico De Luigi
22. Februar 2020
Volevo nascondermi – Hidden Away (Giorgio Diritti)
(Wettbewerb)
Christian: Antonio Ligabue war ein echter Outsider der Kunstwelt. Wegen Verhaltensauffälligkeiten zunächst in diverse Nervenheilanstalten, Armenhäuser und später gar des Landes verwiesen, lebte er als zeichnender Einsiedler in der Lombardei, bis eine Verkettung von Umständen zu seiner internationalen Entdeckung als Maler führte. Noch heute gilt er als prägende Figur der „Art Brut“. Giorgio Dirittis Wettbewerbsbeitrag ist eine der ersten Verfilmungen dieses unglücklichen Lebens und zieht alle dem Arthouse-Kino zur Verfügung stehenden Register, um den schmalen Grad zwischen Ausgrenzung und Akzeptanz eines Menschen auszuloten, der durch alle gesellschaftlichen Raster seiner Zeit rutschte. Dennoch gerät Volevo nascondermi in weiten Teilen zu einem arg kitschigen Kostümfilm über die (zumindest temporäre) Errettung eines Menschen durch die Kunst, worüber höchstens das Schauspiel seines Hauptdarstellers Elio Germano zu trösten vermag.


Foto: Érica Rivas in El prófugo – The Intruder / © Rei Cine SRL, Picnic Producciones SRL
22. Februar 2020
El prófugo – The Intruder (Natalia Meta)
(Wettbewerb)
Alexander: Ach Mensch, schon wieder Berlinale!? Jetzt also mit ohne Kosslick! Habt ihr Ekelpakete den freundlichen Herrn also erfolgreich rausgemobbt, ja? Und, seid ihr jetzt so richtig stolz auf euch?! Wie gefällt euch die „grundlegende Ausrichtung“ des Festivals, jetzt, wo das Kulinarische Kino Geschichte ist? Müsst ihr euch jetzt selber was anständiges zu beißen besorgen, in der schäbigen Systemgastronomie vom Potsdamer Platz. Viel Glück dabei!
Ich hatte ja immer schon ein eher indifferentes Verhältnis zu den Berliner Filmfestspielen, habe ich dort tatsächlich noch nie etwas gesehen, an das ich mich später so richtig noch hätte erinnern können. Die großen Knaller habe ich auf anderen Festivals zum ersten Mal gesehen: Cronenbergs Crash und Miikes Audition auf dem Filmfest Hamburg, Pulp Fiction gar auf dem Fantasy Filmfest. Die Duisburger Filmwoche hat für meine Filmbildung auch sehr viel mehr getan als das einzige A-Festival der Bundesrepublik. Was ich sagen will, ist, dass ich auch dieses Jahr nicht erwarte, hier irgendwelche großen Überraschungen zu erleben: Die kommenden Tage werde ich mit sehr gedrosselter Zuversicht in die Pressevorführungen reingehen – eigentlich muss der Film nur unterhaltsamer sein als meine erkältete Familie zu Hause mit ihrem Gehuste und Gerotze. Kriegt El prófugo – The Intruder das hin?
Nee, nicht so richtig. Mein Söhnchen ist Nasenschleim-verschmiert noch immer weit niedlicher als Natalia Metas Mystery-Thriller spannend ist. Woran hapert‘s? Der öde Fernsehlook hilft nicht gerade. Dass der Film ein einziger Prolog ist auch nicht. El prófugo ist über seine recht kompakte Laufzeit von gerade 90 Minuten zu verworren, legt für seine Gespenstergeschichte zu viele falsche Fährten aus und bekennt sich erst kurz vor Schluss zu seinem Genre. Und warum hat der Film nicht auch nur eine einzige wirklich bemerkenswerte Szene? Da sticht nichts raus. Der merkwürdige J-Horror Film, den Inés (Érica Rivas) zu synchronisieren hat und den wir in Auszügen zu sehen bekommen, sieht jedenfalls weit interessanter aus. Auf jeden Fall wettbewerbstauglicher. Nun, muss es Petzolds Undine am kommenden Sonntag eben rausreißen.


Foto: Margaret Qualley in My Salinger Year / © micro_scope
21. Februar 2020
My Salinger Year (Philippe Falardeau)
(Berlinale Special)
Sulgi: Trotz aller Vorfreude auf die Filme von Ferrara, Garrel, Hong, Reichardt und Tsai im Wettbewerb: Die Berlinale mit einem harmlosen Arthouse-Filmchen um eine Wannabe-Schriftstellerin im New York der 90er Jahre zu eröffnen, ist als programmatisches Statement schon sehr dürftig. Unangenehm die „Great Author“-Nostalgie nach J.D. Salinger, der als akusmatisches Wesen gottesgleich durch den Film geistert; noch unangenehmer eine besonders schmierige Jazzklarinetten-Version von Debussys „Claire de Lune“, bei der sich die Fänger im Roggen ihrer literarischen Empfindsamkeit vergewissern können.

21. Februar 2020
Malmkrog (Cristi Puiu)
(Encounters)
Tim: Auf den wahnsinnig seichten Eröffnungsfilm My Salinger Year folgt für mich der erste Walkout des Festivals. Malmkrog, von dem rumänischen Regisseur Cristi Puiu, beginnt eigentlich gut: Die Kamera schwenkt langsam von rechts nach links über eine verwunschene Schneelandschaft und folgt dabei einer laufenden Frau, die auf ein rosafarbenes Herrenhaus zuläuft. Kurze Zeit später kommen eine Herde Schafe samt Schäfer und ein großer Hund ins Bild. Nach einer Schrifttafel springt die Kamera ins Innere des Hauses. Dort wird es dann schnell unfassbar anstrengend. In nicht enden wollenden Dialogszenen diskutiert eine Gruppe aus Aristokrat*innen und Angehörigen der Streitkräfte im Französisch des 19. Jahrhunderts ohne Unterbrechung über Herrschaft, Krieg und Moral. Nach ungefähr 50 Minuten Sprachgewitter bin ich bereits komplett am Ende und verlasse das Kino – das verbleibende Publikum hat zu diesem Zeitpunkt noch 150 weitere Minuten vor sich. Der neue Programmleiter der Berlinale Mark Peranson wurde von einigen etablierten Filmkritikern, die befürchten, er werden das Festival am Publikum vorbei programmieren, von Beginn an mit Skepsis beäugt, dabei gehört der Kanadier zweifelsfrei zu den herausragenden Kennern der internationalen Filmlandschaft. Werke wie Malmkrog haben auf einem großen Filmfest wie der Berlinale sicher ihre Berechtigung, lassen die kritischen Stimmen aber vermutlich nicht leiser werden. Ein zäher Start!


Foto: Undine / © Hans Fromm/Schramm Film
20. Februar 2020
Fragen über Fragen: ein Ausblick aufs neue Programm
Tim: Ich habe mir auch dieses Jahr wieder das Programmheft zur Brust genommen und eine Zugfahrt lang vorab durchgearbeitet. Worauf ich mich freue, was mich die Stirn runzeln lässt und was sich hinter der neuen Wettbewerbs-Sektion „Encounters“ verbirgt, lest ihr in meinem Berlinale-Vorbericht.